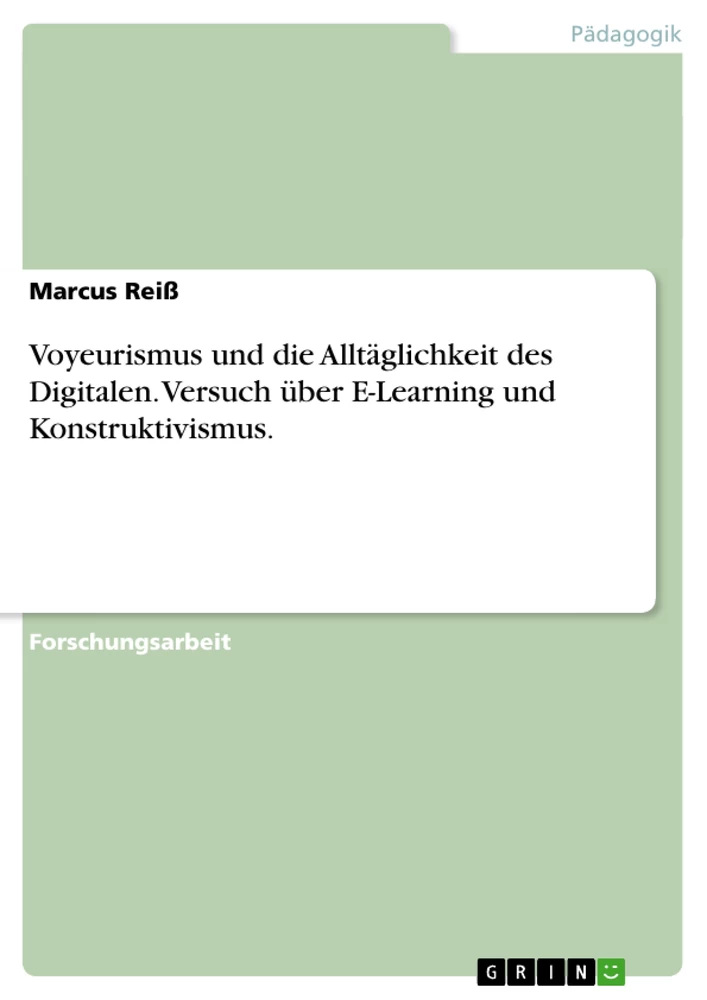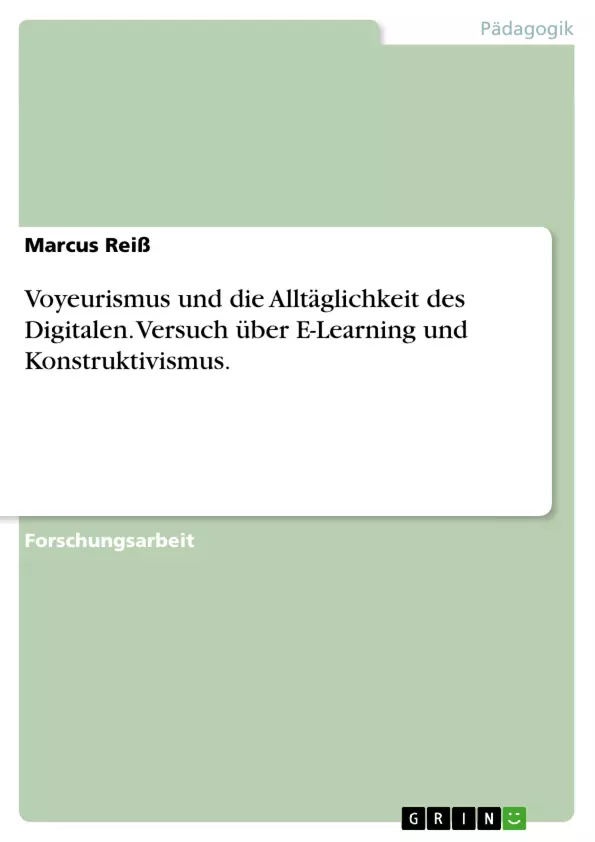[...] Unsere Analysen widmen sich dem Schnittpunkt zwischen konstruktivistisch
konnotierten Subjekts- bzw. Lehr-Lernkonzeptionen und deren Berücksichtigung für die
Gestaltung von Softwarearchitekturen. Aufzuzeigen wird sein, in welcher Weise und in
welchem Ausmaß eine Verwertung konstruktivistischer Theoreme Sinn macht und ob
ihrerseits eine Übersetzung bzw. „Digitalisierung“ möglich ist. Ziel ist auch, die
Relevanz des konstruktivistischen Paradigmas für eine Neubelebung der Allgemeinen
Didaktik zu bestimmen.
Zunächst ist es angebracht, das Forschungsfeld dieser Arbeit exemplarisch
abzustecken. Das erste Kapitel dient demzufolge dazu, einen Überblick zu geben über
einige zentrale Aspekte des E-Learning. Dabei werden in kritischer Absicht jene
Themen vorgestellt, denen maßgebliche Relevanz für die Bearbeitung unserer
Aufgabenstellung zukommt.
In einem zweiten Teil soll die Vielgestaltigkeit eines Radikalen Konstruktivismus
transparent gemacht werden. Konstruktiv verweist dabei nicht auf den Umstand, dass
es menschenmöglich ist, lebensdienliche Artefakte schaffen bzw. konstruieren zu
können. In erkenntnistheoretischer Hinsicht ist die Radikalität dieser Position deshalb
bedenklich, weil sie dem Machersubjekt attestiert, Welten schaffen zu können. Auf
welche Weise dieser Schluss gerechtfertigt wird, sollen Exkursionen in die Bereiche
Philosophie, Kybernetik, Neurophysiologie und Kognitionsbiologie nachzeichnen.
Nach diesen Vorüberlegungen liegt die Vermutung nahe, dass der
Konstruktivismus ein gänzlich anderes Verständnis von Lehren und Lernen besitzt, als
z.B. die behavioristische Psychologie. Die dadurch stattfindende theoretische
Neukonturierung des Lehrer-Schülerverhältnisses spielt zumal eine Rolle für die
Konzeption elektronischer Lernhilfen. Anhand bedeutsame Aspekte des Online-
Lernens wird aufgezeigt, inwiefern diese geeignet sind, Lernen á la Konstruktivismus
zu ermöglichen. Schließlich wollen wir in einem letzten Schritt zeigen, warum die
verheißungsvolle Rede von Radikalität eher einem „Strohmann“ (Groeben, 1998: 153)
gleicht und der Konstruktivismus seine Rolle als althergebrachtes Konzept in neuem
Gewand durchaus überzeugend spielt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- E-LEARNING
- ZUR GESELLSCHAFTLICHEN BEDEUTUNG VON E-Learning
- E-LEARNING?
- NETZSTRUKTUREN
- COMPUTERVERMITTELTE KOMMUNIKATION
- LEHR-LERNPLATTFORMEN
- ANFORDERUNGEN AN EIN DIDAKTISCHES „E-DESIGN“
- DAS RADIKAL-KONSTRUKTIVISTISCHE PROGRAMM
- ERKENNTNISTHEORETISCHE GRUNDLAGEN
- Das Realismusproblem
- Wahrheit und Anti-Ikonik
- KONSTRUKTIVISMUS UND „WIRKLICHKEIT“
- Das kybernetische Lernmodell
- Genetische Epistemologie
- Kognitionsbiologie
- Neurophysiologie
- EXKURS: LEHR-LERN-VARIATIONEN
- UM-LERNEN
- BELEHREN VERLERNEN
- DIE UMGEBUNGEN DES LERNENS
- AUTHENTISCHE SIMULATIONEN
- LERNWEGE
- HYPERTEXT UND DIE SEMANTIK DES GEHIRNS
- KOOPERATIVES LERNEN
- KRITISCHE EINWÄNDE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Schnittpunkt zwischen radikal-konstruktivistischen Lerntheorien und dem Einsatz von E-Learning-Technologien. Sie analysiert, ob und inwiefern die Prinzipien des radikalen Konstruktivismus für die Gestaltung digitaler Lernumgebungen nutzbar sind und welche Relevanz dieser Ansatz für die Erneuerung der Allgemeinen Didaktik hat.
- Die gesellschaftliche Bedeutung von E-Learning
- Die erkenntnistheoretischen Grundlagen des radikalen Konstruktivismus
- Die Relevanz konstruktivistischer Lerntheorien für die Gestaltung von E-Learning-Systemen
- Die kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen und Chancen des radikalen Konstruktivismus
- Die potentielle Bedeutung des Konstruktivismus für die Erneuerung der Allgemeinen Didaktik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung setzt den Rahmen der Arbeit und stellt die Bedeutung des Konstruktivismus im Kontext der Didaktik und des E-Learning vor. Sie führt in die Problematik der aktuellen didaktischen Debatte ein und beleuchtet die Rolle des Konstruktivismus als möglicher Antwort auf Herausforderungen des modernen Unterrichts.
- E-Learning: Das Kapitel analysiert die gesellschaftliche Bedeutung von E-Learning und erörtert die unterschiedlichen Facetten des Themas, wie z.B. Netzwerkstrukturen, computervermittelte Kommunikation und Lehr-Lernplattformen.
- Das radikal-konstruktivistische Programm: Dieses Kapitel beleuchtet die erkenntnistheoretischen Grundlagen des radikalen Konstruktivismus und diskutiert die Relevanz des Ansatzes für das Verständnis von Lernen und Wissen.
- Exkurs: Lehr-Lern-Variationen: Dieses Kapitel geht auf verschiedene Ansätze des Lernens ein, wie z.B. Um-Lernen und Belehren Verlernen.
- Die Umgebungen des Lernens: Das Kapitel fokussiert auf die Gestaltung von Lernumgebungen und diskutiert die Rolle von authentischen Simulationen, Lernwegen, Hypertext und kooperativem Lernen im konstruktivistischen Kontext.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Themen wie E-Learning, radikaler Konstruktivismus, didaktische Theorie, Lerntheorien, Wissenskonstruktion, computervermittelte Kommunikation, Lernumgebungen, und digitale Bildung. Das Forschungsfeld zeichnet sich durch einen interdisziplinären Ansatz aus, der Erkenntnisse aus den Bereichen der Didaktik, der Philosophie, der Kognitionsbiologie, der Kybernetik und der Medienwissenschaft integriert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist radikaler Konstruktivismus im Kontext von E-Learning?
Es ist eine Erkenntnistheorie, die besagt, dass Wissen nicht übertragen, sondern vom Lernenden individuell im eigenen Gehirn konstruiert wird.
Wie beeinflusst der Konstruktivismus das Lehrer-Schüler-Verhältnis?
Der Lehrer agiert nicht mehr als Wissensvermittler (Belehrender), sondern als Gestalter von Lernumgebungen, die Selbstlernen ermöglichen.
Welche Rolle spielen Simulationen beim Online-Lernen?
Authentische Simulationen bieten im konstruktivistischen Sinne Erfahrungsräume, in denen Lernende aktiv Probleme lösen und Wissen anwenden können.
Kann man Didaktik einfach „digitalisieren“?
Die Arbeit kritisiert die bloße Übersetzung alter Konzepte und fordert ein neues „E-Design“, das die Netzstrukturen und computervermittelte Kommunikation nutzt.
Was sind die kritischen Einwände gegen den radikalen Konstruktivismus?
Kritiker wie Groeben bezeichnen radikale Positionen oft als „Strohmann-Argumente“ und hinterfragen die praktische Umsetzbarkeit absoluter Wissenskonstruktion.
- Citar trabajo
- Marcus Reiß (Autor), 2003, Voyeurismus und die Alltäglichkeit des Digitalen. Versuch über E-Learning und Konstruktivismus., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22510