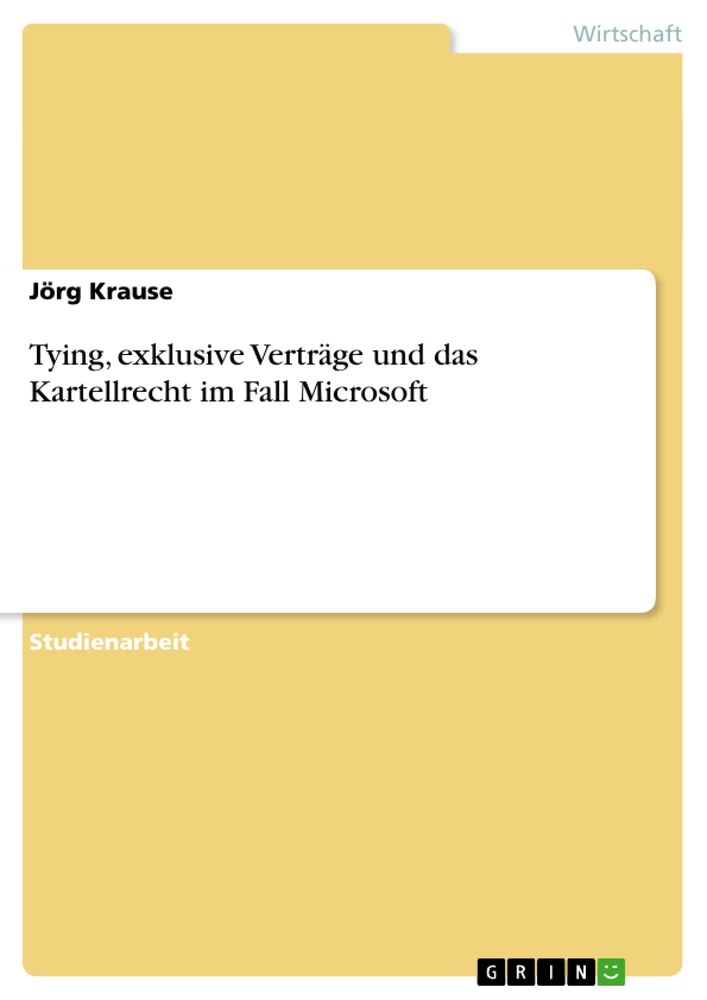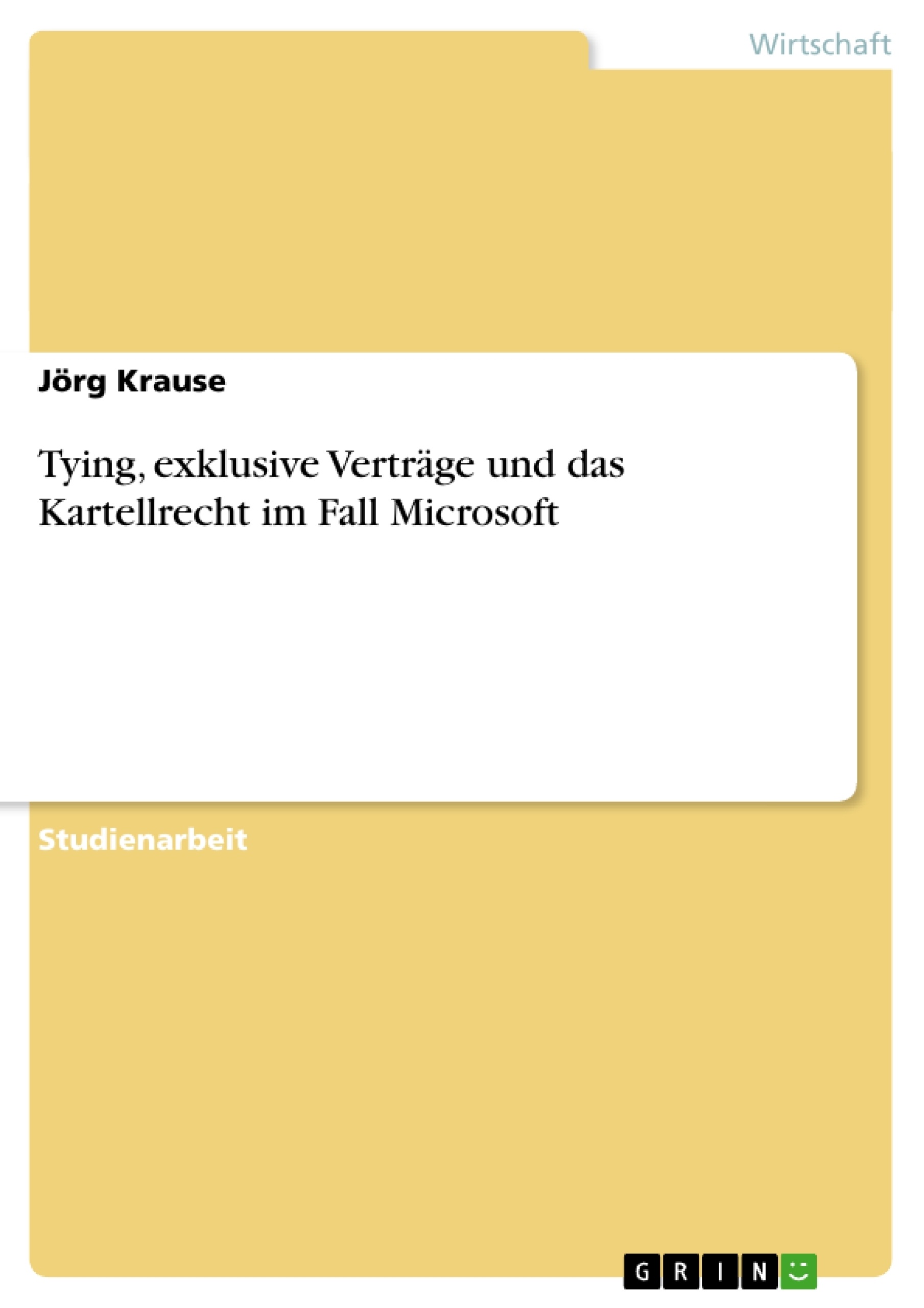Kartellrecht soll die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs gewährleisten. Dabei kann nur der aktuelle Wissensstand als Grundlage für die Rechtssprechung dienen. Bei der Analyse, ob Microsoft durch gezielten Einsatz wettbewerbsfeindlicher Maßnahmen zum Schaden der Konsumenten gehandelt hat, tauchen einige Fragen auf. Sind die alten Vorschriften des Shermanacts geeignet den Wettbewerb in New Economy Märkten zu schützen bzw. sind sie überhaupt anwendbar? Agiert Microsoft in einem solchen Markt und wie ist dieser zu charakterisieren? Welche konkreten ökonomischen Auswirkungen haben die Strategien der Kopplungsgeschäfte (engl.:Tie-in-Sales) und der exklusiven Verträge im Microsoft Fall? Wirken Microsofts Strategien zum Schutz seines Betriebssystemmonopol nur wettbewerbsschädlich bezogen auf den zweiten Protagonisten in diesem Kartellrechtsprozess, oder auch gesamtwirtschaftlich wohlfahrtsmindernd?
In dieser Arbeit wird versucht durch Fokussierung auf Tying und exklusive Verträge der Beantwortung dieser Fragen ein wenig näher zu kommen und die verschiedenen Standpunkte einander gegenüber zu stellen.
Dazu wird im ersten Teil das Unternehmen Microsoft, der Markt auf dem es agiert und die im Prozess betroffenen Produkte kurz dargestellt. Im zweiten Teil folgen die kartellrechtlichen Grundlagen und eine kurze Beschreibung des Prozessablaufes. Im 3. und 4. Teil werden dann die Details von exklusiven Verträgen und Tying untersucht. Darauf folgt im 5. Teil eine Wohlfahrtsbetrachtung, welche die Grundlage für die in der Schlussbetrachtung getroffenen Aussagen darstellt. Zumindest tendenziell soll an dieser Stelle eine Beurteilung der Ergebnisse des Prozesses vorgenommen werden.
Das Werk zeichnet sich durch die ökonomische Analyse der wettbewerbspolitischen Erwägungen und der juristischen Manifestation in konkretem Wettbewerbsrecht aus, wobei stets auf den Microsoft Fall bezogen wird.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1 DAS UNTERNEHMEN UND SEIN UMFELD
- 1.1 DIE GESCHICHTE VON MICROSOFT.
- 1.2 DIE BETROFFENEN PRODUKTE..
- 2 DER PROZESS
- 2.1 AMERIKANISCHES ANTITRUSTRECHT
- 2.1.1 Verfahrensablauf..
- 2.2 ÜBERBLICK ÜBER DIE HAUPTANKLAGEPUNKTE.
- 2.3 WETTBEWERBSRECHTLICHE EINORDNUNG VON TYING UND EXKLUSIVEN VERTRÄGEN
- 2.4 PROZESSVERLAUF IN DEN USA.
- 2.5 DER VORWURF DER MONOPOLISIERUNG AUS REGIERUNGSSICHT
- 2.6 DER VORWURF DER MONOPOLISIERUNG AUS MICROSOFTSICHT
- 2.6.1 Der New Economy Markt..
- 2.6.2 Kritik der Chicago School..
- 2.1 AMERIKANISCHES ANTITRUSTRECHT
- 3 TYING..............
- 3.1 FAKTISCHES TYING IM MICROSOFT FALL
- 3.2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN.
- 3.2.1 Die Kritik an der Chicago Kritik.
- 3.3 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DEN MICROSOFTFALL
- 4 EXKLUSIVE VERTRÄGE ...........\n
- 4.1 EXCLUSIONARY BEHAVIOR
- 4.1.1 Exklusivverträge mit PC-Herstellern.
- 4.1.2 Exklusivverträge mit ISP.
- 4.1.3 Exklusivverträge mit Internet Content Providern
- 4.1.4 Exklusivverträge mit Softwareverkäufern..
- 4.1.5 Sonstige effektiv exklusiv wirkende Verträge.
- 4.2 PREDATORY BEHAVIOR.
- 4.2.1 Predatory Pricing.
- 4.2.2 Microsofts Preissetzung..
- 4.3 THEORETISCHE GRUNDLAGEN DER EXKLUSIVERTRÄGE .
- 4.3.1 Theorie der Chicago School...
- 4.3.2 Modifikationen des Grundmodells
- 4.1 EXCLUSIONARY BEHAVIOR
- 5 WOHLFAHRTSEFFEKTE
- 5.1 KURZFRISTIGE EFFEKTE.
- 5.2 LANGFRISTIGE EFFEKTE
- 6 SCHLUSSBETRACHTUNG…………………………………….
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit den wettbewerbsrechtlichen Aspekten von Tying und exklusiven Verträgen im Kontext des Microsoft-Falls. Die Arbeit analysiert, ob Microsoft durch gezielten Einsatz wettbewerbsfeindlicher Maßnahmen zum Schaden der Konsumenten gehandelt hat. Dabei werden Fragen nach der Anwendbarkeit des Shermanakts in New Economy Märkten, den konkreten ökonomischen Auswirkungen der Strategien von Tying und exklusiven Verträgen im Microsoft Fall und den möglichen Wohlfahrtseffekten dieser Strategien untersucht.
- Analyse der Auswirkungen von Tying und exklusiven Verträgen auf den Wettbewerb
- Beurteilung der Anwendbarkeit des Shermanakts in New Economy Märkten
- Untersuchung der ökonomischen Folgen von Microsofts Strategien
- Diskussion der Wohlfahrtseffekte von Tying und exklusiven Verträgen
- Gegenüberstellung der Standpunkte von Microsoft und der US-Regierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 stellt das Unternehmen Microsoft, seinen Markt und die im Prozess betroffenen Produkte vor. Es zeichnet die Entwicklung von Microsoft von den Anfängen bis zum Aufstieg zum Marktführer im Bereich der Betriebssysteme nach.
- Kapitel 2 erläutert die kartellrechtlichen Grundlagen, die für den Microsoft-Fall relevant sind. Es geht auf das amerikanische Antitrustrecht, insbesondere den Sherman Act, ein und beschreibt den Prozessablauf.
- Kapitel 3 untersucht das Phänomen des Tying. Es analysiert die theoretischen Grundlagen des Tying, die faktischen Umstände im Microsoft-Fall und zieht Schlussfolgerungen für die Beurteilung der Microsoft-Strategien.
- Kapitel 4 beschäftigt sich mit exklusiven Verträgen. Es beleuchtet verschiedene Formen von Exklusivverträgen, die von Microsoft eingesetzt wurden, und analysiert die theoretischen Grundlagen dieser Strategien.
- Kapitel 5 widmet sich der Frage nach den Wohlfahrtseffekten von Tying und exklusiven Verträgen. Es betrachtet sowohl kurzfristige als auch langfristige Effekte und stellt die potenziellen Vorteile und Nachteile dieser Strategien gegenüber.
Schlüsselwörter
Tying, Exklusive Verträge, Microsoft, Antitrustrecht, Sherman Act, New Economy, Betriebssysteme, Wettbewerb, Wohlfahrtseffekte, Predatory Pricing, Exclusionary Behavior
Häufig gestellte Fragen zum Kartellrecht im Fall Microsoft
Was war der Hauptvorwurf gegen Microsoft im Kartellrechtsprozess?
Microsoft wurde vorgeworfen, seine Monopolstellung bei Betriebssystemen durch wettbewerbswidrige Maßnahmen wie Kopplungsgeschäfte (Tying) und Exklusivverträge missbraucht zu haben.
Was versteht man unter "Tying" (Kopplungsgeschäfte)?
Tying bedeutet, dass der Verkauf eines Produkts (z.B. Windows) an den Kauf eines anderen Produkts (z.B. Internet Explorer) gebunden wird, um Konkurrenten vom Markt auszuschließen.
Wie nutzte Microsoft exklusive Verträge?
Microsoft schloss Verträge mit PC-Herstellern und Internetprovidern ab, die diese verpflichteten, primär oder ausschließlich Microsoft-Software vorzuinstallieren oder zu bewerben.
Was ist der Sherman Act?
Der Sherman Act ist das grundlegende US-Antitrustgesetz von 1890, das Monopolbildung und unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen verbietet.
Welche ökonomischen Wohlfahrtseffekte wurden diskutiert?
Diskutiert wurde, ob Microsofts Strategien Innovationen hemmten (langfristig wohlfahrtsmindernd) oder durch Standardisierung kurzfristige Vorteile für Konsumenten brachten.
- Quote paper
- Dipl. Kfm. Jörg Krause (Author), 2003, Tying, exklusive Verträge und das Kartellrecht im Fall Microsoft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22511