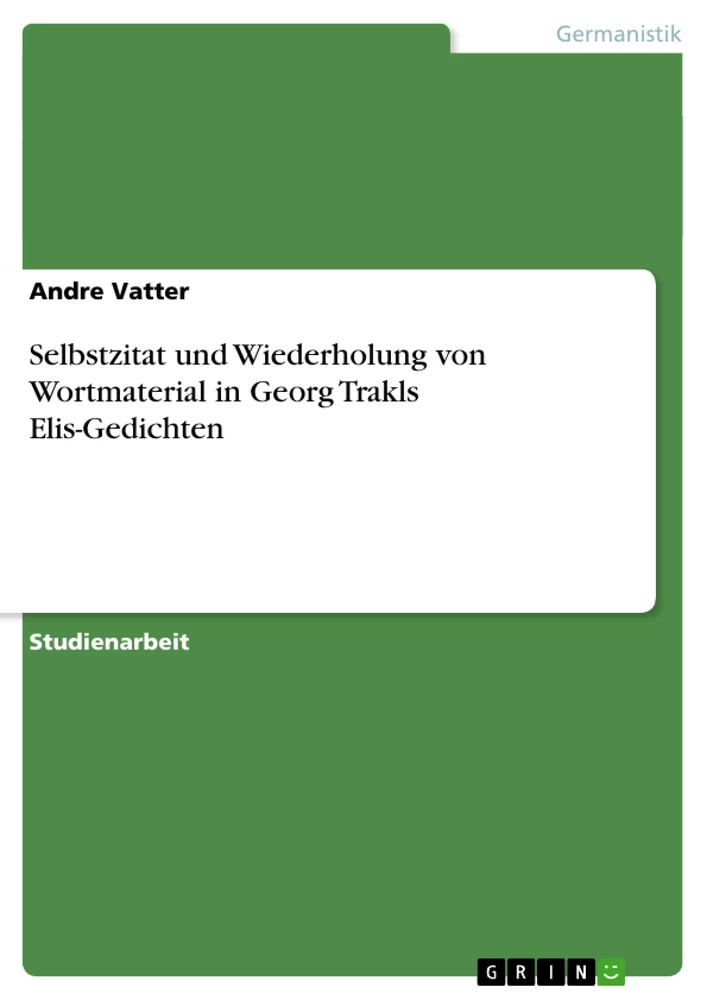Die Schwerpunkte der Arbeit liegen auf der Analyse der Selbstreflexivität von Trakls Lyrik sowie auf den intra- und intertextuellen Bezügen von "An den Knaben Elis".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Literaturwissenschaftliche Einordnung des Selbstzitats
- Der Begriff der Intertextualität
- Trakl und die Intratextualität
- Die Gedichte
- Quelle: Elis-Gedicht I.
- Hintergründe der Entstehung
- Phänomen und Ursprung des Selbstzitats
- Über die Wiederholung von Wortmaterial
- Der Mythos als Ursprung des Selbstzitats
- Die Rolle des Mythos in den Elis-Gedichten
- Die wiederkehrenden Motive im Detail
- Versuch der Aufschlüsselung von Chiffren
- Die verbindende Figur des Elis
- Drei literaturw. Ansätze der Herkunftsbestimmung
- Etymologischer Ansatz: Elis der Gott-Mensch
- Griechisch-mythologischer Ansatz: Endymion und Elysium
- Intertextueller Ansatz: Elis Fröbom
- Zusammenfassung
- Christlich-biblische Motive
- Griechisch-mythische Motive
- Bukolische und andere Motive
- Das Traklsche Farbwort Blau
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Selbstzitate und Wiederholungen von Wortmaterial in Georg Trakls Elis-Gedichten. Ziel ist es, die literaturwissenschaftliche Einordnung des Selbstzitats zu beleuchten, die Entstehung und Bedeutung der wiederkehrenden Motive zu analysieren und ihre semantische Aufschlüsselung zu versuchen.
- Die literaturwissenschaftliche Einordnung des Selbstzitats im Kontext der Intertextualität und Intratextualität
- Die Entstehung und Bedeutung der Elis-Gedichte
- Die Analyse der wiederkehrenden Motive im Werk Trakls
- Die Rolle des Mythos und der biblischen Symbolik in den Gedichten
- Die semantische Aufschlüsselung der wichtigsten Motive
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit und den Forschungsgegenstand vor und erläutert die Vorgehensweise.
- Das zweite Kapitel behandelt die literaturwissenschaftliche Einordnung des Selbstzitats im Kontext der Intertextualität und Intratextualität.
- Das dritte Kapitel präsentiert das Gedicht „An den Knaben Elis" als Beispieltext und beleuchtet die Entstehungshintergründe der Elis-Gedichte.
- Das vierte Kapitel untersucht das Phänomen der Selbstzitate in den Elis-Gedichten und analysiert die Wiederholung von Wortmaterial.
- Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der detaillierten Analyse der wiederkehrenden Motive, darunter die Figur des Elis, christlich-biblische und griechisch-mythische Motive sowie bukolische Elemente.
Schlüsselwörter
Selbstzitat, Intratextualität, Georg Trakl, Elis-Gedichte, Mythos, Symbolik, biblische Motive, griechische Mythologie, Sprachbilder, literarische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Georg Trakls Elis-Gedichten?
Die Arbeit analysiert die Selbstreflexivität, die Wiederholung von Wortmaterial und die tiefen intra- sowie intertextuellen Bezüge in Gedichten wie „An den Knaben Elis“.
Wer ist die Figur „Elis“ bei Trakl?
Elis ist eine zentrale Chiffre, die verschiedene Ursprünge haben kann: den etymologischen „Gott-Menschen“, mythologische Bezüge zu Endymion oder literarische Vorbilder wie Elis Fröbom.
Was bedeutet „Intratextualität“ in Trakls Werk?
Es beschreibt die ständige Wiederholung und Variation von Motiven, Bildern und Wortmaterial innerhalb Trakls eigenem Gesamtwerk, was einen dichten, selbstreferenziellen Kosmos schafft.
Welche Rolle spielt der Mythos in den Elis-Gedichten?
Der Mythos dient als Ursprung für Selbstzitate und Symbole, die über die individuelle Bedeutung hinausgehen und universelle, oft melancholische Stimmungen erzeugen.
Was symbolisiert das Farbwort „Blau“ bei Trakl?
Blau ist ein zentrales Traklsches Motiv, das oft für Geistigkeit, Transzendenz, aber auch für Kälte, Tod oder das Unendliche steht.
Welche anderen Motive sind typisch für diese Gedichte?
Typisch sind christlich-biblische Motive, griechisch-mythische Elemente sowie bukolische (hirtenidyllische) Bilder, die oft gebrochen dargestellt werden.
- Citation du texte
- Andre Vatter (Auteur), 2002, Selbstzitat und Wiederholung von Wortmaterial in Georg Trakls Elis-Gedichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22567