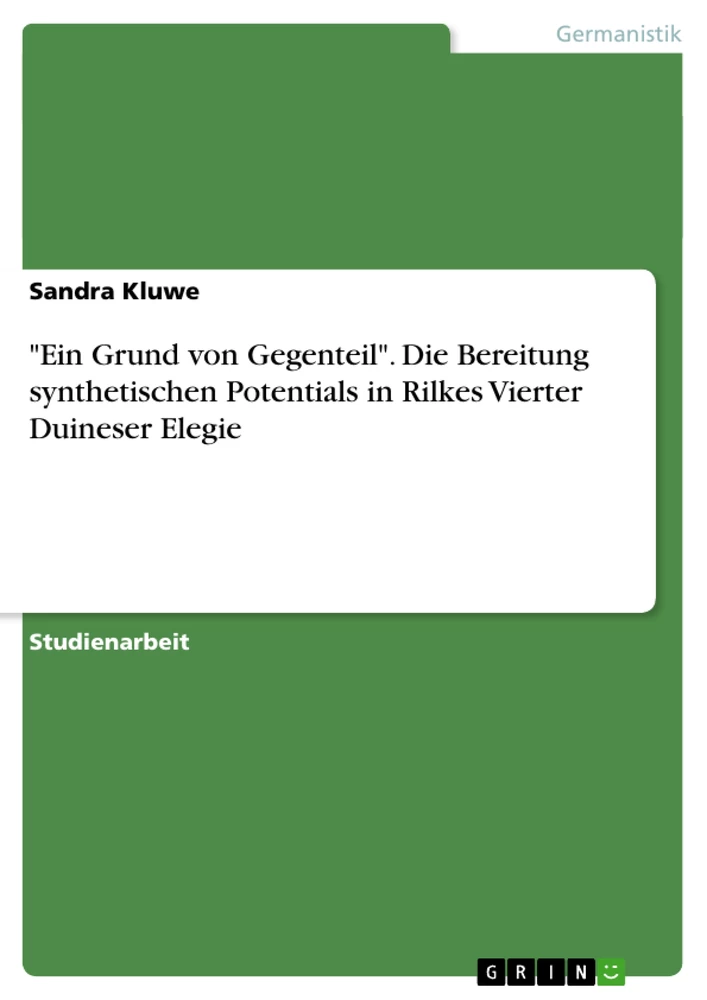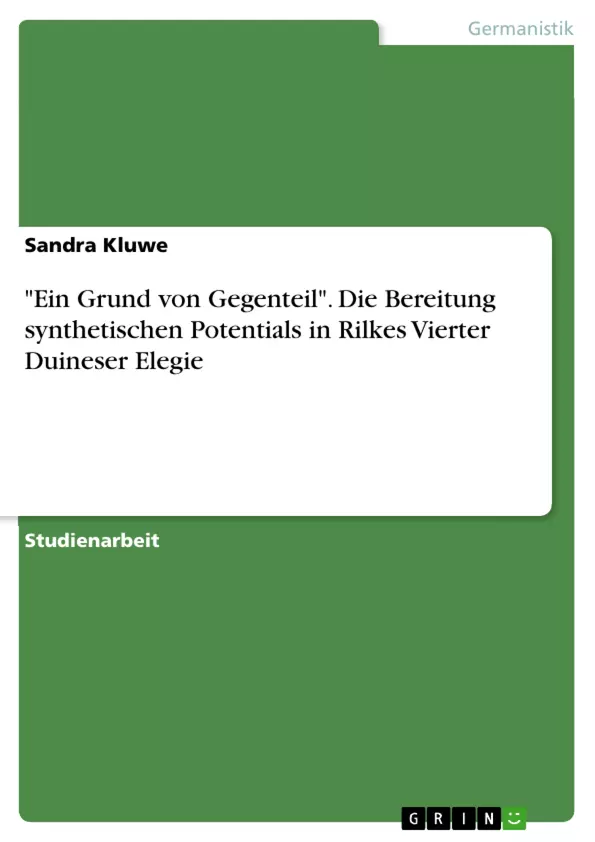Entgegen der Forschungsmeinung, dass Rilkes Dichtung in erster Linie selbstreferentiell sei, wird an der Position der älteren Forschung festgehalten, dass Rilke dem poetischen Wort - über seine Erkenntnis-, Darstellungs-, Kommunikations- und Symptomfunktion hinaus - sinnstiftende Funktion zuweist. Als Träger einer Sinnstiftung par excellence, als Antwort auf den zeitgenössischen Nihilismus konzipiert Rilke die 'Duineser Elegien'. Ulrich Fülleborn nennt das Ziel dieser Antwort eine 'universale Ontodizee'. Dies zu leisten: Rechtfertigung des Seins, Sinnbegründung angesichts unbegründbarer Negativität, ist die in zahlreichen Briefen dokumentierte Intention der 'Duineser Elegien'. Die Arbeit entfaltet das Theorem einer Sinnstruktur, wonach der über das Kunstsystem hinausweisende Sinn dasjenige Prinzip darstellt, nach dem die Aufschichtung (Strukturierung) der Elegien erfolgt. Ist die Ontodizee der Grund-Satz der Sinnstruktur, so wird seine Umsetzung durch ein Verfahren geleistet, das als 'Synthese' bezeichnet und anhand einer detailorientierten Interpretation der Vierten Duineser Elegie textanalytisch verankert wird. Ein Ausblick gilt der Synthese von Sein und Nicht-Sein, Klage und Rühmung in Rilkes Achter und Zehnter Duineser Elegie.
Inhaltsverzeichnis
- I. Methodologische Vorbemerkungen
- II. Interpretation
- 1. Nicht-einig-Sein
- 1.1 Anders-Sein
- 2. Grund von Gegenteil
- 2.1 Kontur des Fühlens
- 3. Bühne des Scheins
- 3.1 Abschied vom Sein
- 3.2 Schein-Schauspiel
- 3.2.1 Tänzer-Maske und Bürger-Leere
- 3.2.2 Puppen-Aussehn
- 4. Schicksal
- 5. Seins-Schauspiel
- 5.1 Engel und Puppe
- 5.2 Vorwand des Leistens
- 6. Reiner Vorgang
- 6.1 Kindertod
- 7. Zu poetologischen Deutungsansätzen
- 1. „Niemals nirgends ohne Nicht“
- III. Ausblick: Das Leisten von Synthese
- 1. „Nicht, weil Glück ist“ „die Quelle der Freude“ - ein Grund von Sein
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die vierte Duineser Elegie von Rainer Maria Rilke, indem sie aktuelle Ansätze der Rilke-Forschung auf ihre methodische Tragfähigkeit hin befragt. Der Fokus liegt auf der Frage, ob die in der Elegie geleistete Synthese als selbstreferentielles Strukturmoment der Sprache oder als vom Künstler intendierte Sinnprinzip-Stiftung zu verstehen ist.
- Analyse der Selbstreflexivität des Kunstsystems in Rilkes Werk
- Untersuchung der Syntheseleistung in der vierten Duineser Elegie
- Vergleichende Betrachtung verschiedener Interpretationsansätze
- Bedeutung von Metaphern und Allegorien in Rilkes Poetik
- Die Rolle von Schein und Sein in Rilkes Werk
Zusammenfassung der Kapitel
I. Methodologische Vorbemerkungen: Dieses Kapitel skizziert die Tendenzen der neueren Rilke-Forschung, die sich von inhaltsbezogenen Analysen hin zu strukturorientierten Interpretationen verlagert haben. Es werden die Ansätze von Eckel und Kaiser exemplarisch vorgestellt und kritisch hinterfragt, ob die Annahme einer Selbstreflexivität des Kunstsystems methodisch ausreichend ist, um Rilkes Werk zu verstehen. Die zentrale Frage ist, ob die Synthese in den Elegien ein selbstreferentielles Sprachphänomen oder ein vom Künstler beabsichtigtes Sinnprinzip darstellt.
II. Interpretation: Dieser Abschnitt analysiert verschiedene Aspekte der vierten Duineser Elegie. Die einzelnen Unterkapitel beleuchten Themen wie das „Nicht-einig-Sein“, das „Grund von Gegenteil“, die „Bühne des Scheins“, das „Schicksal“, das „Seins-Schauspiel“ und den „Reiner Vorgang“. Es werden dabei die komplexen Beziehungen zwischen Schein und Sein, zwischen dem menschlichen Erleben und der künstlerischen Darstellung untersucht und die unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten beleuchtet, wobei die Rolle der Metapher und Allegorie im Zentrum steht.
Schlüsselwörter
Rainer Maria Rilke, Vierte Duineser Elegie, Selbstreflexivität, Synthese, Poetik, Interpretation, Metapher, Allegorie, Schein, Sein, Selbstreferentialität, Sinnprinzip, sprachlicher Vollzug, Reflexion.
Häufig gestellte Fragen zur vierten Duineser Elegie von Rainer Maria Rilke
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die vierte Duineser Elegie von Rainer Maria Rilke. Sie hinterfragt aktuelle Ansätze der Rilke-Forschung auf ihre methodische Tragfähigkeit und konzentriert sich auf die Frage, ob die in der Elegie geleistete Synthese als selbstreferentielles Strukturmoment der Sprache oder als vom Künstler intendierte Sinnprinzip-Stiftung zu verstehen ist. Die Analyse untersucht die Selbstreflexivität des Kunstsystems in Rilkes Werk, die Syntheseleistung in der Elegie, und vergleicht verschiedene Interpretationsansätze. Die Bedeutung von Metaphern und Allegorien sowie die Rolle von Schein und Sein in Rilkes Poetik spielen ebenfalls eine zentrale Rolle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: I. Methodologische Vorbemerkungen skizziert Tendenzen der neueren Rilke-Forschung und hinterfragt die methodische Tragfähigkeit strukturorientierter Interpretationen. II. Interpretation analysiert verschiedene Aspekte der vierten Duineser Elegie, beleuchtet Themen wie „Nicht-einig-Sein“, „Grund von Gegenteil“, „Bühne des Scheins“, „Schicksal“, „Seins-Schauspiel“ und „Reiner Vorgang“, und untersucht die Beziehungen zwischen Schein und Sein. III. Ausblick: Das Leisten von Synthese fokussiert auf die Frage nach der Synthese als selbstreferentielles Sprachphänomen oder beabsichtigtes Sinnprinzip.
Welche methodischen Ansätze werden diskutiert?
Die Arbeit befasst sich kritisch mit aktuellen Ansätzen der Rilke-Forschung, die sich von inhaltsbezogenen Analysen hin zu strukturorientierten Interpretationen verlagert haben. Die Ansätze von Eckel und Kaiser werden exemplarisch vorgestellt und hinterfragt, ob die Annahme einer Selbstreflexivität des Kunstsystems ausreicht, um Rilkes Werk zu verstehen. Die zentrale Frage ist, ob die Synthese in den Elegien ein selbstreferentielles Sprachphänomen oder ein vom Künstler beabsichtigtes Sinnprinzip darstellt.
Welche Schlüsselthemen werden in der vierten Duineser Elegie behandelt?
Die Interpretation der vierten Duineser Elegie konzentriert sich auf Themen wie das „Nicht-einig-Sein“, das „Grund von Gegenteil“, die „Bühne des Scheins“, das „Schicksal“, das „Seins-Schauspiel“ und den „Reiner Vorgang“. Die komplexen Beziehungen zwischen Schein und Sein und die Rolle der Metapher und Allegorie stehen im Zentrum der Analyse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rainer Maria Rilke, Vierte Duineser Elegie, Selbstreflexivität, Synthese, Poetik, Interpretation, Metapher, Allegorie, Schein, Sein, Selbstreferentialität, Sinnprinzip, sprachlicher Vollzug, Reflexion.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die vierte Duineser Elegie, indem sie aktuelle Ansätze der Rilke-Forschung auf ihre methodische Tragfähigkeit hin befragt. Der Fokus liegt auf der Frage, ob die in der Elegie geleistete Synthese als selbstreferentielles Strukturmoment der Sprache oder als vom Künstler intendierte Sinnprinzip-Stiftung zu verstehen ist.
- Quote paper
- Sandra Kluwe (Author), 1999, "Ein Grund von Gegenteil". Die Bereitung synthetischen Potentials in Rilkes Vierter Duineser Elegie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22575