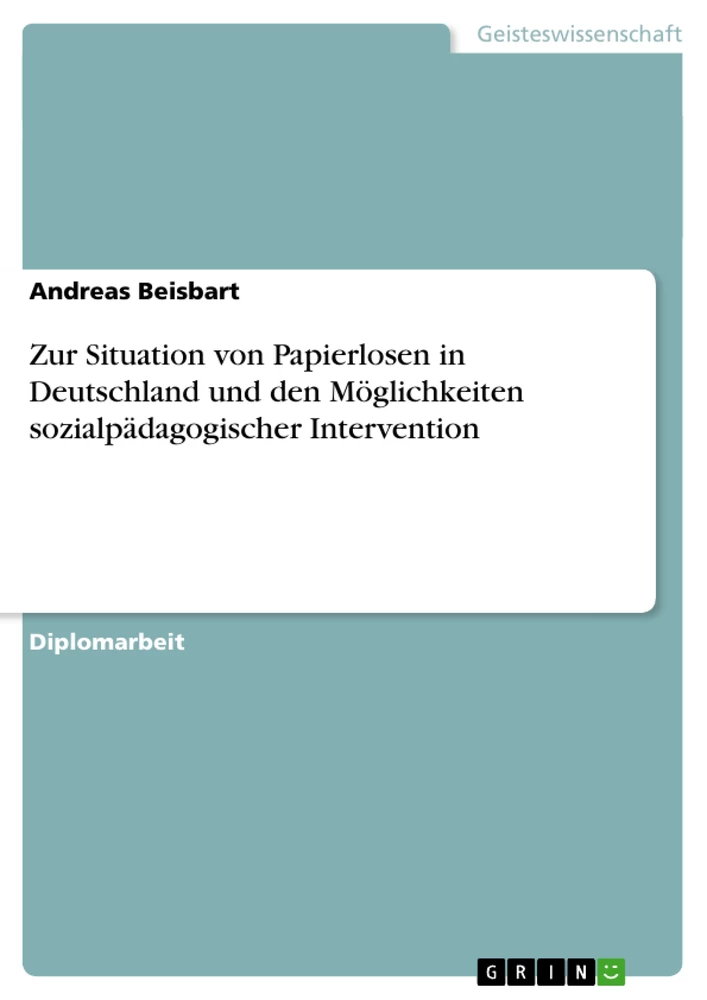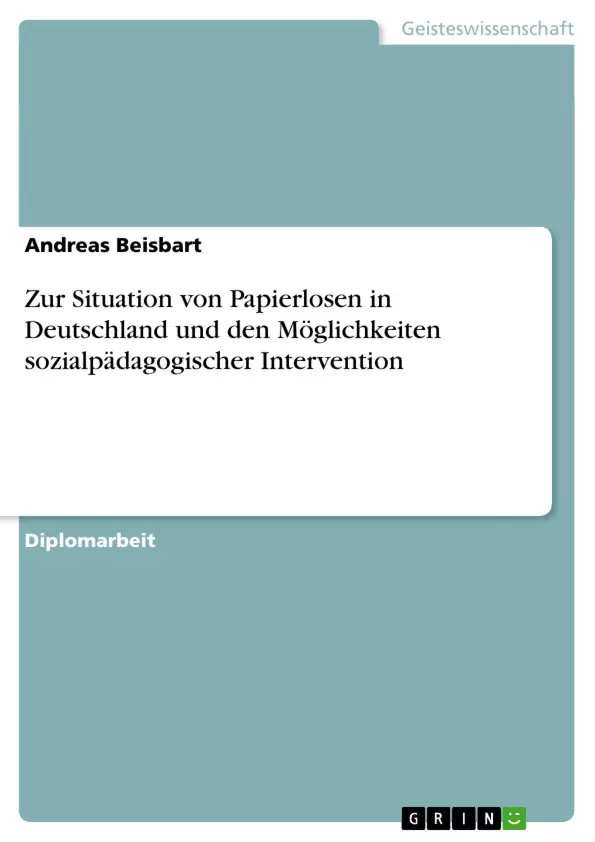Die Auseinandersetzung über Zuwanderung, Migration und Flucht ist in der BRD geprägt
von Abschottung, Nützlichkeitsüberlegungen und Fremdenfeindlichkeit. In der Regel
wird von Ausländern gesprochen, ohne dass diese als konkrete Subjekte und handelnde Individuen
wahrgenommen werden. Die Situation jedoch, in der sich Migrant/innen, insbesondere
ohne festen Aufenthaltsstatus, in Deutschland wiederfinden, fordert geradezu heraus, Stellung
zu beziehen: Wie könnte ein Umgang mit Menschen anderer Herkunft aussehen, der nicht
geprägt ist von Rassismus, Vorurteilen, Instrumentalisierung und Verwertung?
Die entscheidende Kategorie muss die Würde des einzelne Menschen sein. Die Abstraktionen,
denen wir im täglichen Leben unterworfen sind, die Subtrahierung von unseren
konkreten Bedürfnissen und Wünschen, Gefühlen und Träumen sind Zeichen der Entmenschlichung
und als solche Vorstufen von Barbarei und Vernichtung. Die Bestimmung eines Wertes
von Menschen, abhängig von einseitigen Beurteilungskriterien, und die sich anschließende
Ver-Wertung stellen die Negation der Individualität und Würde des Einzelnen dar.
Für eine umfassende Wahrung der Würde und Einzigartigkeit jedes Menschen muss
jedoch die Gesellschafts-Bezogenheit der Menschen mitgedacht und mitbeachtet werden. Die
universellen Rechte der Menschen, mithin das „Recht auf Rechte“, die Selbstentfaltung und
Würdigkeit müssen auf ihre Durchsetzbarkeit und Verwirklichung hin überprüft werden. Und
die gesellschaftlichen Bedingungen verhindern die Würdigkeit einiger Menschen in Deutschland,
oder schränken sie eklatant ein. Mithilfe von Gesetzen werden Menschen zu Bürger/
innen zweiter, dritter oder vierter Klasse gemacht oder ganz aus der Gesellschaft ausgeschlossen.
Migrant/innen werden nicht nur verbal in „nützliche“ und „überflüssige“, in berechtigt
und unberechtigt Zugewanderte eingeteilt. Am unteren Ende dieser Einteilung stehen
die sogenannten „Illegalen“, denen jegliche Rechte und ein würdevolles und menschliches
Leben verweigert werden. Gleichzeitig werden Außengrenzen verstärkt und neue, innere
Grenzen geschaffen:
„Die Grenzen differenzieren und vervielfältigen sich: Sie begrenzen den gesellschaftlichen
Raum nicht mehr lediglich von außen, der gesellschaftliche Raum
wird vielmehr zunehmend mit einem Kontrollnetz überzogen, das ihm seine spezifische
Form gibt und wie eine allgegenwärtige Grenze funktioniert.“1 [...]
1 Förderverein Niedersächsischer Flüchtlingsrat e.V. (Hg.) 1998, S. 13
Inhaltsverzeichnis
- ,,...dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei…..“
- Konkretisierung des Themas
- Politische Rahmenbedingungen
- ,,Illegalität“ in Deutschland
- Dauermigration und Pendelmigration
- Andere Formen der Papierlosigkeit
- Art der Einreise
- Quantifizierung...
- Asylrechtsbeschneidung und Abschreckung im Inneren
- Einschränkungen des Rechts auf Asyl
- Leistungskürzungen
- Weitere gesetzliche Regelungen
- Abschottung nach außen und „Grenzsicherung“
- Maßnahmen der BRD
- Europäische Maßnahmen
- ,,Menschenhändler“ und Fluchthelfer
- Frauen auf der Flucht.
- ,,Illegalität“ in Deutschland
- Zur Situation von Papierlosen in Deutschland
- Rechtliche Ansprüche und faktische Rechtlosigkeit
- Arbeit und Ausbeutung.
- Unterkunft
- Gesundheitsfürsorge.
- Bildung
- Soziale Beziehungen und Netzwerke
- Illegalisierte Frauen
- Kinder von Papierlosen und papierlose Kinder
- Zusammenfassung
- Rechtliche Ansprüche und faktische Rechtlosigkeit
- Politische und rechtliche Ebene der Verbesserung der Situation Papierloser
- Maßnahmen zur Verhinderung von Illegalität
- Legalisierungsvorschläge nach dem Vorbild anderer europäischer Staaten
- Konkrete Vorschläge zur Verbesserung der rechtlichen Stellung Papierloser
- Sozialpädagogische Ebene der Hilfe
- Anspruch und Wirklichkeit
- Hindernisse bei der Hilfe für Papierlose
- Kirchliche Positionen.
- Praxis in den Beratungsstellen.
- Projekte und (Selbst-)Organisationen
- Projekt :ZAPO:
- Medizinische Projekte
- Kirchenasyl.
- Die Kampagne „kein mensch ist illegal“
- Zusammenfassung: Chancen und Grenzen professioneller Hilfsangebote
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit von Andreas Beisbart befasst sich mit der Situation von Papierlosen in Deutschland. Sie beleuchtet die politischen Rahmenbedingungen, die zu dieser Situation führen, und untersucht die rechtlichen Ansprüche und faktischen Rechtlosigkeiten, denen Papierlose ausgesetzt sind. Darüber hinaus betrachtet die Arbeit die Möglichkeiten sozialpädagogischer Intervention und die Herausforderungen, die sich bei der Unterstützung von Papierlosen ergeben.
- Politische Rahmenbedingungen und „Illegalität“ in Deutschland
- Rechtliche Ansprüche und faktische Rechtlosigkeit von Papierlosen
- Soziale und gesellschaftliche Exklusion von Papierlosen
- Möglichkeiten sozialpädagogischer Intervention
- Herausforderungen der Unterstützung von Papierlosen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problematik der Situation von Papierlosen in Deutschland einführt. Anschließend werden die politischen Rahmenbedingungen beleuchtet, die zu dieser Situation führen. Dazu gehört die Asylrechtsbeschneidung, die Abschottung nach außen und die zunehmende Kriminalisierung von Migranten. Im nächsten Kapitel wird die Situation von Papierlosen in Deutschland genauer betrachtet, wobei die rechtlichen Ansprüche und faktischen Rechtlosigkeiten in den Bereichen Arbeit, Unterkunft, Gesundheitsfürsorge, Bildung und soziale Beziehungen im Fokus stehen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Diskriminierung und Ausbeutung, denen Papierlose ausgesetzt sind. Die Arbeit untersucht auch die spezifischen Herausforderungen für illegalisierte Frauen und Kinder von Papierlosen. Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung der Situation von Papierlosen in Deutschland.
Im fünften Kapitel werden politische und rechtliche Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation von Papierlosen diskutiert. Dabei werden Maßnahmen zur Verhinderung von Illegalität, Legalisierungsvorschläge und konkrete Vorschläge zur Verbesserung der rechtlichen Stellung von Papierlosen erörtert. Das sechste Kapitel widmet sich der sozialpädagogischen Ebene der Hilfe für Papierlose. Es werden Anspruch und Wirklichkeit der Unterstützung sowie die Hindernisse bei der Arbeit mit Papierlosen beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Rolle von Kirchen und Beratungsstellen sowie auf verschiedenen Projekten und (Selbst-)Organisationen, die sich für die Rechte von Papierlosen einsetzen. Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung der Chancen und Grenzen professioneller Hilfsangebote.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit konzentriert sich auf die Situation von Papierlosen in Deutschland. Die zentralen Themen sind die politische Rahmenbedingung, die zu „Illegalität“ führt, die rechtliche und faktische Rechtlosigkeit von Papierlosen, die Diskriminierung und Ausbeutung dieser Gruppe und die Möglichkeiten und Herausforderungen sozialpädagogischer Intervention. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Analyse der sozialen und gesellschaftlichen Exklusion von Papierlosen sowie der Möglichkeiten, ihnen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind „Papierlose“ in Deutschland?
Als Papierlose werden Menschen bezeichnet, die ohne gültigen Aufenthaltsstatus in Deutschland leben und dadurch oft von grundlegenden Rechten und sozialen Diensten ausgeschlossen sind.
Welchen rechtlichen Herausforderungen stehen Papierlose gegenüber?
Trotz universeller Menschenrechte herrscht eine faktische Rechtlosigkeit in Bereichen wie Arbeit (Ausbeutung), Gesundheitsfürsorge und Bildung, da der fehlende Status den Zugang erschwert.
Was ist sozialpädagogische Intervention bei Papierlosigkeit?
Sozialpädagogische Arbeit umfasst Beratung, Unterstützung in Notlagen und die Vermittlung an Projekte wie medizinische Hilfe oder Kirchenasyl, oft in einem Spannungsfeld zwischen Hilfe und Gesetz.
Welche Rolle spielen Kampagnen wie „kein mensch ist illegal“?
Solche Kampagnen setzen sich politisch für die Rechte von Menschen ohne Papiere ein und fordern eine Legalisierung sowie den Schutz der menschlichen Würde unabhängig vom Status.
Gibt es spezifische Probleme für papierlose Frauen und Kinder?
Ja, Frauen sind oft stärker von Ausbeutung bedroht, und für Kinder stellt der Zugang zu Bildung und eine stabile Entwicklung unter dem Druck der Illegalität eine enorme Hürde dar.
- Quote paper
- Andreas Beisbart (Author), 2002, Zur Situation von Papierlosen in Deutschland und den Möglichkeiten sozialpädagogischer Intervention, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22647