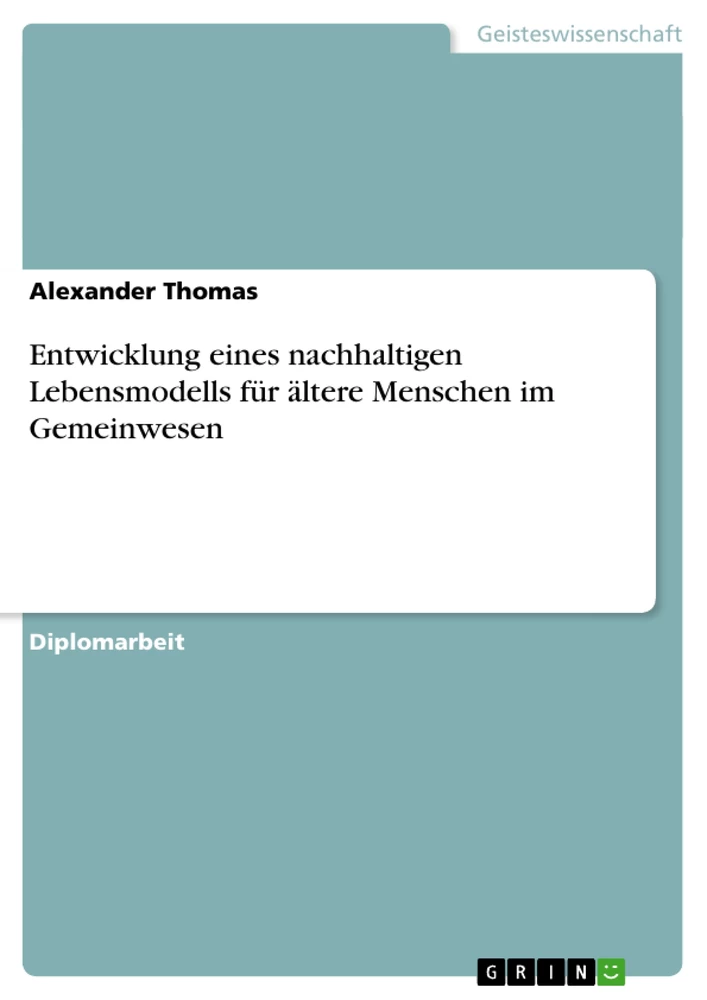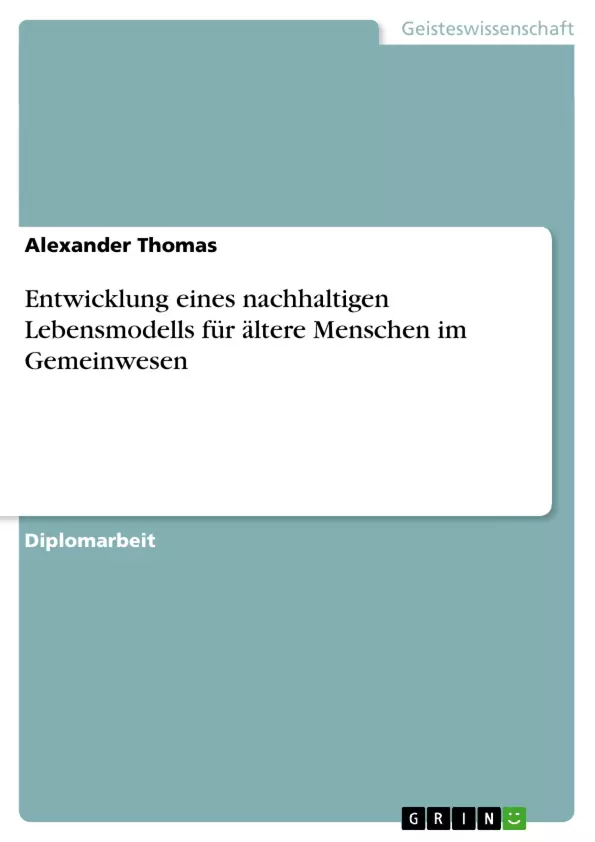Es ist ungewiss, wie die zunehmende Zahl älterer Menschen, bei gleichzeitig abnemender Zahl jüngerer Menschen, gute Lebensbedingungen im Alter haben können. So wird zwar über eine nachhaltige Reform der sozialen Sicherung diskutiert (Rürup-Kommission), aber alleine die Maßnahmen am System der Gesundheits-, Pflege-, und Rentenversicherung werden nicht ausreichen um nachhaltige Lebensmodelle im Alter zu gewährleisten. In einem Artikel im Focus 32/2003 wird dies immerhin klar erörtert und auf die Notwendigkeit des Umdenkens hingewiesen. Es werden Beispiele für eigenständige zivilgesellschaftliche Formen der sozialen Sicherung, wie gemeinschaftliches Wohnen und die Seniorengenossenschaften aufgeführt (Focus Nr. 32/2003).
Wichtig ist mir ein ganzheitlicher ökonomischer Lösungsansatz, einer Ökonomie, die in die Lebenswelt eingebettet ist und somit auch das Leben und die Betreuung älterer Menschen mit einbezogen wird. Auf der Basis eines gemeinwsenorientierten ökonomischen Verständnisses könnte die Zivilgesellschaft solidarische Lebensentwürfe als nachhaltige Lebensmodelle im Gemeinwesen entwickeln.
Die Arbeit gliedert sich wie folgt:
Im ersten Teil der Arbeit geht es um die Darstellung der Lebenssituation älterer Menschen und ihres Umfeldes. Anhand der Prognose der künftigen Bevölkerungsentwicklung zeigt sich, dass das zahlenmäßige Verhältnis der jüngeren zur älteren Generation drastisch zugunsten der Anzahl älterer Menschen ändern wird.
Im zweiten Kapitel sollen zunächst Ursachen für den Abbau des Sozialstaats aufgezeigt werden. Etwaige Rechtfertigungen der Notwendigkeit der Verlagerung sozialer Risiken ins Private mit der demographischen Entwicklung sollen hierdurch widerlegt werden.
Im dritten Teil der Arbeit wird die Rolle der Sozialen Arbeit mit älteren Menschen in diesem gesellschaftlichen Entwicklungsprozess näher beleuchtet. Grundlage ist die professionelle Grundhaltung des Empowerments und die systemische Sichtweise.
Im vierten Teil der Arbeit wird die Möglichkeit der genossenschaftlichen Selbsthilfe zur Entwicklung eigenständiger zivilgesellschaftlicher Formen sozialer Sicherung dargestellt. Diese stehen in direktem Zusammenhang mit bürgerschaftlichem Enga-gement. Es geht darum, dass die BürgerInnen sich nach dem Prinzip der Hilfe auf Gegenseitigkeit selbst organisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Altern in der Gesellschaft
- Demographische Entwicklung
- Dreifaches Altern
- Von der Pyramide zum Pilz
- Altersbilder
- Alter, Krankheit und Pflegebedürftigkeit
- Ökonomische Situation älterer Menschen
- Soziale Netzwerke
- Strukturwandel des Alters
- Konzepte des Altersstrukturwandels
- Verjüngung und Entberuflichung des Alters
- Feminisierung des Alters
- Singularisierung im Alter
- Hochaltrigkeit
- Soziale Ungleichheit
- Einführung der Pflegeversicherung
- Generationenvertrag
- Elemente einer nachhaltigen Sozialpolitik im Kontext der alternden Gesellschaft
- Sozialstaat im Wandel
- Krise des Sozialstaats
- Leitlinien für eine nachhaltige Sozialpolitik mit und für ältere Menschen
- Partizipatorische Entscheidungsdiskurse
- Gerechter Austausch
- Marktbegrenzung
- Solidarität
- Ethik des Alterns
- Lebensbereiche älterer Menschen
- Gesundheit
- Bildung und Kultur
- Wohnstrukturen
- Soziale Netzwerke
- Neue Ansätze Sozialer Arbeit mit älteren Menschen
- Empowerment als professionelle Grundhaltung
- Der Defizitblickwinkel in der Sozialen Arbeit
- Die Philosophie der Menschenstärken
- Systemische Soziale Arbeit
- Gemeinwesenarbeit mit älteren Menschen
- Sozialräumliche Orientierung
- Methodenintegration
- Koordination, Kooperation und Vernetzung als professionelles Arbeitsprinzip
- Begriffsklärung von Koordination, Kooperation und Vernetzung
- Care- und Case Management
- Leitstelle „Älter werden in Augsburg“
- „Netzwerk im Alter“ Berlin Pankow - Prenzlauer Berg - Weißensee
- Die Düsseldorfer Netzwerkstatt
- Prinzipien der Netzwerkarbeit
- Soziale Arbeit und bürgerschaftliches Engagement
- Lokale Ökonomie und Gemeinwesenökonomie
- Neuverortung des Sozialen im intermediären Bereich
- Intermediärer Sektor
- Notwendigkeit eines eigenständigen solidarökonomischen Sektors
- Ansätze zur eigenständigen zivilgesellschaftlichen Organisation sozialer Sicherung
- Bürgerschaftliches Engagement
- Genossenschaftliche Selbsthilfe als Organisationsform der Gemeinwesenökonomie
- Genossenschaftliche Selbsthilfe zur Organisation von Hilfe auf Gegenseitigkeit im Gemeinwesen
- Kriterien von gemeinwirtschaftlichen Genossenschaften
- Organisationsstrukturen einer Genossenschaft zur Förderung der Hilfe auf Gegenseitigkeit
- Kommunikative Strukturen
- Die Genossenschaft als lernende Organisation
- Mögliche Leistungsbereiche einer Genossenschaft zur Förderung der Hilfe auf Gegenseitigkeit
- Ambulante Dienstleistung als Profitcenter der Genossenschaft
- Exkurs: „Zeitdepot“ als Komplementärwährung zur Förderung der Hilfe auf Gegenseitigkeit
- Entstehung der „neuen“ Komplementärwährungen
- Funktionsweise der Komplementärwährungssysteme
- Beispielhafte Zeitdepotsysteme zur Förderung von Hilfeleistungen im Gemeinwesen
- Time Dollars
- Seniorengenossenschaften
- Fureai-Kippu System
- Funktionen einer Komplementärwährung in Form von Zeittausch und Zeitdepot
- Förderung der Solidarität
- Förderung von Reziprozität
- Ansparfunktion
- Probleme und Erfahrungen mit Zeitdepots
- Organisation eines Zeitdepots durch die Genossenschaft
- Vernetzung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit
- Ziele einer Genossenschaft zur Förderung der Hilfe auf Gegenseitigkeit
- Genossenschaftliche Selbsthilfe und professionelle Soziale Arbeit
- Einige Worte zu Förderung und Finanzierung
- Demographischer Wandel und Herausforderungen für das Alter
- Nachhaltige Sozialpolitik im Kontext der alternden Gesellschaft
- Empowerment und systemische Ansätze in der Sozialen Arbeit mit älteren Menschen
- Gemeinwesenökonomie und zivilgesellschaftliche Organisationsformen der sozialen Sicherung
- Komplementärwährungen und Genossenschaftliche Selbsthilfe
- Kapitel 1: Altern in der Gesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die demographische Entwicklung, Altersbilder und die Herausforderungen, die mit der alternden Gesellschaft verbunden sind. Themen wie der Strukturwandel des Alters, die zunehmende Pflegebedürftigkeit und die ökonomische Situation älterer Menschen werden behandelt.
- Kapitel 2: Elemente einer nachhaltigen Sozialpolitik im Kontext der alternden Gesellschaft: Das Kapitel untersucht den Wandel des Sozialstaats und skizziert Leitlinien für eine nachhaltige Sozialpolitik mit und für ältere Menschen. Themen wie Partizipation, gerechter Austausch, Marktbegrenzung und Solidarität werden diskutiert.
- Kapitel 3: Neue Ansätze Sozialer Arbeit mit älteren Menschen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den neuen Ansätzen der Sozialen Arbeit im Kontext der alternden Gesellschaft. Themen wie Empowerment, systemische Soziale Arbeit und Gemeinwesenarbeit werden beleuchtet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung von Koordination, Kooperation und Vernetzung.
- Kapitel 4: Ansätze zur eigenständigen zivilgesellschaftlichen Organisation sozialer Sicherung: Das Kapitel untersucht die Möglichkeiten zur Organisation sozialer Sicherung durch bürgerschaftliches Engagement und genossenschaftliche Selbsthilfe. Insbesondere wird das Konzept der Komplementärwährung „Zeitdepot“ im Kontext der Hilfe auf Gegenseitigkeit analysiert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines nachhaltigen Lebensmodells für ältere Menschen im Gemeinwesen. Ziel ist es, alternative und zivilgesellschaftliche Ansätze zur sozialen Sicherung im Kontext der alternden Gesellschaft zu erforschen und konkrete Handlungsempfehlungen für die Gestaltung einer nachhaltigen Sozialpolitik mit und für ältere Menschen zu entwickeln.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf Themen wie nachhaltige Lebensmodelle, demographischer Wandel, alternde Gesellschaft, soziale Sicherung, Sozialpolitik, Soziale Arbeit, Empowerment, systemische Ansätze, Gemeinwesenarbeit, Gemeinwesenökonomie, bürgerschaftliches Engagement, Genossenschaftliche Selbsthilfe, Komplementärwährungen, Zeitdepot, Hilfe auf Gegenseitigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der "demographische Wandel" im Kontext des Alterns?
Es beschreibt die Veränderung der Altersstruktur (von der Pyramide zum Pilz), bei der immer mehr ältere Menschen einer abnehmenden Zahl jüngerer Menschen gegenüberstehen.
Was sind Seniorengenossenschaften?
Das sind zivilgesellschaftliche Organisationsformen, bei denen sich Bürger nach dem Prinzip der Hilfe auf Gegenseitigkeit selbst organisieren, um Unterstützung im Alter zu sichern.
Wie funktioniert ein "Zeitdepot"?
Ein Zeitdepot ist eine Komplementärwährung: Man erbringt heute Leistungen für andere (z.B. Einkaufshilfe) und spart diese Zeitstunden auf einem Konto an, um sie später selbst gegen Hilfe einzutauschen.
Was bedeutet "Empowerment" in der Sozialen Arbeit mit Senioren?
Empowerment zielt darauf ab, die Stärken und Ressourcen älterer Menschen zu aktivieren, statt sie nur als hilfsbedürftig (Defizitblickwinkel) zu betrachten.
Welche Rolle spielt die Gemeinwesenökonomie?
Sie bettet wirtschaftliches Handeln in die Lebenswelt ein und fördert solidarische Lebensentwürfe, die über rein staatliche oder marktbasierte Sicherungssysteme hinausgehen.
- Quote paper
- Alexander Thomas (Author), 2003, Entwicklung eines nachhaltigen Lebensmodells für ältere Menschen im Gemeinwesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22648