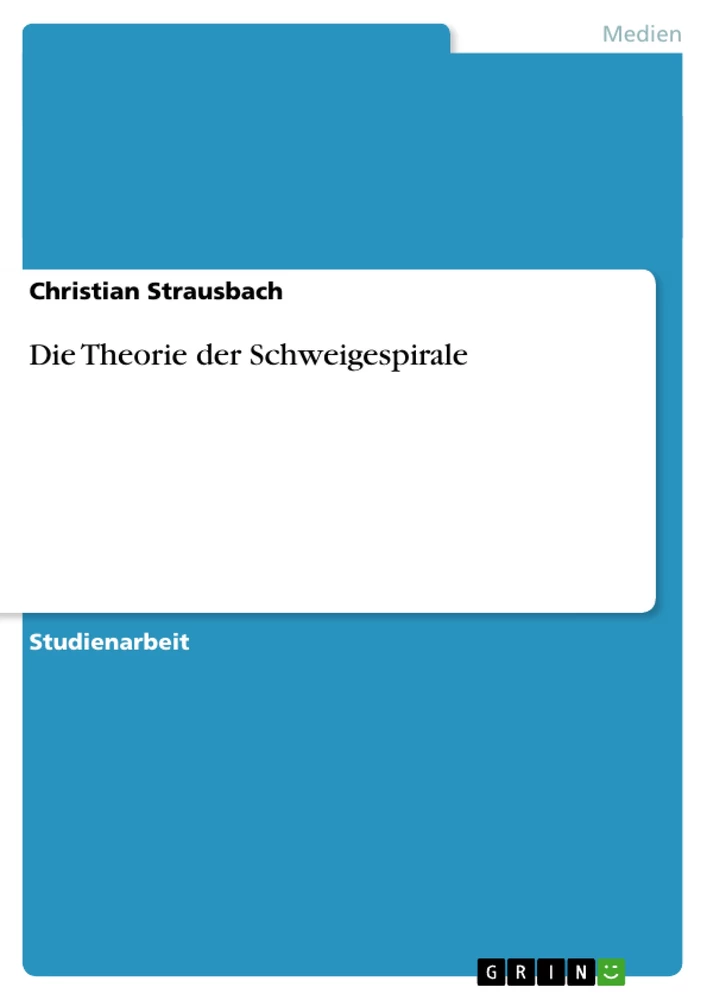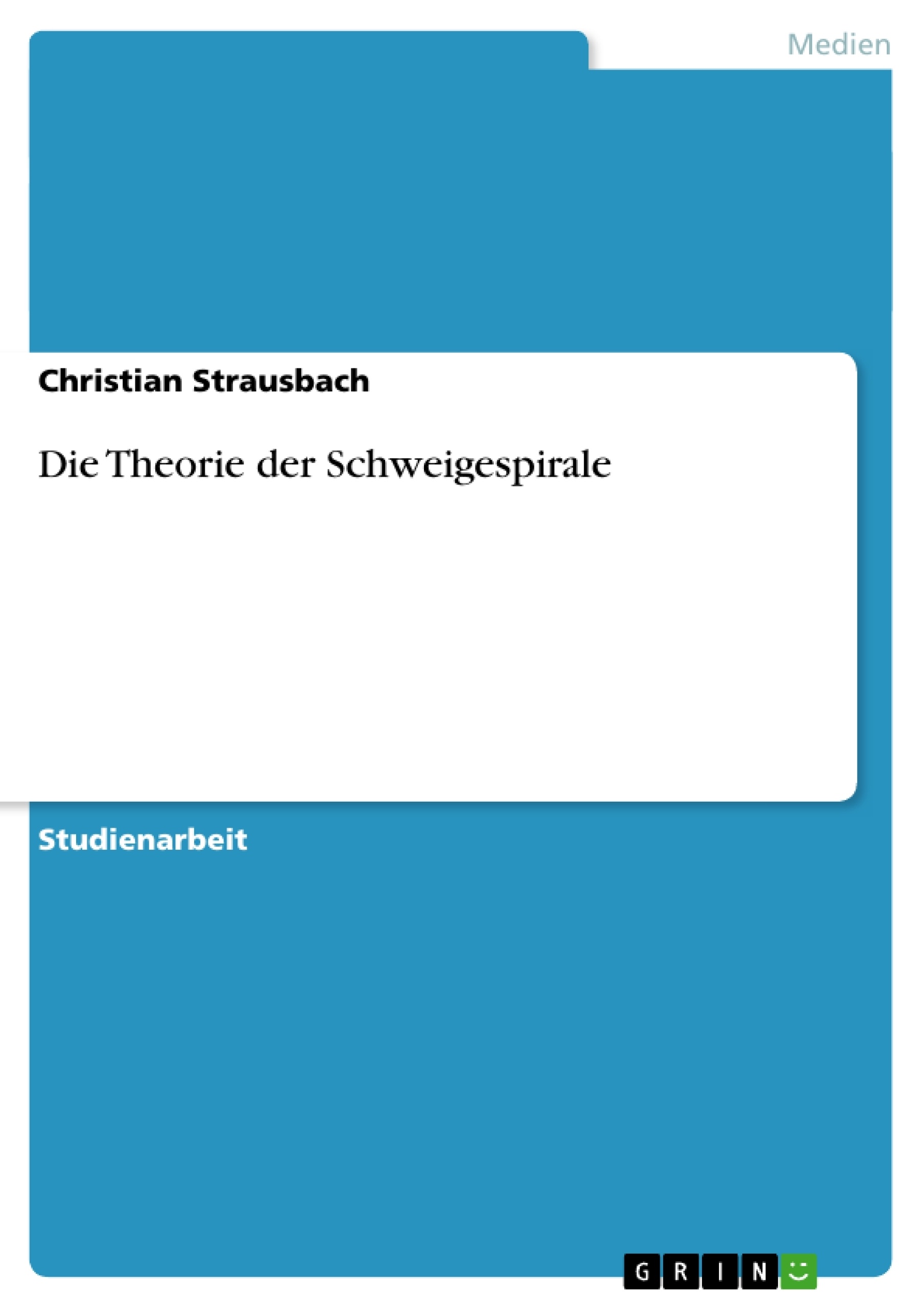Was sind die Beweggründe eines Menschen, seine eigene Meinung in der Öffentlichkeit nicht generell einfach zu äußern, wenn er beispielsweise in einem Interview danach gefragt wird?
Warum kommen so oft von Politikern, aber auch von ganz „normalen“ Menschen Antworten wie: „Kein Kommentar!“ oder: „Dazu möchte ich mich nicht äußern!“? Ist es die Angst davor, sich mit seiner persönlichen Meinung von der Meinung der Allgemeinheit bzw. Bevölkerung abzugrenzen und damit Gefahr zu laufen, sich von ihr zu isolieren bzw. Ablehnung in Form von Kommentaren und eventuellen Beschimpfungen zu erfahren?
Dieser Art von Isolationsfurcht, wie die Meinungsforscherin Elisabeth Noelle-Neumann sie genannt hat, die auch Auswirkungen auf die öffentliche Redebereitschaft zeigt, versucht sie in ihren Studien zur Theorie der Schweigespirale auf den Grund zu gehen. Nach einem sozialpsychologischen Rückgriff auf Solomon Asch soll daran anschließend zunächst der „Schweigespirale-Prozess“ näher erläutert werden. Auch sollen auf die sich innerhalb der Theorie der Schweigespirale herausgebildeten verschiedenen Gruppen der Kommunikationsbereitschaft noch genauer eingegangen werden und es soll abschließend festgestellt werden, ob Noelle-Neumanns Theorie der Schweigespirale aussagekräftig ist bzw. innerhalb der Bevölkerung in Erscheinung tritt und damit Anwendung findet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Noelle-Neumanns sozialpsychologischer Rückgriff auf Solomon Asch
- Das Laborexperiment von Asch
- Crutchfields Vereinfachung der Versuchsanordnung von Asch
- Der Mitläufer-Effekt
- Instrumente für Konformitätsdruck
- Isolationsfurcht bzw. Isolationsdrohung
- Soziale Anerkennung
- Randbedingungen der Theorie der Schweigespirale
- Wissenschaftliche Basisbereiche der Theorie der Schweigespirale
- Der psychologische Bereich der Verhaltens- und Einstellungstheorie
- Der Bereich der Kommunikationstheorie
- Der Bereich der Gesellschaftstheorie
- Verschiedene Gruppen der Kommunikationsbereitschaft
- Die Subgruppe der Reder und Schweiger
- Der Bereich zwischen Reder und Schweiger
- Die Gruppe der Inkonsistenten
- Die Anpasser
- Die Gruppe der Missionare
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Theorie der Schweigespirale von Elisabeth Noelle-Neumann, die das Phänomen der Isolationsfurcht und den Einfluss dieser Furcht auf die öffentliche Redebereitschaft untersucht. Die Arbeit beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Theorie und ihre Anwendung in der Praxis.
- Das Laborexperiment von Asch und seine Bedeutung für die Theorie der Schweigespirale
- Die Rolle der Isolationsfurcht und sozialer Anerkennung als Instrumente für Konformitätsdruck
- Die verschiedenen Gruppen der Kommunikationsbereitschaft und ihre Bedeutung im Kontext der Schweigespirale
- Die wissenschaftlichen Basisbereiche der Theorie der Schweigespirale
- Die Relevanz der Theorie der Schweigespirale für die öffentliche Meinungsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Seminararbeit führt in die Theorie der Schweigespirale ein und stellt die grundlegenden Fragen und Herausforderungen vor, die die Theorie zu beantworten versucht. Das zweite Kapitel analysiert das Laborexperiment von Solomon Asch und dessen Bedeutung für die Theorie der Schweigespirale. Es werden die verschiedenen Phasen des Experiments, die Ergebnisse und die Interpretation von Asch dargestellt. Das dritte Kapitel beleuchtet die Instrumente für Konformitätsdruck, die laut Noelle-Neumann eine wichtige Rolle für die Schweigespirale spielen. Es werden die Konzepte der Isolationsfurcht und der sozialen Anerkennung näher erläutert.
Schlüsselwörter
Die Theorie der Schweigespirale, Isolationsfurcht, Konformitätsdruck, öffentliche Meinung, Kommunikationsbereitschaft, soziale Anerkennung, Laborexperiment, Solomon Asch, Elisabeth Noelle-Neumann.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Theorie der Schweigespirale?
Die Theorie von Elisabeth Noelle-Neumann besagt, dass Menschen ihre Meinung eher verschweigen, wenn sie glauben, damit in der Minderheit zu sein, aus Angst vor sozialer Isolation.
Welche Rolle spielt das Laborexperiment von Solomon Asch?
Das Experiment von Asch zeigte, dass Individuen sich der offensichtlich falschen Meinung einer Gruppe anschließen, um nicht aufzufallen – ein Grundstein für das Verständnis von Konformitätsdruck.
Was ist Isolationsfurcht im Kontext der Meinungsbildung?
Isolationsfurcht ist die Angst, durch das Äußern einer abweichenden Meinung Ablehnung oder Beschimpfung zu erfahren und sich von der Gemeinschaft auszuschließen.
Welche Gruppen der Kommunikationsbereitschaft gibt es?
Es wird zwischen Redern, Schweigern, Anpassern und den sogenannten "Missionaren" unterschieden, die ihre Meinung trotz Widerstands offensiv vertreten.
Wie beeinflussen Medien die Schweigespirale?
Medien vermitteln den Eindruck, welche Meinungen in der Gesellschaft dominieren. Wenn Menschen ihre Sichtweise dort nicht repräsentiert sehen, verfällt diese eher dem Schweigen.
- Quote paper
- Christian Strausbach (Author), 2003, Die Theorie der Schweigespirale, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22652