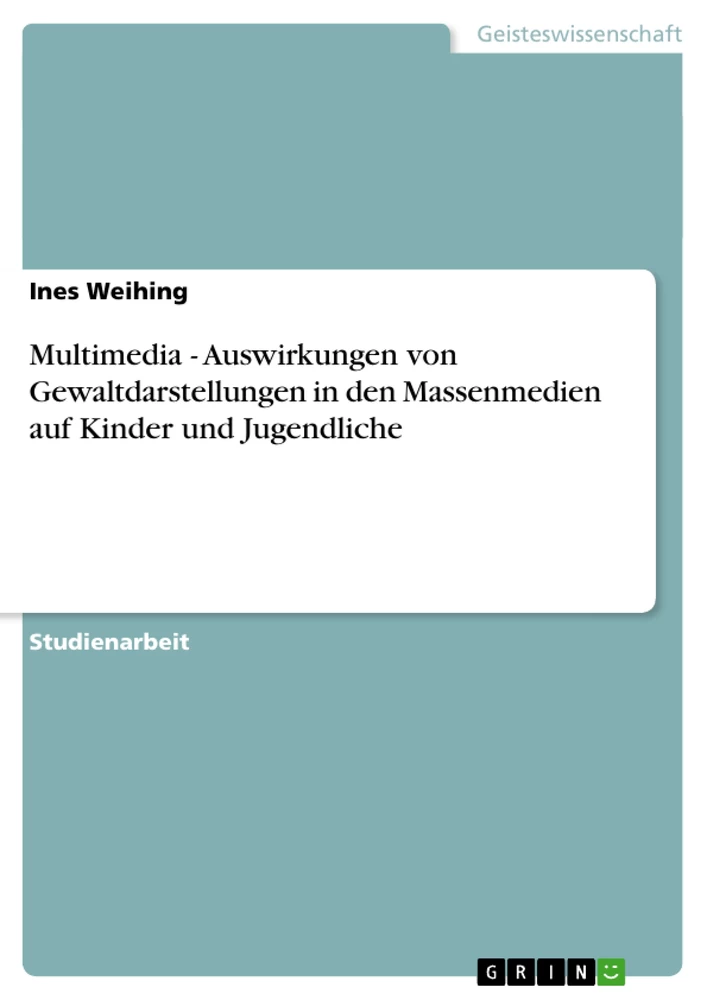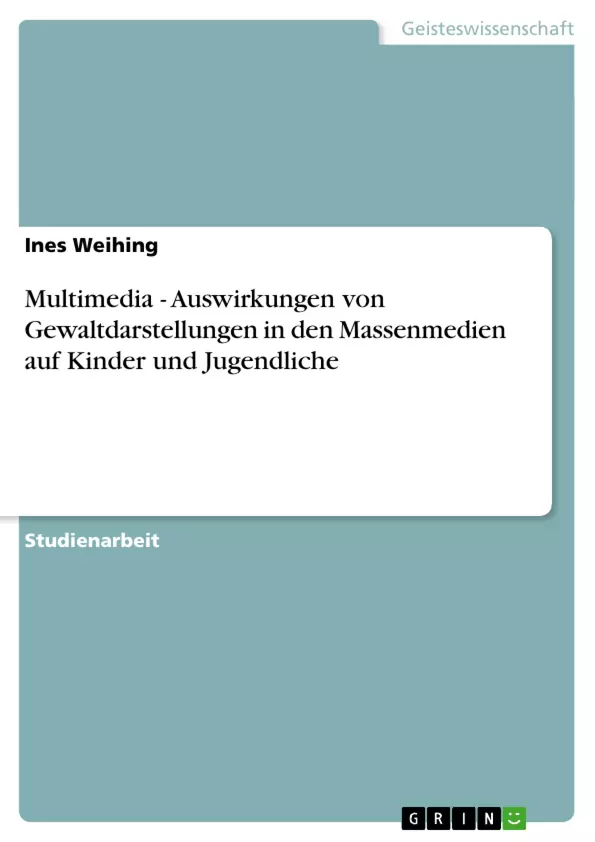[...] Das Fragezeichen im Titel deutet schon darauf hin, dass in diesem
Themenbereich keine Einigkeit über allgemeingültige Aussagen besteht. Es kann sich daher bei
dieser Arbeit eher um eine Thesensammlung und Vorstellung als um das Ziehen eines
endgültigen Schlusses handeln. Unter Gewalt wird im folgenden „Personale Gewalt“, bzw.
Aggression nach der Definition von Michael Kunczik verstanden: „Die beabsichtigte physische
und/oder psychische Schädigung einer Person, von Lebewesen und Sachen durch eine andere
Person“ (Bundesministerium des Inneren, 1996, S. 14). Psychische Schädigung ist weiterhin als
die „ Schädigung des Selbstbewusstseins und der Gefühle von Menschen, durch Beleidigung,
Bedrohung und Unterdrückung mit Worten“ und physische Schädigung, als „körperliche
Schädigung anderer Menschen durch den Gebrauch von Körperkraft oder Waffen“ definiert
(Theunert & Schorb, 1995, S. 133). Erweiternd sei hinzuzufügen, dass Schädigungen die nicht
von Personen im eigentlichen Sinne, sondern z. B. von Zeichentrickfiguren wie Tom und Jerry
ausgeübt werden auch als Gewalt zu verstehen sind.
Zunächst werde ich das Thema in den Kontext der aktuellen Medienausstattung in der BRD
einbetten und somit die Möglichkeiten der Mediennutzung für Kinder und Jugendliche
aufzeigen. Um deutlich zu machen, wie intensiv diese Medien genutzt werden, möchte ich
anschließend Nutzungsdaten aus aktuellen Studien des „Medienpädagogischen Forschungsverbundes
Südwest“ zum Medienkonsum Kinder und Jugendlicher vorstellen. Dabei gehe ich
insbesondere auf das Fernsehen, die Computernutzung inklusive Computerspielen und
nochmals extra auf das Internet ein. Weitere Medien wie Tonträger, Radio, Handys etc. werde
ich nur am Rande erwähnen und nicht im einzelnen darstellen. Im weiteren suche ich nach
Gründen und Motivationen für das Konsumieren von Gewaltdarstellungen. Anschließend
beschäftige ich mich mit der Rezeption und der Wirkung von Gewaltdarstellungen auf Kinder
und Jugendliche. Da es eine Fülle von Wirkungstheorien gibt, werde ich mich auf die
gängigsten und daher am häufigsten in der Literatur vertretenen beschränken. Zum Schluss
steht die Frage nach dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährlichen Inhalten und
ob es überhaupt möglich, beziehungsweise nötig ist Kinder vor medialer Gewalt zu schützen.
Hierbei möchte ich auf die Rolle des Jugendschutzes und der Erziehungspersonen aufmerksam
machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zugänglichkeit der Medien für Kinder und Jugendliche
- Aktuelle Ausstattung der Haushalte mit Medien
- Andere Möglichkeiten der Mediennutzung
- Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen
- Fernsehen
- Computer Computerspiele/Videospiele
- Internet
- Motive zum Konsum von medialer Gewalt
- Wirkungen von Gewaltdarstellungen in den Medien
- Rezeption von Kindern und Jugendlichen
- Die ,,gute\" Gewalt - Heldenbilder und Idole
- Wirkungstheorien
- Prävention?
- Die neuen Jugendmedienschutzbestimmungen
- Vermittlung von Medienkompetenz und selbstbestimmtem Umgang mit Medien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Gewaltdarstellungen in den Massenmedien auf Kinder und Jugendliche. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse des Medienkonsums, den Motiven für den Konsum von medialer Gewalt und den möglichen Wirkungen auf die Rezeption von Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit analysiert außerdem präventive Maßnahmen und Strategien für einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien.
- Zugänglichkeit von Medien für Kinder und Jugendliche
- Medienkonsum und Nutzung von medialer Gewalt
- Wirkungstheorien und die Rezeption von Gewaltdarstellungen
- Präventionsmaßnahmen und Schutzmechanismen
- Vermittlung von Medienkompetenz und Selbstbestimmung im Umgang mit Medien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Gewaltdarstellungen in den Massenmedien und deren Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche ein. Sie betont die Komplexität des Themas und die fehlende Einigkeit über allgemeingültige Aussagen. Anschließend wird der Begriff "Gewalt" anhand der Definitionen von Kunczik und Theunert/Schorb erläutert.
Kapitel 2 beleuchtet die Zugänglichkeit von Medien für Kinder und Jugendliche und beschreibt die Entwicklung der Mediennutzung im Laufe der Zeit. Es werden Statistiken und Daten aus aktuellen Studien (KIM, JIM) vorgestellt, die die Medienausstattung von Haushalten und den Medienbesitz von Kindern und Jugendlichen verdeutlichen.
Kapitel 3 analysiert den Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen, wobei der Fokus auf Fernsehen, Computer, Computerspielen und Internet liegt. Weitere Medien wie Tonträger, Radio und Handys werden nur am Rande erwähnt.
Kapitel 4 untersucht die Motive für den Konsum von medialer Gewalt.
Kapitel 5 befasst sich mit der Rezeption von Gewaltdarstellungen und deren Wirkung auf Kinder und Jugendliche. Es werden verschiedene Wirkungstheorien vorgestellt und die Relevanz von Heldenbildern und Idole in diesem Kontext diskutiert.
Kapitel 6 beleuchtet die Prävention von negativen Auswirkungen medialer Gewalt und diskutiert die neuen Jugendmedienschutzbestimmungen sowie die Bedeutung der Vermittlung von Medienkompetenz und selbstbestimmtem Umgang mit Medien.
Schlüsselwörter
Gewaltdarstellungen, Massenmedien, Kinder, Jugendliche, Medienkonsum, Rezeption, Wirkung, Wirkungstheorien, Prävention, Jugendmedienschutz, Medienkompetenz, Selbstbestimmung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird "Gewalt" in diesem Kontext definiert?
Unter Gewalt wird die beabsichtigte physische oder psychische Schädigung von Lebewesen oder Sachen verstanden, auch wenn sie von fiktiven Figuren ausgeübt wird.
Welche Medien werden hinsichtlich des Gewaltkonsums untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf Fernsehen, Computerspiele und das Internet.
Welche Wirkungstheorien zur medialen Gewalt gibt es?
Die Arbeit stellt gängige Theorien vor, die untersuchen, ob Medienkonsum zu Abstumpfung, Angst oder Nachahmungsverhalten führt.
Was ist "gute Gewalt" in den Medien?
Damit sind Heldenbilder und Idole gemeint, die Gewalt zur Erreichung positiver Ziele einsetzen, was die Rezeption bei Kindern beeinflussen kann.
Wie kann man Kinder vor medialer Gewalt schützen?
Neben gesetzlichen Jugendmedienschutzbestimmungen ist die Vermittlung von Medienkompetenz und ein selbstbestimmter Umgang durch die Erziehungspersonen entscheidend.
- Citation du texte
- Ines Weihing (Auteur), 2004, Multimedia - Auswirkungen von Gewaltdarstellungen in den Massenmedien auf Kinder und Jugendliche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22675