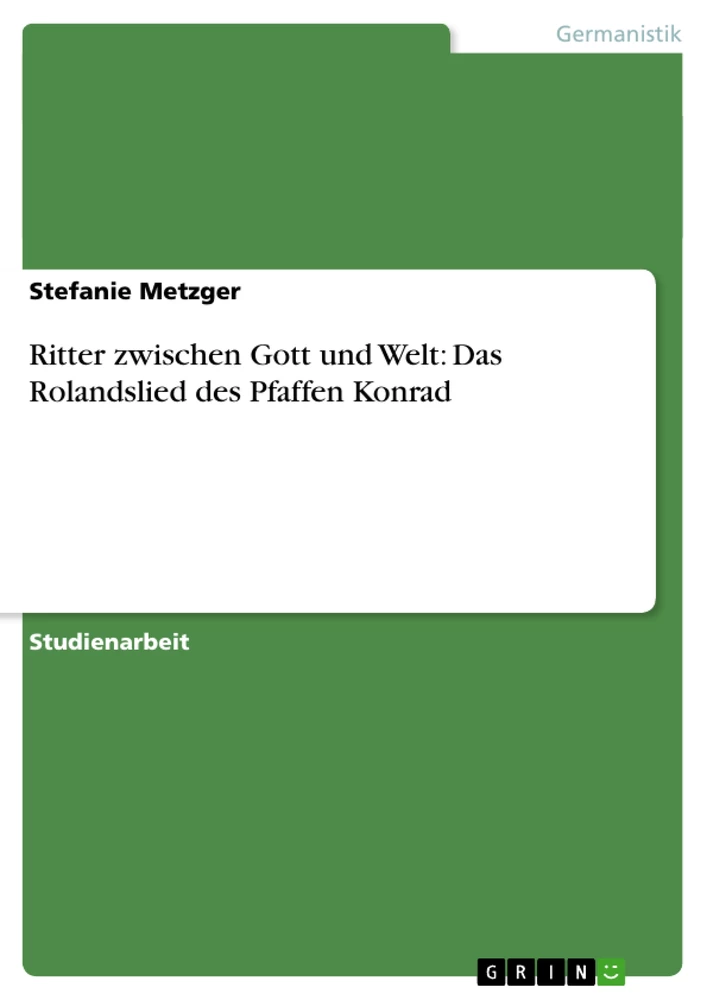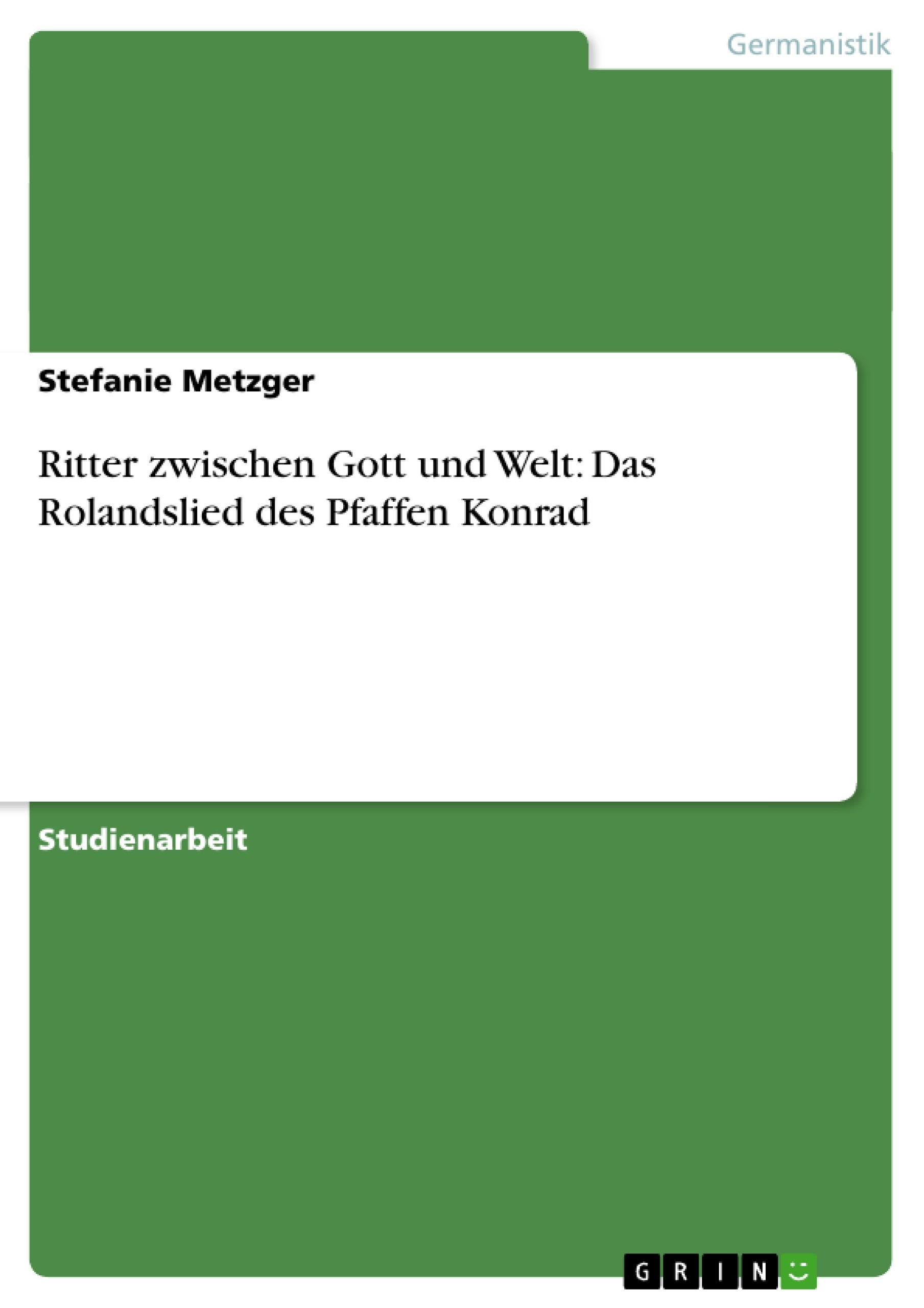Das "Rolandslied des Pfaffen Konrad als Medium welfischer Repräsentationskunst" ist eine Abhandlung, die das Machtbewusstsein einer der schillerndsten Gestalten des deutschen Hochmittelalters herausstellt: das Heinrichs des Löwen (1125-1195); des Welfenherzogs aus altem fränkischem Adelsgeschlecht. Als Spross einer der mächtigsten deutschen Dynastien betrachtete der Herzog von Sachsen und Bayern sich und seine Familie dem regierenden staufischen Herrscherhaus unter Kaiser Friedrich I. als ebenbürtig. Um die herausragende Stellung der Welfen in Norddeutschland zu manifestieren, gab er verschiedene Kunstwerke in Auftrag. Dabei bediente sich der Vetter Friedrich Barbarossas der genealogischen Anknüpfung an das karolingische Herrscherhaus; insbesondere an Karl den Großen. Das Widmungsgedicht des Helmarshausener Evangeliars sowie die Beauftragung des Mönchs Konrad mit der Übersetzung der um 1100 in Frankreich entstandenen "Chanson de Roland" sind Beispiele dieser Herrscherrepräsentation. Das Rolandslied; ein Werk der "Chanson de geste"; beschreibt die Schlacht von Roncesvalles, die Karl d.Gr. 778 in Spanien gegen die Mauren schlug. In der deutschen Übersetzung wird Heinrich mit Roland sowie mit Karl d. Gr. und dem biblischen König David in typologische Beziehung gesetzt. Idealistisch verklärt wird der Kreuzritter Heinrich darin als "tugendhafter Heidenbekehrer und Mehrer der Christenheit" bezeichnet; dessen Vasallen ihm so treu ergeben sind wie Roland seinem Kaiser Karl. Diese Art des Herrscherlobs entsprach jedoch längst nicht mehr den realen Verhältnissen des Lehnswesens zur Zeit des Welfenherzogs. Darum musste sich der Verfasser der deutschen Version der "Chanson d. R." altertümlicher Formen bedienen, verknüpft mit damals aktuellen ausländischen Motiven zum Zwecke der fürstlichen Repräsentation. Der Rekurs auf altertümliche Stilmittel diente auch der Legitimation welfischer Herrschaftsansprüche. Deshalb ließ Braunschweigs Gründer sein Löwendenkmal vor der Burg Dankwarderode errichten; darum stiftete er den Dom St. Blasius, das kostbare St.Oswald-Reliquiar und den Marienaltar des Braunschweiger Doms. Aus diesem Grund erscheinen Heinrichs kaiserliche Großeltern auf dem Krönungsbild des prächtigen Helmarshausener Evangeliars in herausragender Stellung. All dies sollte das herrscherliche Selbstverständnis eines Adelsgeschlechts zum Ausdruck bringen, "das sich auch ohne Krone königlich wusste" und das mit der Stauferdynastie um den Kaiserthron konkurrierte.
Inhaltsverzeichnis
- Das Selbstverständnis des Welfengeschlechts
- Die Begründung einer karolingischen Tradition durch Heinrich den Löwen
- Herrscherrepräsentation durch Architektur, Kunst und Literatur
- Das Löwendenkmal von Braunschweig
- Der Braunschweiger Dom St. Blasius und die Burg Dankwarderode
- Das Oswald - Reliquiar
- Die genealogische Repräsentation
- Der Marienaltar des Braunschweiger Doms
- Das Helmarshausener Evangeliar
- Der Davidsvergleich
- Der Werkstil
- Das heilige Reliquienschwert Durndart
- Der feodale Gehalt welfischer Repräsentationskunst
- Die Fürbittformel
- Die Intention Heinrichs des Löwen
- Die Orientierung an altertümlichen Stilvorbildern
- Genealogische Repräsentation zur Unterstützung welfischer Herrschaftsansprüche
- Das feodale Gotteskriegertum des Rolandsliedes als Gegenbild zu den realen Verhältnissen des Lehnswesens zur Zeit des Welfenherzogs
- Resumée
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bedeutung des deutschen Rolandsliedes für die Repräsentation des Welfengeschlechts im Hochmittelalter. Der Fokus liegt auf dem Selbstverständnis der Welfen und der Rolle Heinrichs des Löwen bei der Begründung einer karolingischen Tradition.
- Das Selbstverständnis des Welfengeschlechts und dessen Verbindung zur Karolingerzeit
- Heinrich des Löwen und seine Bemühungen, eine karolingische Tradition zu etablieren
- Die Rolle des Rolandsliedes als Medium welfischer Repräsentation
- Herrscherrepräsentation durch Architektur, Kunst und Literatur
- Die genealogische Repräsentation der Welfen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Das Selbstverständnis des Welfengeschlechts: Dieses Kapitel untersucht die genealogische Verbindung der Welfen zu Karl dem Großen und das daraus resultierende Selbstverständnis des Geschlechts als bedeutender Teil des Königsheils.
- Kapitel II: Die Begründung einer karolingischen Tradition durch Heinrich den Löwen: Hier wird die besondere Rolle Heinrichs des Löwen bei der Begründung einer karolingischen Tradition für die Welfen betrachtet.
- Kapitel III: Herrscherrepräsentation durch Architektur, Kunst und Literatur: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Formen der Herrscherrepräsentation durch Architektur, Kunst und Literatur, insbesondere im Kontext der welfischen Dynastie.
- Kapitel IV: Die genealogische Repräsentation: Dieser Abschnitt analysiert die Darstellung der welfischen Genealogie in Kunstwerken wie dem Marienaltar des Braunschweiger Doms und dem Helmarshausener Evangeliar.
- Kapitel V: Der Davidsvergleich: Dieses Kapitel untersucht die Verwendung des Davidsvergleichs als Mittel der Herrscherrepräsentation.
- Kapitel VI: Der Werkstil: Hier werden verschiedene Aspekte des Werkstils der welfischen Repräsentationskunst betrachtet, einschließlich des heiligen Reliquienschwertes Durndart und der Fürbittformel.
- Kapitel VII: Die Intention Heinrichs des Löwen: Dieses Kapitel analysiert die Intentionen Heinrichs des Löwen bei der Förderung von Kunst und Literatur, insbesondere in Bezug auf die Verbindung zur Karolingerzeit und das Rolandslied.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Welfen, Heinrich der Löwe, Rolandslied, Karolinger, Herrscherrepräsentation, genealogische Repräsentation, Architektur, Kunst, Literatur, Selbstverständnis, staufische Dynastie.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel Heinrichs des Löwen mit dem Rolandslied?
Heinrich der Löwe nutzte das Rolandslied als Medium der Herrscherrepräsentation, um seine Machtstellung zu manifestieren und eine genealogische Verbindung zum karolingischen Herrscherhaus herzustellen.
Wie wird Heinrich der Löwe im Rolandslied dargestellt?
Er wird typologisch mit Roland, Karl dem Großen und dem biblischen König David in Beziehung gesetzt und als „tugendhafter Heidenbekehrer“ idealisiert.
Welche weiteren Kunstwerke dienten der welfischen Repräsentation?
Neben dem Rolandslied werden das Braunschweiger Löwendenkmal, der Dom St. Blasius, das Helmarshausener Evangeliar und das St. Oswald-Reliquiar genannt.
Warum wurden im Rolandslied altertümliche Stilmittel verwendet?
Der Rückgriff auf altertümliche Formen diente der Legitimation welfischer Herrschaftsansprüche und entsprach dem herrscherlichen Selbstverständnis eines Geschlechts, das mit den Staufern konkurrierte.
Welche Rolle spielt die „Chanson de Roland“ für die deutsche Fassung?
Der Pfaffe Konrad wurde beauftragt, das um 1100 in Frankreich entstandene Werk zu übersetzen und dabei gezielt auf die Bedürfnisse der welfischen Repräsentation anzupassen.
- Citar trabajo
- Stefanie Metzger (Autor), 1996, Ritter zwischen Gott und Welt: Das Rolandslied des Pfaffen Konrad, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22715