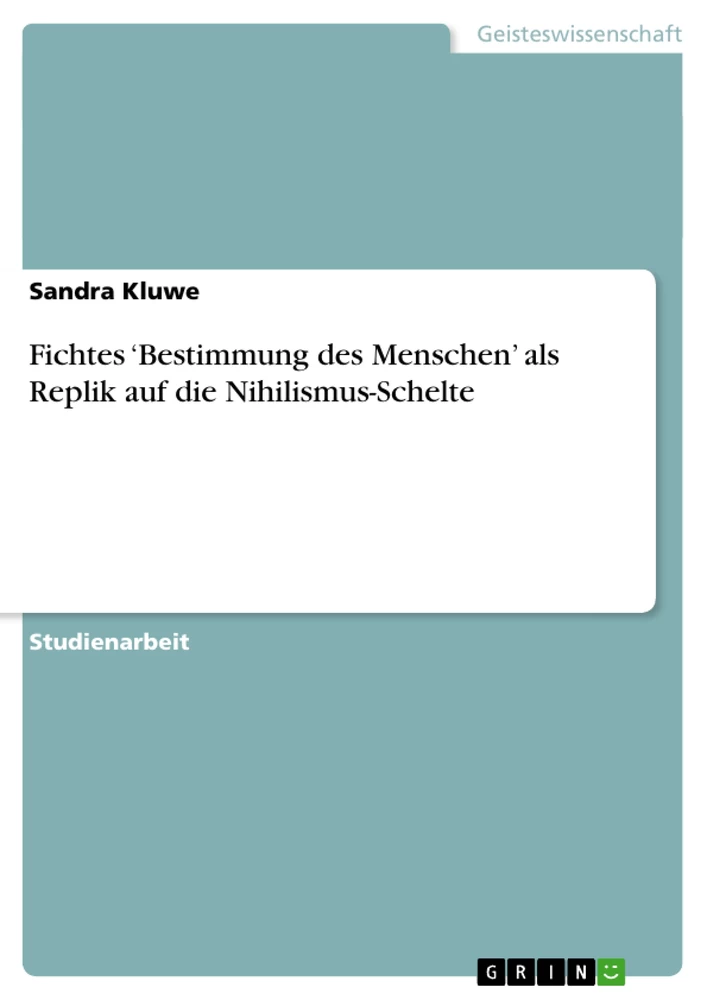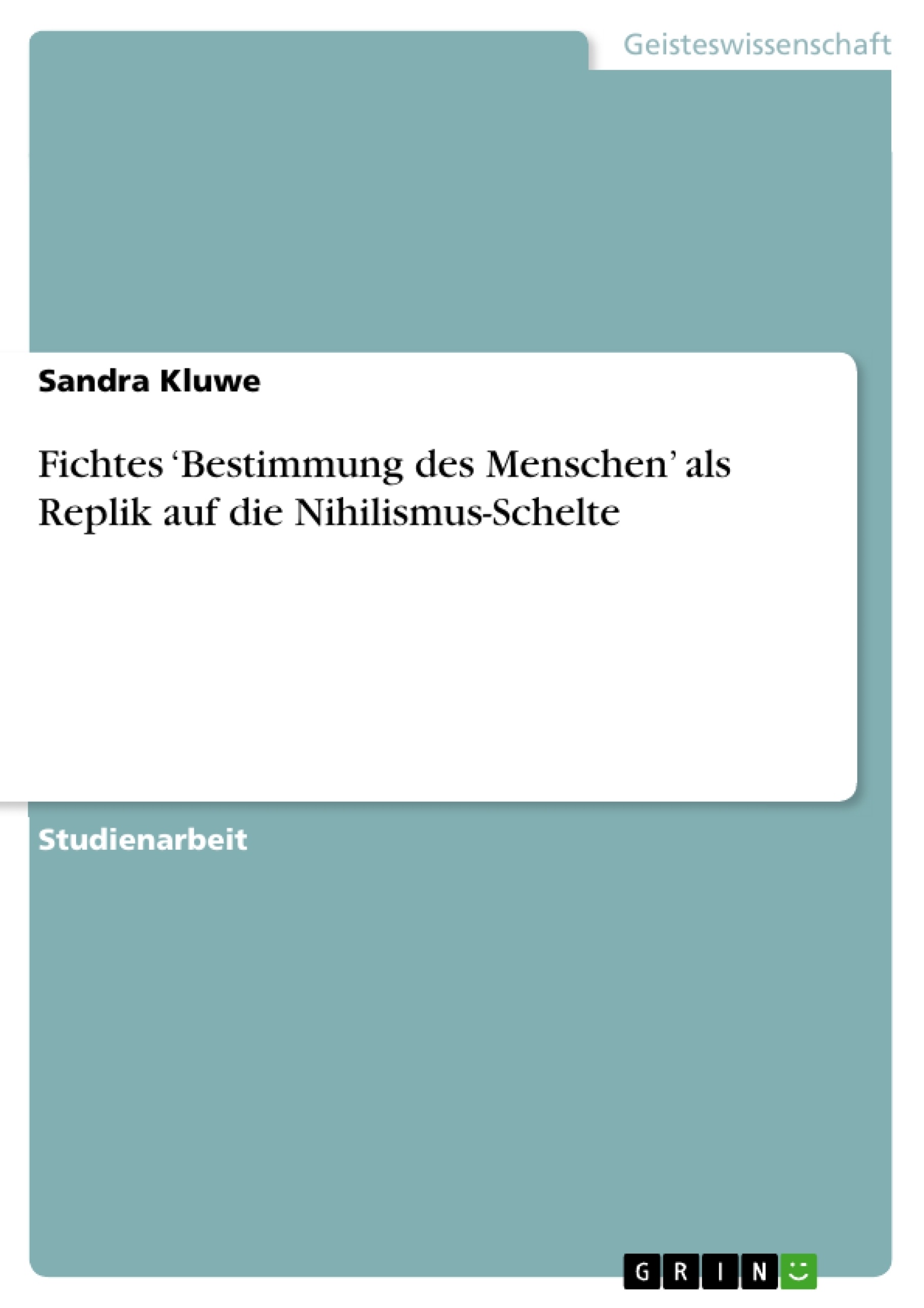Das letzte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ist ein philosophisches Krisenjahrzehnt. In den Jahren 1793 bis 1796 entfaltet Georg Christoph Lichtenberg, der den sprechenden Terminus 'Unphilosophie' prägte, eine Sprach- und Erkenntniskritik, die an Schärfe und Rücksichtslosigkeit gegenüber bisherigen Denkgewohnheiten ihresgleichen sucht. 1798 - die Datierung ist unsicher - schreibt Novalis einen 'Monolog', worin Sprache als "ein bloßes Wortspiel" entlarvt und der "lächerliche Irrthum" demaskiert wird, man spreche "um der Dinge willen". Sprache mache vielmehr, wie die "mathematischen Formeln", eine "Welt für sich" aus, nichts anderes spiegele sich in ihr als "das seltsame Verhältnißspiel der Dinge."
Was hier als problematisch erfahren wird: Ob Sprache "die Dinge" sagen, und zwar wesentlich sagen, ausdrücken könne oder nicht vielmehr ein rein selbstbezügliches System sei, bedenkt das philosophisch äußerst bewegte Jahr 1799 als sowohl ontologisches als auch epistemisches Problem. Das Problem-Bewußtsein hierfür weckte Friedrich Heinrich Jacobi, der in seinem Sendschreiben 'Jacobi an Fichte' (März 1799) dem Autor der 'Wissenschaftslehre' vorwirft, über den von den Dingen vorgeworfenen Anspruch auf Sein mit einem "Machtspruch der Vernunft" hinweggegangen zu sein. Die Nihilismus-Schelte, die Jacobi in diesem Zusammenhang vorbringt, stößt auf breite Resonanz. Jean Paul schreibt im Dezember 1799 eine Satire mit dem Titel 'Clavis Fichteana seu Leibgeberiana', die Jacobi gewidmet ist und auf dessen Sendschreiben beruht. Fichte selbst publizierte im darauffolgenden Jahr seine 'Bestimmung des Menschen', die allerdings schon vorher kursierte, und auf die sich etwa Jean Paul bezogen hatte. In dieser Schrift setzt sich Fichte sowohl mit dem Vorwurf des Atheismus als auch mit der Nihilismus-Schelte auseinander, liefert aber in erster Linie das eine: ein Krisendokument, nämlich das Dokument der in die Krise gestürzten Subjektphilosophie, das Dokument eines selbstkritisch gewordenen Idealismus, das Dokument einer Wahrheitskrise.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Am Abgrund der Moderne
- Hauptteil: Die 'Bestimmung des Menschen' unter dem Vorzeichen der Nihilismus-Schelte
- Erster Teil
- Zum Ersten Grundsatz der Jenenser Wissenschaftslehre
- Zum Satz vom Grund
- Begründungsstruktur ‘absolute Relation’
- Das Sendschreiben Jacobis
- Zweiter Teil
- Zweifel am Satz vom Grund. Zum Ersten Buch
- Am Abgrund des Wissens: Verzweiflung. Zum Zweiten Buch
- Dingliche Wahr-Nehmung als Ichmodifikation
- Fläche und Raum
- Exkurs: Zu Kleists Kant-Krise
- Kants Kritik der Urteilskraft als mögliche Quelle
- Kants Kritik der reinen Vernunft als mögliche Quelle
- Fichtes Bestimmung des Menschen als mögliche Quelle
- Transzendentalphilosophischer Mangel an Sein. Zur Modalitätenfrage I
- Der Nihilismus der Begründungsstruktur
- Begründungsstruktur ‘Synthesis’
- Begründungsstruktur ‘Wechselwirkung’
- Implosion
- Grund - Abgrund
- Ich denke - Es denkt
- Freiheit - Angst
- Bewußtsein - Traumbewußtsein
- Sein - Nichts
- Dingliche Wahr-Nehmung als Ichmodifikation
- Glauben als Letztgrund: Die Bestimmung des Menschen. Zum Dritten Buch
- Zur Modalitätenfrage II
- 'Vernehmende Vernunft' und 'Salto mortale'
- Eschatologischer Vorbehalt? Schlußüberlegungen
- Erster Teil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Fichtes "Bestimmung des Menschen" als Antwort auf Jacobis Nihilismus-Schelte. Sie analysiert Fichtes Philosophie im Kontext der damaligen epistemologischen und ontologischen Krisen. Das Hauptziel ist es, Fichtes Argumentation im Detail zu verstehen und seine Auseinandersetzung mit dem Vorwurf des Nihilismus zu beleuchten.
- Jacobis Nihilismus-Vorwurf gegen Fichte
- Fichtes "Bestimmung des Menschen" als Krisendokument
- Der Satz vom Grund und seine Problematik
- Die Rolle des Glaubens in Fichtes Philosophie
- Die Verbindung zwischen Erkenntnis- und Existenzkrise
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Am Abgrund der Moderne: Die Einleitung beschreibt das späte 18. Jahrhundert als ein Zeitalter philosophischer Krisen, gekennzeichnet durch eine scharfe Kritik an Sprache und Erkenntnis. Sie führt die Schriften von Lichtenberg und Novalis an, um die damaligen Zweifel an der Fähigkeit der Sprache, die Wirklichkeit adäquat widerzuspiegeln, zu illustrieren. Der Briefwechsel zwischen Jacobi und Fichte wird als zentraler Punkt der Krise eingeführt, der die Auseinandersetzung um den Nihilismus und die Grundlagen der Erkenntnis auslöst. Die Einleitung legt den Grundstein für die Untersuchung von Fichtes "Bestimmung des Menschen" als Reaktion auf diese Herausforderungen.
Hauptteil: Die 'Bestimmung des Menschen' unter dem Vorzeichen der Nihilismus-Schelte: Dieser Abschnitt stellt den Rahmen für die Analyse von Fichtes Werk dar. Er beleuchtet die philosophischen und historischen Umstände, die zu der Entstehung von Fichtes Schrift führten. Der Vorwurf des Nihilismus, erhoben von Jacobi, bildet den zentralen Konfliktpunkt, der die gesamte Argumentation von Fichtes Werk strukturiert und dessen Klärung im weiteren Verlauf der Arbeit im Mittelpunkt steht.
Erster Teil: Der erste Teil der Arbeit konzentriert sich auf die Klärung grundlegender Begriffe in Fichtes Philosophie. Er untersucht den Ersten Grundsatz der Jenenser Wissenschaftslehre und beleuchtet das Verhältnis zwischen Grund-Satz und Satz vom Grund. Die Analyse von Heideggers "Der Satz vom Grund" wird einbezogen, um Fichtes Position besser zu verstehen. Schließlich wird die Frage behandelt, inwiefern der Satz vom Grund als abgründig bezeichnet werden kann. Die Untersuchung von Jacobis Nihilismus-Schelte bildet einen zentralen Bestandteil dieses Teils.
Zweiter Teil: Im zweiten Teil wird Jacobis Kritik an Fichtes Philosophie detailliert untersucht, insbesondere die Zweifel am Satz vom Grund. Die Analyse fokussiert sich auf die zentralen Themen von Fichtes "Bestimmung des Menschen", wie Verzweiflung, Dingliche Wahr-Nehmung als Ichmodifikation, und die kritische Auseinandersetzung mit Kant. Der Abschnitt "Der Nihilismus der Begründungsstruktur" stellt ein zentrales Argument dar, indem er verschiedene Aspekte der Begründungsstruktur und ihre potenziellen Implikationen für den Nihilismus beleuchtet. Der Exkurs zu Kleists Kant-Krise beleuchtet die zeitgenössischen Auseinandersetzungen mit Erkenntnistheorie und deren Auswirkungen auf Fichtes Werk.
Schlüsselwörter
Fichte, Bestimmung des Menschen, Nihilismus, Jacobi, Satz vom Grund, Wissenschaftslehre, Erkenntniskrise, Existenzkrise, Idealismus, Grundsatzphilosophie, Transzendentalphilosophie, Glaube.
Häufig gestellte Fragen zu Fichtes "Bestimmung des Menschen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Fichtes "Bestimmung des Menschen" im Kontext der damaligen epistemologischen und ontologischen Krisen, insbesondere im Hinblick auf Jacobis Nihilismus-Schelte. Sie untersucht Fichtes Argumentation detailliert und beleuchtet seine Auseinandersetzung mit dem Vorwurf des Nihilismus.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Jacobis Nihilismus-Vorwurf gegen Fichte, Fichtes "Bestimmung des Menschen" als Krisendokument, den Satz vom Grund und seine Problematik, die Rolle des Glaubens in Fichtes Philosophie und die Verbindung zwischen Erkenntnis- und Existenzkrise. Sie analysiert Fichtes Ersten Grundsatz der Jenenser Wissenschaftslehre, das Verhältnis zwischen Grund-Satz und Satz vom Grund, die Begründungsstruktur, die Modalitätenfrage, die "Vernehmende Vernunft" und den "Salto mortale". Ein Exkurs zu Kleists Kant-Krise beleuchtet die zeitgenössischen Auseinandersetzungen mit der Erkenntnistheorie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in eine Einleitung, einen Hauptteil und eine Zusammenfassung gegliedert. Die Einleitung beschreibt das philosophische Klima des späten 18. Jahrhunderts und den Briefwechsel zwischen Jacobi und Fichte als Ausgangspunkt der Auseinandersetzung. Der Hauptteil analysiert Fichtes "Bestimmung des Menschen" in zwei Teilen, wobei der erste Teil grundlegende Begriffe klärt und der zweite Teil Jacobis Kritik detailliert untersucht. Die Kapitel sind untergliedert und bieten eine detaillierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aspekten von Fichtes Philosophie.
Welche Schlüsselkonzepte werden untersucht?
Schlüsselkonzepte der Arbeit sind der Nihilismus, der Satz vom Grund, die Wissenschaftslehre, die Erkenntniskrise, die Existenzkrise, der Idealismus, die Grundsatzphilosophie, die Transzendentalphilosophie und der Glaube. Die Arbeit analysiert die Begriffe "absolute Relation", "Synthesis", "Wechselwirkung" und "Implosion" im Kontext der Begründungsstruktur. Die zentralen Themen von Fichtes "Bestimmung des Menschen" wie Verzweiflung und die dingliche Wahr-Nehmung als Ichmodifikation werden ebenfalls ausführlich diskutiert.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Fichtes "Bestimmung des Menschen" und den Briefwechsel zwischen Jacobi und Fichte. Sie analysiert auch Heideggers "Der Satz vom Grund" und bezieht sich auf die Schriften von Lichtenberg und Novalis, um das philosophische Klima des späten 18. Jahrhunderts zu beleuchten. Die Arbeit berücksichtigt die Schriften Kants, insbesondere seine Kritik der Urteilskraft und seine Kritik der reinen Vernunft, im Kontext der Auseinandersetzung mit Fichte.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für Fichtes Philosophie, den deutschen Idealismus und die philosophischen Debatten des späten 18. Jahrhunderts interessieren. Sie ist besonders relevant für Studierende der Philosophie und der Geisteswissenschaften, die sich mit Erkenntnistheorie, Ontologie und der Geschichte der Philosophie auseinandersetzen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht Fichtes "Bestimmung des Menschen" als Antwort auf Jacobis Nihilismus-Schelte. Sie analysiert Fichtes Philosophie im Kontext der damaligen epistemologischen und ontologischen Krisen und zielt darauf ab, Fichtes Argumentation im Detail zu verstehen und seine Auseinandersetzung mit dem Vorwurf des Nihilismus zu beleuchten. Die genauen Schlussfolgerungen lassen sich aus dem Text entnehmen.
- Citation du texte
- Sandra Kluwe (Auteur), 1998, Fichtes ‘Bestimmung des Menschen’ als Replik auf die Nihilismus-Schelte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22747