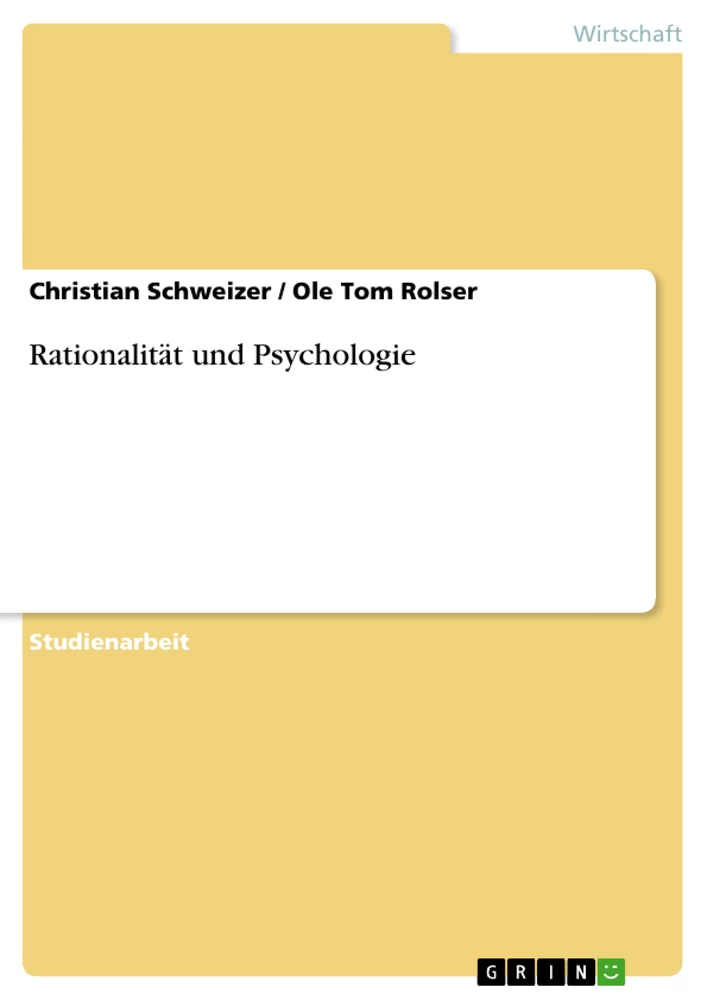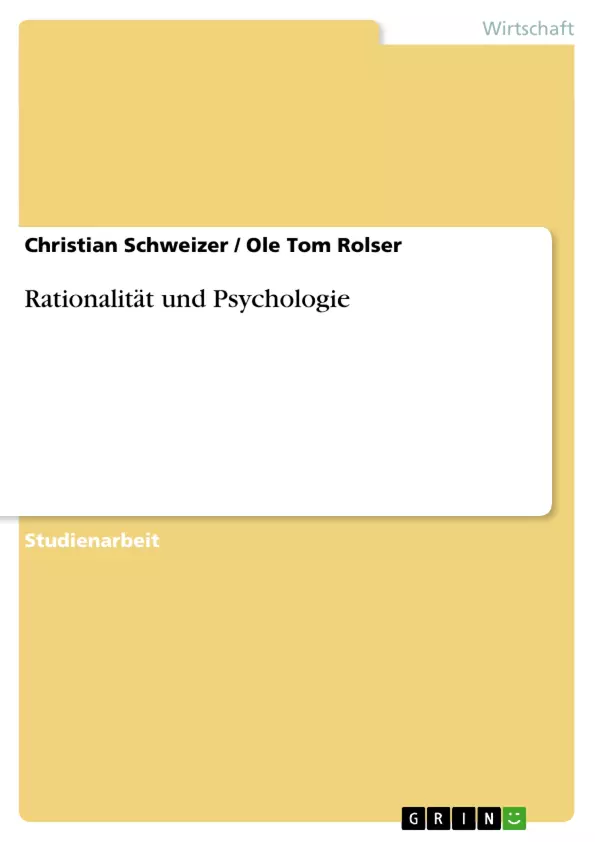Nach einem kurzen Überblick über die Problemstellung und den Aufbau der vorliegenden
Arbeit soll im Folgenden ein Einblick in die bisher weit verbreitete neoklassische
Wirtschaftstheorie gegeben werden. Über die Bedeutung der Psychologie bei der Beschreibung ökonomischen Verhaltens war
man lange Zeit uneins. Die Ansicht, dass die Psychologie menschliche Entscheidungen auch
im wirtschaftswissenschaftlichen Umfeld geeignet zu beschreiben in der Lage ist, gilt
mittlerweile jedoch als fundiert. Auch die immer weiter steigende Zahl von
Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet verdeutlicht dies. So ging der Nobelpreis für
Wirtschaftswissenschaften im Jahr 2002 für eine Arbeit über die Bedeutung der Psychologie
in der ökonomischen Theorie an Daniel Kahnemann und Vernon L. Smith.
Die zugrundeliegende Fragestellung dieses Forschungsgebietes richtet sich auf die
Vorraussetzungen unter welchen Menschen Entscheidungen treffen: bilden rationale und
konsistente Beweggründe die Basis wirtschaftlichen Handelns, oder sind es vielmehr andere
Kriterien, aus denen Entscheidungen abgeleitetet werden.
In der vorliegenden Arbeit soll nun gezeigt werden, dass Menschen nicht ausschließlich
rational nach dem Effizienzkriterium handeln, sondern dass häufig eher die Psychologie in der
Lage ist (wirtschaftliche) Entscheidungen zu beschreiben. Die „Psychologische Wende in der
Ökonomie“, wie einige bekannte Wirtschaftswissenschaftler diese Abkehr vom
neoklassischen Menschenbild nennen, wurde dabei insbesondere durch empirische Arbeiten
wie die der beiden Nobelpreisträger von 2002 vorangetrieben.
In den folgenden beiden Abschnitten dieser Arbeit werden zunächst die Grundannahmen der
neoklassischen Lehre beschrieben, welche im Wesentlichen davon ausgehen, dass
psychologische Faktoren bei der Entscheidungsfindung keinen Einfluss haben, sondern dass
sich wirtschaftliche Akteure durch: “…perfekte Rationalität, uneingeschränkte Willenskraft
und unbeschränktes Streben nach Eigennutz“ (Fehr, 2001, S.29) auszeichnen.
Bei Fragestellungen wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Dimension wurden
diese Annahmen immer wieder unterstellt, und es wurde davon ausgegangen, dass der Mensch, dem ökonomischen Prinzip gemäß, rational handelt und sich nach diesem
Verhaltensmodell als „Homo Oeconomicus“ eigennutzmaximierend verhält. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines und Überblick
- Von der Klassik zur Neoklassik
- Der Homo Oeconomicus
- Die Psychologische Wende in der Ökonomie
- Beschränkte Rationalität
- Eingeschränkte Willenskraft
- Beschränkter Eigennutz
- Was Menschen bei Entscheidungen beeinflusst
- Verschiedenartige Anreize
- Emotionen
- Das soziale Umfeld
- Resumeé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit „Rationalität und Psychologie“ befasst sich mit der Frage, wie die Psychologie menschliche Entscheidungen im wirtschaftlichen Kontext beeinflusst. Sie stellt die traditionelle neoklassische Wirtschaftstheorie mit ihrem Konzept des „Homo Oeconomicus“ in Frage, der rationale Entscheidungen aufgrund des Strebens nach Eigennutz trifft. Die Arbeit untersucht, inwiefern empirische Ergebnisse aus der Psychologie den Einfluss von Faktoren wie beschränkter Rationalität, eingeschränkter Willenskraft und sozialem Umfeld auf das wirtschaftliche Verhalten belegen.
- Die Grenzen des „Homo Oeconomicus“
- Die Bedeutung von Psychologie in der Ökonomie
- Einflussfaktoren auf menschliche Entscheidungen
- Die „Psychologische Wende“ in der Wirtschaftstheorie
- Empirische Erkenntnisse und ihre Auswirkungen auf die ökonomische Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung bietet einen Überblick über die Problemstellung der Seminararbeit und die Relevanz der Psychologie in der Ökonomie. Sie stellt die neoklassische Wirtschaftstheorie vor, die von der rationalen Entscheidungsfindung des „Homo Oeconomicus“ ausgeht, und zeigt, wie empirische Forschung die Grenzen dieser Annahme aufzeigt.
Von der Klassik zur Neoklassik
Dieser Abschnitt beschreibt die Entwicklung der Wirtschaftstheorie von der klassischen Ökonomie zur neoklassischen Theorie. Während die klassische Ökonomie psychologische Faktoren berücksichtigte, fokussierte die Neoklassik auf objektiv messbare Größen und entwickelte das Konzept des „Homo Oeconomicus“.
Der Homo Oeconomicus
In diesem Abschnitt wird das Konzept des „Homo Oeconomicus“ genauer betrachtet. Es wird die Vorstellung von einem rational handelnden Individuum mit festen Präferenzen und dem Streben nach Eigennutz erläutert. Die Arbeit diskutiert auch die Beschränkungen dieses Modells, die durch empirische Erkenntnisse aus der Psychologie aufgezeigt werden.
Die Psychologische Wende in der Ökonomie
Dieser Abschnitt befasst sich mit der „Psychologischen Wende“ in der Wirtschaftstheorie, die durch empirische Studien und Experimente vorangetrieben wurde. Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der „Psychologischen Wende“, wie z.B. die beschränkte Rationalität, die eingeschränkte Willenskraft und den beschränkten Eigennutz des Menschen.
Was Menschen bei Entscheidungen beeinflusst
Dieser Abschnitt beleuchtet die verschiedenen Faktoren, die menschliche Entscheidungen beeinflussen, wie z.B. Anreize, Emotionen und das soziale Umfeld. Die Arbeit untersucht, wie diese Faktoren die Annahmen des „Homo Oeconomicus“ in Frage stellen und zu einer komplexeren Sicht auf das wirtschaftliche Verhalten führen.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit „Rationalität und Psychologie“ konzentriert sich auf die Bereiche Verhaltensökonomie, Psychologie, neoklassische Wirtschaftstheorie, „Homo Oeconomicus“, beschränkte Rationalität, eingeschränkte Willenskraft, sozialer Einfluss, empirische Forschung und die „Psychologische Wende“ in der Ökonomie. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen psychologischer Faktoren auf wirtschaftliche Entscheidungen und zeigt, wie diese Erkenntnisse das Verständnis von Marktprozessen und politischem Handeln erweitern können.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept des "Homo Oeconomicus"?
Der Homo Oeconomicus ist ein theoretisches Modell eines Menschen, der rein rational handelt, seinen eigenen Nutzen maximiert und über perfekte Informationen verfügt.
Was bedeutet "beschränkte Rationalität"?
Beschränkte Rationalität erkennt an, dass Menschen aufgrund begrenzter Zeit, Information und kognitiver Kapazität oft nur "gut genug" entscheiden, statt mathematisch optimal.
Welche Rolle spielen Emotionen bei wirtschaftlichen Entscheidungen?
Emotionen können rationale Kalkulationen überlagern und führen dazu, dass Entscheidungen impulsiv oder aufgrund von sozialen Bindungen getroffen werden.
Was versteht man unter der "Psychologischen Wende" in der Ökonomie?
Es ist die Abkehr vom rein mathematischen Neoklassik-Modell hin zur Verhaltensökonomie, die psychologische Erkenntnisse nutzt, um reales Marktverhalten zu erklären.
Warum erhielten Kahneman und Smith den Nobelpreis?
Sie wurden 2002 für ihre Pionierarbeit ausgezeichnet, die zeigte, wie menschliche Urteilsmechanismen unter Unsicherheit von den Regeln der klassischen Rationalität abweichen.
- Quote paper
- Christian Schweizer (Author), Ole Tom Rolser (Author), 2004, Rationalität und Psychologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22769