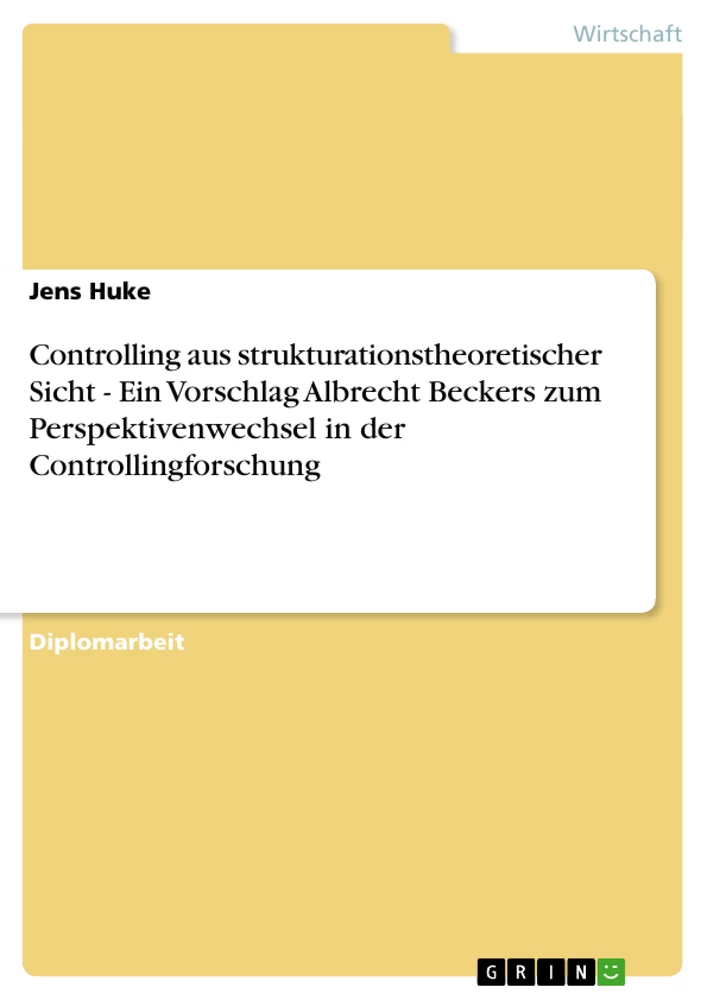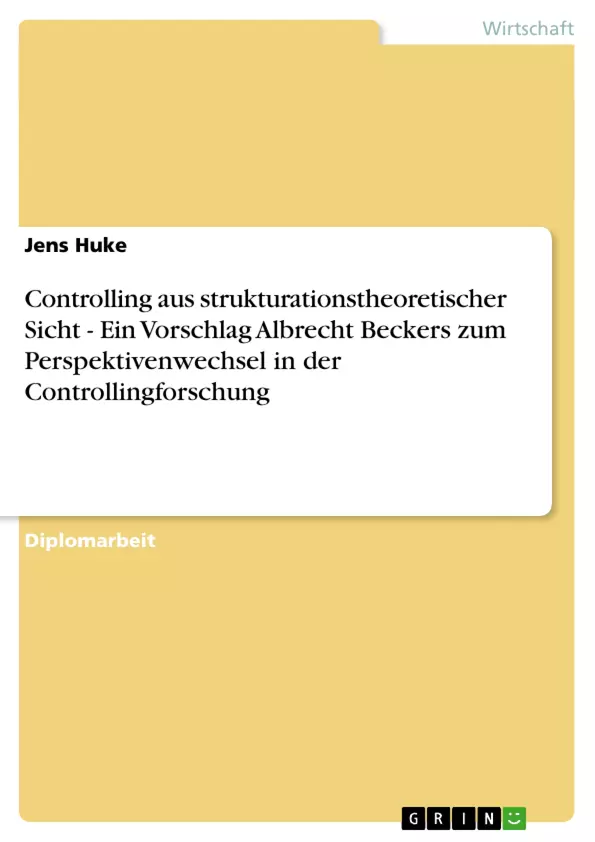Eine anfängliche Modeerscheinung hat sich etabliert: Controlling ist heute ein fester Bestandteil der Unternehmensführung. Dies ist das Ergebnis der rasanten Entwicklung, die das Controlling in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts vollzogen hat. Zunächst waren es vornehmlich große Unternehmen, die Controllingabteilungen einrichteten. Heute ist Controlling auch in kleinen und mittleren Betrieben keine Seltenheit mehr. Sogar nicht erwerbswirtschaftliche Organisationen, wie etwa öffentliche Verwaltungen, Krankenhäuser, Universitäten, die Bundeswehr etc., bedienen sich zunehmend eines Controllings. Mit der wachsenden Bedeutung des Controllings in der betrieblichen Praxis stieg auch das wissenschaftliche Interesse am Phänomen Controlling. Als Indiz für die wissenschaftliche Relevanz des Controllings seien die vermehrte Einrichtung von Controllinglehrstühlen an Hochschulen sowie die wachsende Anzahl controllingspezifischer Publikationen genannt. Auch wenn Controlling in der betrieblichen Praxis als etabliert gelten kann, fehlt ein einheitliches Controllingkonzept. Empirische Untersuchungen zeigen sogar, dass die Aufgaben, die Controller in der betrieblichen Praxis übernehmen, stark differieren. Eine eindeutige Schwerpunktbildung ist in der betrieblichen Praxis kaum erkennbar. Ein einheitliches Controllingkonzept zu entwickeln, um die betriebliche Praxis nach diesen Vorstellungen zu gestalten, ist seit langem ein Ziel zahlreicher Wissenschaftler in der Controllingforschung. Der koordinationsorientierte Controllingansatz, der auf Horváth zurückgeht, schien hier lange Zeit den Weg zu weisen. Aufgrund seiner Bedeutung und Verbreitung darf die Forschung, die sich auf den Koordinationsgedanken stützt, als „traditionelle“ Controllingforschung bezeichnet werden. In der jüngsten Vergangenheit wurden neben den „traditionellen“, koordinationsorientierten Controllingkonzepten „neue“ Ansätze in der Controllingforschung entwickelt (Abschnitt 2.2). Zu diesen „neuen“ Ansätzen gehört auch das strukturationstheoretische Konzept von Albrecht Becker.
Diesen Ansatz von Becker gilt es im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit näher zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse des gegenwärtigen Controllingverständnisses
- Zielsetzungen wissenschaftlichen Arbeitens
- Systematisierung der Controllingkonzepte
- Die koordinationsorientierten Ansätze
- Der rationalitätssicherungsorientierte Ansatz
- Zusammenfassung
- Kritische Betrachtung der Controllingkonzepte
- Begründung des Controllings
- Controlling im klassischen Managementkonzept
- Kritische Betrachtung des klassischen Managementkonzeptes
- Koordination als Aufgabe des Controllings?
- Anforderungen an ein konsistentes Controllingkonzept
- Die Theorie der Strukturierung als organisationstheoretische Basis
- Das Konzept des Handelnden und des Handelns
- Das Konzept der Dualität von Struktur
- Die Modalitäten im Konzept der Dualität von Struktur
- Controlling als reflexive Steuerung
- Organisationen und Unternehmen als besondere soziale Systeme
- Der Controllingbegriff aus strukturationstheoretischer Perspektive
- Das Controllingkonzept von Becker im Modell der Dualität von Struktur
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Controlling aus strukturationstheoretischer Sicht und stellt den Vorschlag von Albrecht Becker zum Perspektivenwechsel in der Controllingforschung dar. Ziel ist es, die traditionellen Controllingkonzepte kritisch zu beleuchten und ein neues, auf der Theorie der Strukturierung basierendes Konzept vorzustellen. Der Fokus liegt auf der Analyse des Handelns in Organisationen und der Rolle des Controllings als reflexive Steuerung.
- Kritik an traditionellen Controllingkonzepten
- Die Theorie der Strukturierung als Grundlage für ein neues Controllingverständnis
- Controlling als reflexive Steuerung in Organisationen
- Das Controllingkonzept von Albrecht Becker
- Die Modalitäten der Strukturation im Controlling
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung und Entwicklung des Controllings in der betrieblichen Praxis beleuchtet. Anschließend wird das gegenwärtige Controllingverständnis analysiert, wobei die verschiedenen Controllingkonzepte systematisiert und kritisch betrachtet werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Koordinationsorientierung und dem klassischen Managementkonzept. Die Arbeit stellt die Theorie der Strukturierung als organisationstheoretische Basis vor und erläutert die Konzepte des Handelnden, der Dualität von Struktur und der Modalitäten der Strukturation. Schließlich wird das Controlling aus strukturationstheoretischer Perspektive betrachtet und das Controllingkonzept von Becker vorgestellt, das auf der Dualität von Struktur basiert. Die Arbeit zeigt, wie Controlling als reflexive Steuerung in Organisationen fungieren kann und welche Bedeutung die Modalitäten der Strukturation für das Controlling haben.
Schlüsselwörter
Controlling, Strukturationstheorie, reflexive Steuerung, Koordinationsorientierung, rationalitätssicherungsorientierter Ansatz, Dualität von Struktur, Modalitäten der Strukturation, Handlungstheorie, Organisation, Unternehmen, soziales System, Albrecht Becker
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Albrecht Beckers strukturationstheoretischem Controlling-Konzept?
Becker schlägt einen Perspektivenwechsel vor, bei dem Controlling als „reflexive Steuerung“ betrachtet wird, basierend auf der Theorie der Strukturierung (Giddens).
Wie unterscheidet sich dieser Ansatz vom koordinationsorientierten Controlling?
Während traditionelle Ansätze (z.B. nach Horváth) die Koordination fokussieren, betont Becker die Dualität von Struktur und das soziale Handeln innerhalb der Organisation.
Was bedeutet „Dualität von Struktur“ im Controlling?
Es beschreibt, dass Strukturen (Regeln und Ressourcen) sowohl das Medium als auch das Ergebnis des Handelns von Akteuren (z.B. Controllern und Managern) sind.
Warum wird Controlling als „reflexive Steuerung“ bezeichnet?
Weil es nicht nur Informationen liefert, sondern die organisatorischen Strukturen und das Handeln der Akteure kontinuierlich beobachtet und rückwirkend beeinflusst.
Welche Rolle spielen Modalitäten im Konzept von Becker?
Modalitäten dienen als Verbindungselemente zwischen dem Handeln der Individuen und den übergeordneten Strukturen der Organisation im Controlling-Prozess.
- Arbeit zitieren
- Jens Huke (Autor:in), 2003, Controlling aus strukturationstheoretischer Sicht - Ein Vorschlag Albrecht Beckers zum Perspektivenwechsel in der Controllingforschung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22790