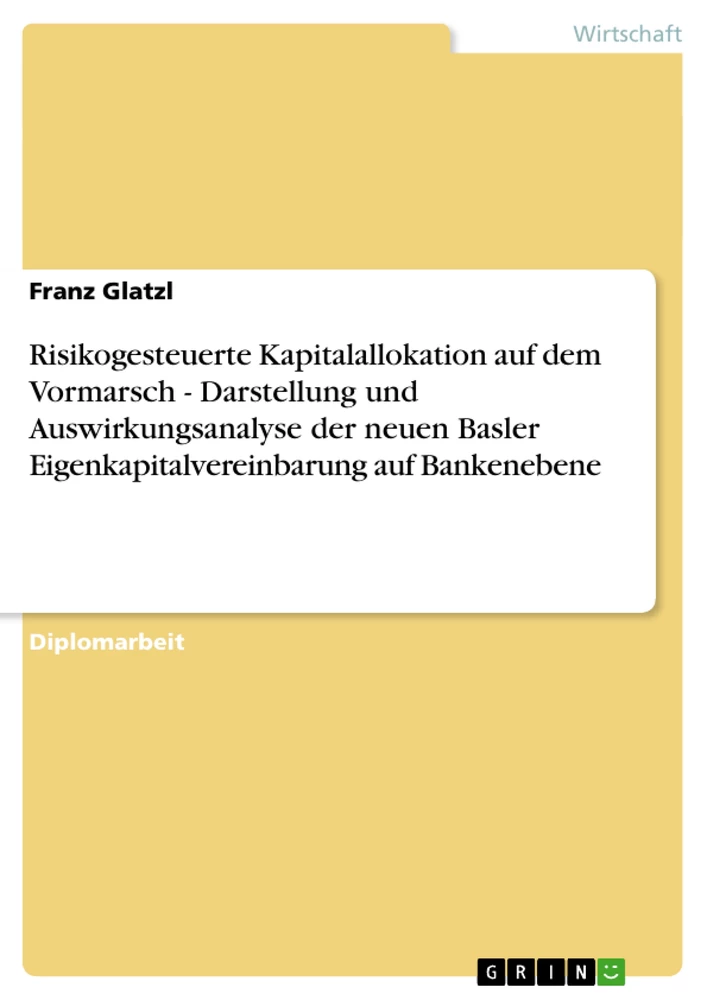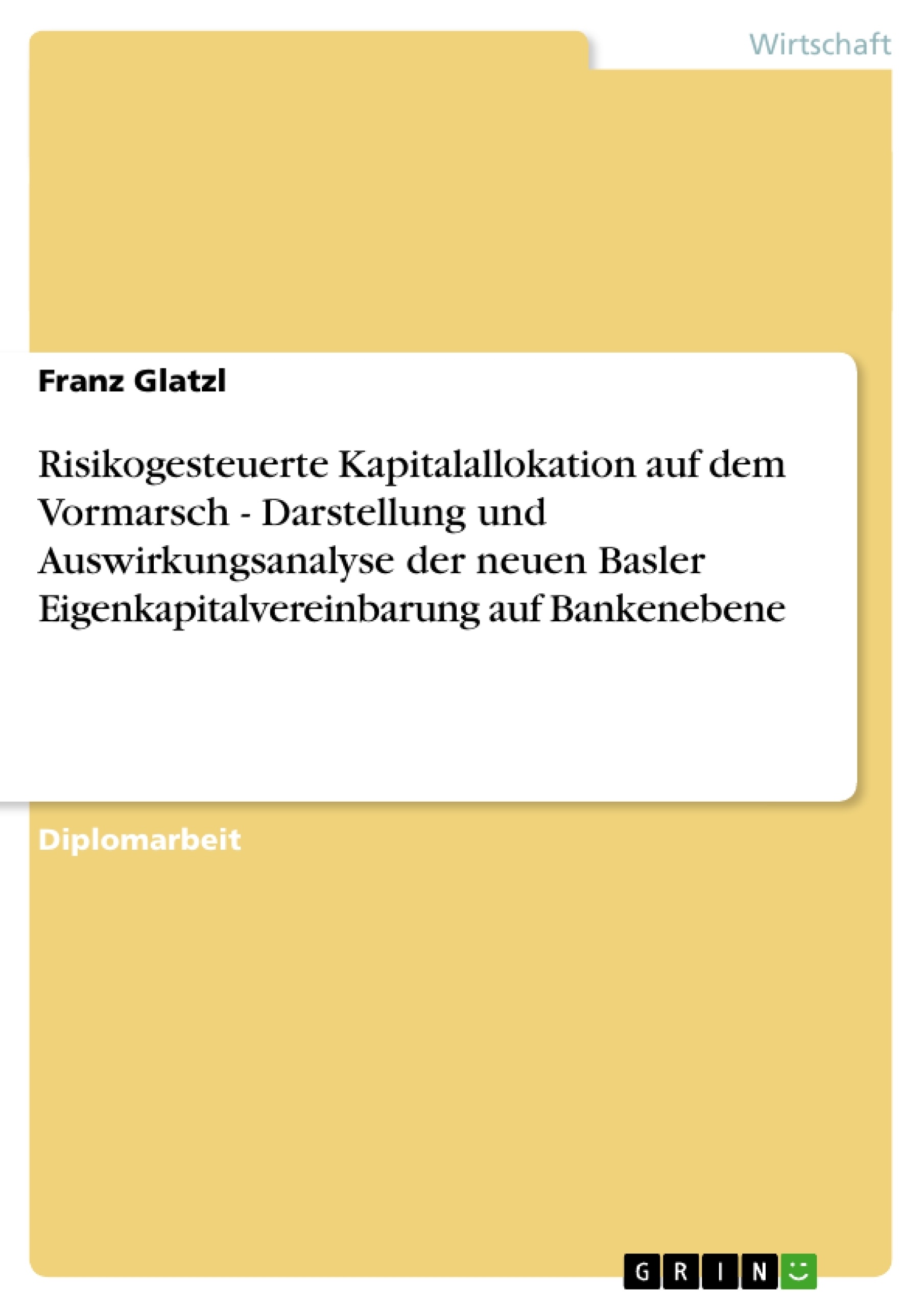Die modernen Wirtschaftwissenschaften befassen sich mit einem sehr breiten Spektrum unterschiedlichster Themengebiete. Auf den ersten Blick haben viele ihrer Forschungsdisziplinen kaum bis nichts mehr miteinander gemein. Im Gegenteil, Anhänger unterschiedlicher Wissenschaftsbereiche arbeiten völlig unabhängig an Optimalitätslösungen ausgewählter Problemstellungen. Versucht man nun in diesem Begriffsdschungel internationaler Handelsbeziehungen, Managementsysteme, Kostenanalysen, Marketingtricks usw. irgendwie den Weg zurück zur Basis all dessen zu finden, so wird man sich über kurz oder lang bei der einfachsten wirtschaftlichen Interaktion zweier Wirtschaftssubjekte wieder finden. Dem Tausch.
Erweitert man einen einfachen Tausch nun gedanklich um ein allgemeines Tauschmedium, sprich Kapital 1 , und nimmt man ferner an, dass eine Tauschpartei kein Kapital hat und nichtsdestotrotz an einem Handel interessiert ist, so sind wir bereits mitten in der Thematik der vorliegenden Diplomarbeit gelandet. Der einfache Tausch wird zu einem Geschäft unter Unsicherheit, da die Vertragserfüllung beider Seiten nicht mehr zeitgleich erfolgt. Aus dem einst sicheren Geschäft wurde ein Kreditgeschäft. D.h., dass die umgehend erfüllende Partei risikobelastet, die in Verzug verbliebene jedoch entlastet wird. Risiko spiegelt in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit der Nichterfüllung des Geschäfts durch die kreditnehmende Partei wider.
Gedanklich kann man sich eine derartige Situation nicht nur in einfacher, sondern in tausendfacher Ausführung vorstellen. Das letzte Gedankenspiel kreiert einen einzelnen Akteur, der Tauschwillige mit und ohne Kapital zueinander führt und so einen Ausgleich möglicher divergierender Interessen sowie eine Minimierung gegebener Informationskosten einführt. Damit ist der organisierte Markt für Kreditvergaben und die Haupttätigkeit einer Bank geboren.
Die Thematik dieser Arbeit bewegt sich also grundsätzlich um den Themenkreis der Kreditvergabe unter Unsicherheit, deren derzeitige und zukünftige Regulierung und die Auswirkungen künftiger Regelungen auf Bankenebene. Damit befindet sich der Leser am Puls der Wirtschaftswissenschaften.
Inhaltsverzeichnis
- A) Standortbestimmung dieser Arbeit.
- a. Thematik
- b. Ziel dieser Arbeit.
- B) Einführung.
- 1. Basel II in Grundzügen.
- 1.1. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht.
- 1.2. Von Basel I nach Basel II
- 1.2.1. Der Basler Akkord von 1988
- 1.2.2. Revisionsbeginn des Akkordes von 1988
- 1.3. Zeitrahmen der Umsetzung
- 1.4. Ziele von Basel II.
- 2. Struktur von Basel II.
- 2.1. Das Drei-Säulen-Modell
- 2.2. Die erste Säule „Mindestkapitalerfordernis“
- 2.2.1. Das Kreditrisiko.
- 2.2.1.1. Risikobegrifflichkeiten im Kreditgeschäft.
- 2.2.1.2. Der Standardansatz...
- 2.2.1.2.1. Forderungen an Staaten und sonstige öffentliche Stellen.
- 2.2.1.2.2. Forderungen an Banken, Wertpapierhäuser und multilaterale Entwicklungsbanken
- 2.2.1.2.3. Forderungen an Unternehmen
- 2.2.1.2.4. Weitere wichtige Bestimmungen..
- 2.2.1.3. Der IRB-Basisansatz.
- 2.2.1.3.1. Mindestanforderungen des IRB-Ansatzes.
- 2.2.1.3.2. Berechnungsformeln des IRB-Ansatzes.
- 2.2.1.4. Der fortgeschrittene IRB-Ansatz.
- 2.2.2. Das Marktrisiko
- 2.2.3. Das Operationelle Risiko
- 2.2.3.1. Der Basisindikatorenansatz.
- 2.2.3.2. Der Standardansatz...
- 2.2.3.3. Ambitionierte Messansätze (AMA).
- 2.2.1. Das Kreditrisiko.
- 2.3. Die zweite Säule „Aufsichtliches Überprüfungsverfahren“.
- 2.4. Die dritte Säule „Marktdisziplin“
- 3. Kreditwürdigkeitsprüfung - Rating...
- 3.1. Teilgebiete des Ratings.
- 3.2. Aktueller Anspruch
- 3.3. Externe Ratings nach Basel II
- 3.3.1. Relevante Regelungen
- 3.3.2. Ratingagenturen ...
- 3.3.2.1. Ratingmarkt externer Agenturen..
- 3.3.2.2. Vergleichbarkeit externer Agenturen ..
- 3.4. Interne Ratings nach Basel II
- 3.4.1. Relevante Regelungen
- 3.5. Kriterien und Methodik......
- 3.5.1. Traditionelle Unternehmensanalyse..
- 3.5.1.1. Quantitative Faktoren (hard facts)..
- 3.5.1.1.1. Quantitative Kritikpunkte...
- 3.5.1.1.2. Kritische Würdigung (quantitativ)...
- 3.5.1.2. Qualitative Faktoren (soft facts)...
- 3.5.1.2.1. Kritische Würdigung (qualitativ)..
- 3.5.1.1. Quantitative Faktoren (hard facts)..
- 3.5.2. Traditionelle Privatpersonenanalyse...
- 3.5.3. Weiterführende Methoden
- 3.5.3.1. Diskriminanzanalyse.
- 3.5.3.2. Expertensysteme
- 3.5.3.3. Neuronale Netze.
- 3.5.3.4. Kreditratingsysteme (Scoring)
- 3.5.1. Traditionelle Unternehmensanalyse..
- 3.6. Sicherheitenanerkennung……………………………………….
- 3.6.1. Der Einfache Ansatz
- 3.6.2. Der Umfassende Ansatz..
- 3.6.3. Weitere Absicherungsmöglichkeiten..
- 4. Auswirkungen auf Kreditinstitute.…….......
- 4.1. Rückblick: Auswirkungen von Basel 1
- 4.2. Rechtlicher Rahmen
- 4.3. Quantitative Impact Studies (QIS)......
- 4.3.1. Zielsetzung und Auswertung der QIS.
- 4.3.2. Die QIS-Studien 2 und 2.5.
- 4.3.3. Schlussfolgerungen der QIS 3 Studie (weltweit).
- 4.3.4. Spezialbetrachtung QIS 3 Österreich..
- 4.4. Weitere ausgewählte Implikationen.
- 4.4.1. Auswirkung auf die österreichische Makroökonomie...
- 4.4.2. Auswirkung auf die Finanzierungskonditionen.
- 4.4.3. Kritik an den Bonitätsgewichten des Standardansatzes
- 4.4.4. Kritik an der IRB-Berechnungsformel.....
- 4.4.5. Wirkt Basel II prozyklisch?.
- 4.4.5.1. Prozyklizität und „,Credit Crunch“.
- 4.4.5.2. Rating Through The Cycle..
- 4.4.5.3. Diskussion weiterer Einflussfaktoren zur Prozyklizität
- 4.5. Spezialfall der Verbriefungen..
- 4.5.1. Steigende Bedeutung im Finanzmarkt.
- 4.5.2. Aufbau einer Verbriefung.
- 4.5.3. Wirkung und Neuregelung von Verbriefungen..
- 4.6. Besondere Herausforderungen.
- 4.6.1. Die Wahl der externen Agentur im Standardansatz.
- 4.6.2. Ausbau des internen Ratingsystems.
- 4.6.3. Messung des operationellen Risikos.
- 5. Ausblick und Schlusswort.
- 1. Basel II in Grundzügen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung, Basel II, und analysiert deren Auswirkungen auf das Kreditgeschäft von Banken. Ziel der Arbeit ist es, die Funktionsweise von Basel II darzustellen, die Auswirkungen auf Kreditinstitute zu beleuchten und die Bedeutung des Ratingprozesses im Kontext von Basel II zu untersuchen.
- Die Struktur von Basel II und das Drei-Säulen-Modell
- Die Bedeutung des Kreditrisikos und die verschiedenen Ansätze zur Risikobewertung
- Die Rolle von Ratingagenturen und internen Ratingsystemen
- Quantitative Auswirkungen von Basel II auf das Kreditgeschäft
- Spezialfälle wie Verbriefungen und die Herausforderungen für Kreditinstitute
Zusammenfassung der Kapitel
- A) Standortbestimmung dieser Arbeit.
- a. Thematik. Diese Sektion stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert den aktuellen Stand der Forschung.
- b. Ziel dieser Arbeit. Die Zielsetzung der Arbeit wird dargelegt.
- B) Einführung.
- 1. Basel II in Grundzügen. Diese Sektion bietet eine grundlegende Einführung in Basel II, einschließlich der Entstehung, der Ziele und der Struktur des Akkords.
- 2. Struktur von Basel II. Dieses Kapitel erläutert das Drei-Säulen-Modell von Basel II und beschreibt die einzelnen Säulen im Detail.
- 3. Kreditwürdigkeitsprüfung - Rating... Dieses Kapitel behandelt das Rating von Kreditnehmern im Kontext von Basel II. Es werden sowohl externe als auch interne Ratingsysteme und deren Bedeutung für Banken erläutert.
- 4. Auswirkungen auf Kreditinstitute. Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen von Basel II auf die Kreditinstitute. Es werden quantitative Impact Studies (QIS) und andere relevante Implikationen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselwörter: Basel II, Eigenkapitalvereinbarung, Bankenaufsicht, Kreditrisiko, Marktrisiko, Operationelles Risiko, Rating, Ratingagenturen, interne Ratingsysteme, Quantitative Impact Studies (QIS), Verbriefungen, Kreditgeschäft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Basel II?
Ziel ist eine angemessene Eigenkapitalausstattung von Banken, die stärker am tatsächlichen Risiko der Kreditvergabe orientiert ist, um die Stabilität des Finanzsystems zu erhöhen.
Was umfasst das Drei-Säulen-Modell von Basel II?
Säule 1: Mindestkapitalanforderungen, Säule 2: Bankaufsichtlicher Überprüfungsprozess, Säule 3: Marktdisziplin durch Offenlegungspflichten.
Was ist der Unterschied zwischen Standardansatz und IRB-Ansatz?
Im Standardansatz werden externe Ratings genutzt, während der IRB-Ansatz (Internal Ratings Based) es Banken erlaubt, eigene Risikoschätzungen zur Kapitalberechnung zu verwenden.
Was versteht man unter „Operationellem Risiko“?
Es bezeichnet die Gefahr von Verlusten durch menschliches Versagen, Systemfehler, unzureichende interne Prozesse oder externe Ereignisse.
Führt Basel II zu einem „Credit Crunch“?
Die Arbeit diskutiert, ob die strengeren Regeln die Kreditvergabe an risikoreichere Unternehmen (z.B. KMU) einschränken könnten (Prozyklizität).
- Citar trabajo
- Franz Glatzl (Autor), 2004, Risikogesteuerte Kapitalallokation auf dem Vormarsch - Darstellung und Auswirkungsanalyse der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung auf Bankenebene, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22793