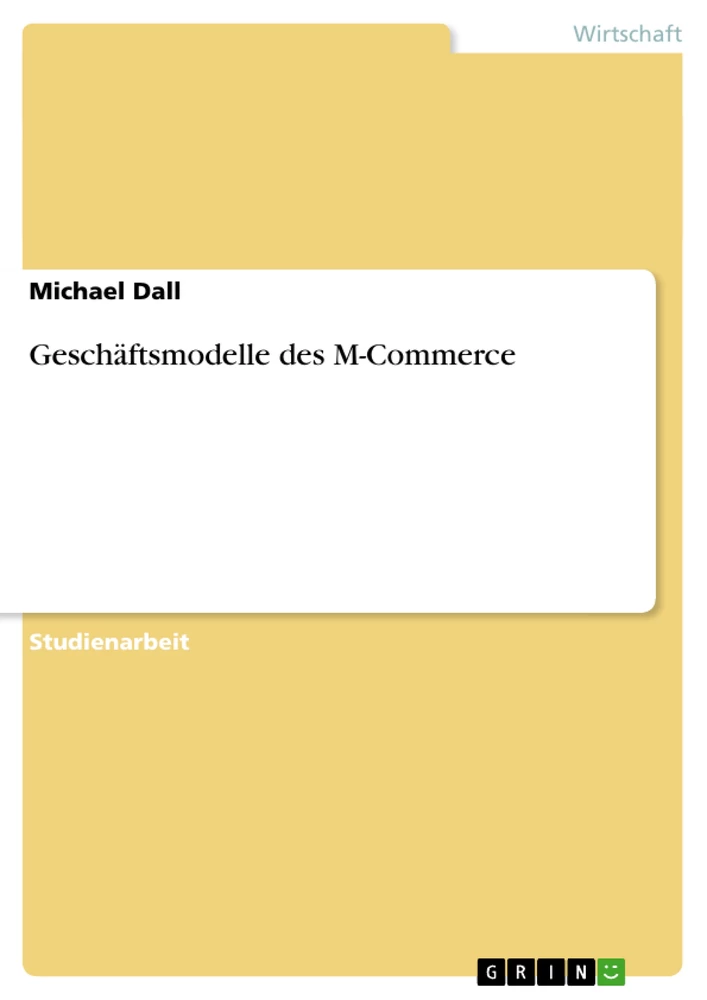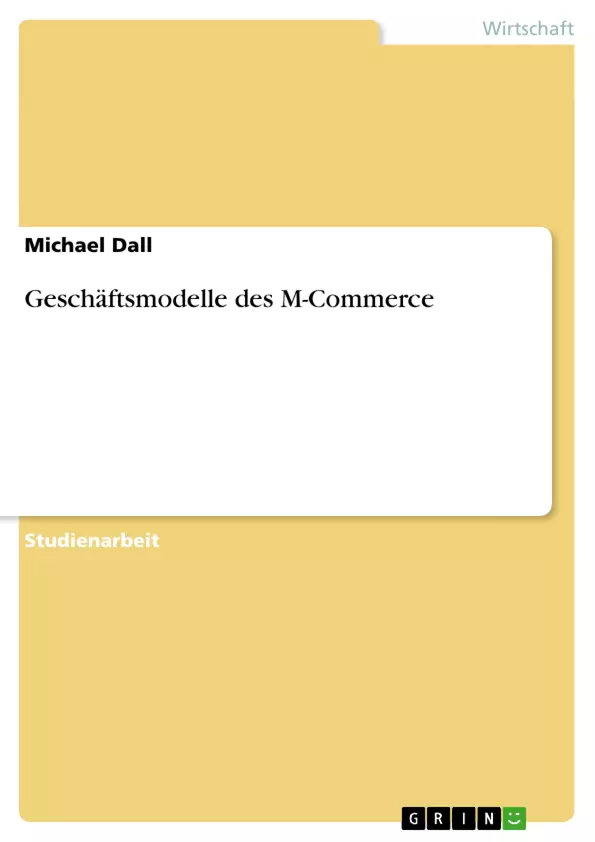Es gab in letzter Zeit viele Diskussionen um den enormen Preis der Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) - Lizenzen, der, wie ich meine, zeigt, dass sich die Netzbetreiber ein enormes Potential auf dem Gebiet des M - Business versprechen. Nach Schätzungen von Durlacher Research sollte der europäische Markt für M - Business im Zeitraum von 1999 bis 2003 von 323 Millionen Euro auf 23,6 Billionen Euro ansteigen, wobei im Bereich Werbung die höchsten Gewinne erzielt werden sollen 1 . Diese Einschätzung zeigt die hohen Erwartungen im Bereich des M - Business. Ob diese Erwartungen gerechtfertig sind, werde ich versuchen, im Rahmen dieser Arbeit zu beantworten.
In Anbetracht der hohen Kosten für Lizenzgebühren werden die Netzbetreiber nach geeigneten Geschäftsmodellen suchen müssen, um sich möglichst schnell über eine kritische Masse an Kunden zu refinanzieren 2 .
Anders als im E - Business, wo die Benutzung von Internet Diensten und Inhalten im Wesentlichen zur freien Verfügung steht, gehen Experten davon aus, dass die Dienstleistungen im M - Business Bereich für den Anwender kostenpflichtig sein werden 3 . Es gilt also, Geschäftsmodelle zu finden, die schnell eine kritische Masse an Nutzern aufbauen, es aber trotzdem ermöglichen, einen gewissen Preis dafür vom Kunden zu verlangen. Als erste Voraussetzung, um eine kritische Masse zu erreichen, ist, dass die Technik ausgereift sein muss, d.h. die Bandbreite muss groß genug sein, um Bilder und Daten zügig zu übertragen. Außerdem müssen die mobilen Endgeräte bedienungsfreundlich zu handhaben sein (Convenience Aspekt), ansonsten werden viele potentielle Kunden der „neuen“ Technik den Rücken kehren. Um die Zahlungsbereitschaft beim Kunden zu wecken, ist es nötig, einen echten „Mehrwert“ beim Kunden zu generieren 4 . Dieser Mehrwert kann völlig unterschiedliche Ausprägungen haben, z.B. kann der Kunde beim M - Business zeit-und ortsunabhängig auf bestimmte Informationen und Dienste zugreifen, Wartezeiten können besser genutzt werden, indem per E - Mail geschäftliche Dinge geklärt werden, oder für den „Privatmann“ können Wartezeiten durch viele verschiedene Unterhaltungsangebote angenehmer gestaltet werden. Für solche Dienstleistungen, welche die Lebensqualität des Nutzers nachhaltig verbessern, wird der Kunde am Wahrscheinlichsten bereit sein zu bezahlen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Geschäftsmodelle.
- 3. Begriffsabgrenzungen M - Commerce.
- 4. Arten von Geschäftsmodellen
- 4.1 Business to Consumer (B2C) ..
- 4.2 Business to Business (B2B) ..
- 4.3 Business to Employee (B2E)...
- 4.4 Consumer to Consumer (C2C).
- 4.5 Device to Device (D2D) ..
- 5. Praxisbeispiele..
- 5.1 12snap......
- 5.2 @Road...
- 6. Zukunftsaussichten und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Potenzial des M - Business, insbesondere in Bezug auf Geschäftsmodelle. Im Vordergrund steht die Frage, welche Geschäftsmodelle geeignet sind, um die hohen Kosten für UMTS-Lizenzen zu refinanzieren und eine kritische Masse an Kunden zu gewinnen. Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Arten von Geschäftsmodellen im M - Commerce und analysiert, welche Voraussetzungen für ein erfolgreiches M - Business Modell notwendig sind.
- Definition und Abgrenzung von Geschäftsmodellen im M - Commerce
- Arten von Geschäftsmodellen im M - Commerce: B2C, B2B, B2E, C2C, D2D
- Erfolgsfaktoren für M - Commerce Geschäftsmodelle
- Praxisbeispiele für M - Commerce Geschäftsmodelle
- Zukunftsaussichten und Fazit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema M - Business und die Bedeutung von Geschäftsmodellen im Kontext der hohen UMTS-Lizenzkosten dar.
- Kapitel 2: Definition Geschäftsmodelle: In diesem Kapitel wird der Begriff des Geschäftsmodells definiert und dessen Bedeutung für den Unternehmenserfolg erläutert. Verschiedene Ansätze zur Zusammensetzung von Geschäftsmodellen werden vorgestellt.
- Kapitel 3: Begriffsabgrenzungen M - Commerce: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs M - Commerce und erläutert die Unterschiede zu E - Business.
- Kapitel 4: Arten von Geschäftsmodellen: In diesem Kapitel werden verschiedene Arten von Geschäftsmodellen im M - Commerce vorgestellt, wie B2C, B2B, B2E, C2C und D2D.
- Kapitel 5: Praxisbeispiele: Dieses Kapitel präsentiert Praxisbeispiele für M - Commerce Geschäftsmodelle, wie 12snap und @Road, und analysiert deren Erfolgspotenzial.
Schlüsselwörter
M - Business, M - Commerce, Geschäftsmodelle, UMTS, Lizenzen, B2C, B2B, B2E, C2C, D2D, Erfolgsfaktoren, Praxisbeispiele, Zukunftsaussichten.
Häufig gestellte Fragen
Warum waren die UMTS-Lizenzen für das M-Business so bedeutend?
Die hohen Investitionskosten für die Lizenzen zwangen die Netzbetreiber dazu, innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln, um die Ausgaben durch eine "kritische Masse" an zahlenden Kunden schnell zu refinanzieren.
Welche Arten von Geschäftsmodellen gibt es im M-Commerce?
Die Arbeit unterscheidet zwischen B2C (Business to Consumer), B2B (Business to Business), B2E (Business to Employee), C2C (Consumer to Consumer) und D2D (Device to Device).
Was sind die Erfolgsfaktoren für mobiles Business?
Wichtige Faktoren sind ausgereifte Technik (Bandbreite), Bedienungsfreundlichkeit der Endgeräte (Convenience) und die Generierung eines echten Mehrwerts für den Kunden, wie Zeit- und Ortsunabhängigkeit.
Ist der Kunde bereit, für mobile Dienste zu bezahlen?
Experten gehen davon aus, dass Kunden für Dienstleistungen bezahlen, die ihre Lebensqualität nachhaltig verbessern oder einen klaren geschäftlichen Nutzen bieten, anders als im damals oft kostenfreien stationären Internet.
Welche Praxisbeispiele für M-Commerce werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit analysiert Unternehmen wie 12snap und @Road als Beispiele für die Umsetzung mobiler Geschäftsstrategien.
- Citation du texte
- Michael Dall (Auteur), 2003, Geschäftsmodelle des M-Commerce, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22841