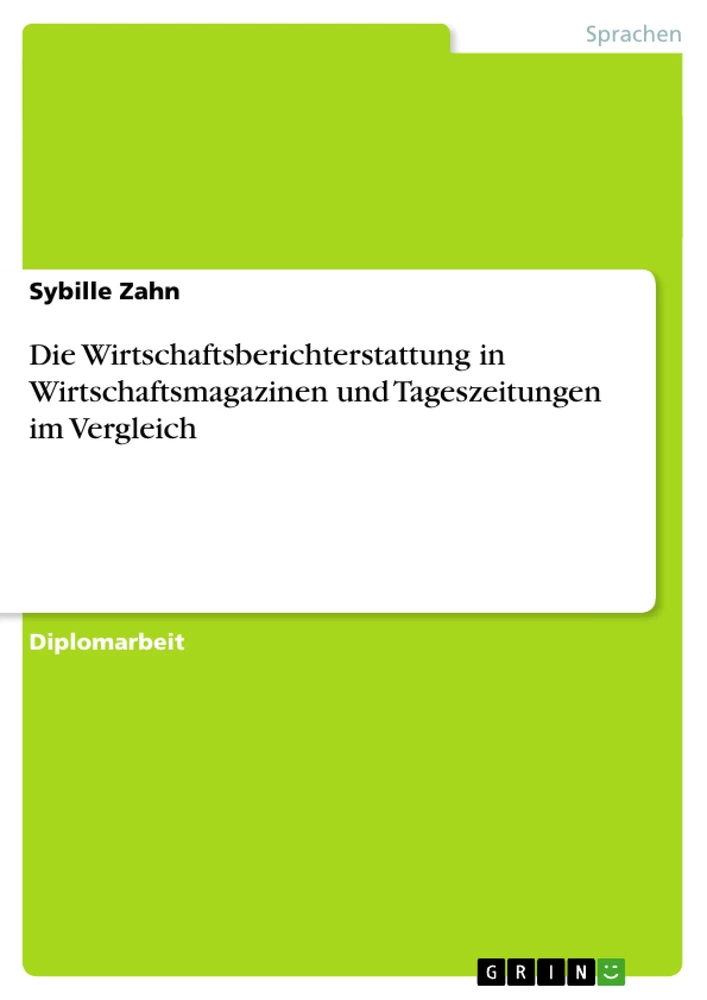Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Wirtschaftsjournalismus. Dabei geht es sowohl um das Berufsfeld des Wirtschaftsjournalisten, seine Pflichten und Aufgaben als auch um die Ergebnisse wirtschaftsjournalistischer Arbeit - Artikel und Beiträge in Tageszeitungen und Magazinen. Beschäftigt man sich mit Wirtschaftsjournalismus ist es zunächst einmal wichtig zu definieren, was darunter im Allgemeinen und auch im Speziellen in dieser Arbeit verstanden wird. Dazu soll das erste Kapitel dienen. Das zweite Kapitel gibt wichtige Informationen über die Zielgruppe der Wirtschaftsjournalisten und stellt Veränderungen in den letzten Jahrzehnten heraus.
Es ist von großer Bedeutung, auch auf die zeitliche Entwicklung dieses Berufsfeldes und seiner Rezeption einzugehen. Dies zeigt auf, dass Wirtschaftsjournalismus nicht statisch oder festgelegt ist, sondern sich immer bestimmten Tendenzen entsprechend bewegt und weiterentwickelt. Darauf wird insbesondere im vierten Kapitel eingegangen.
Nicht zu vernachlässigen ist an dieser Stelle, dass Veränderungen, Entwicklungen und Neuerungen nicht immer positiver Art sein müssen. Daher findet auch Kritik an diesen Punkten in der vorliegenden Arbeit Erwähnung. Kritik ist mitunter subjektiv, sobald sie aber den Eindruck mehrerer Menschen und Gruppen widerspiegelt, sollte sie jedoch ernst genommen und eingehender untersucht werden.
Die bereits erwähnten Punkte stellen eine Wissensgrundlage dar, die nötig ist, um die nächsten Kapitel verstehen und bewerten zu können. Es sollen nun die verschiedenen Merkmale von Wirtschaftsberichterstattung dargestellt werden. Dabei wurden Wirtschaftsmedien unter drei Gesichtspunkten analysiert: Inhalt, Textlinguistik und Lexik. Diese Betrachtung ist ohne Wissen über Wirtschaftsjournalismus allgemein nur wenig aussagekräftig oder gar nicht möglich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Wirtschaftsjournalismus?
- 3. Die Zielgruppe der Wirtschaftsjournalisten
- 3.1 Veränderungen am Markt und in der Zielgruppe
- 4. Wirtschaftspublizistik im Wandel der Zeit
- 4.1 Anforderungen früher und heute
- 5. Kritik an der Entwicklung des Wirtschaftsjournalismus
- 6. Vorstellung der untersuchten Publikationen
- 6.1 Tageszeitungen
- 6.1.1 Die Welt
- 6.1.2 Die Märkische Oderzeitung
- 6.2 Wirtschaftsmagazine
- 6.2.1 Die Wirtschaftswoche
- 6.2.2 impulse
- 6.1 Tageszeitungen
- 7. Aufbau und Zusammensetzung der untersuchten Publikationen
- 7.1 Inhaltsanalyse
- 7.1.1 Inhalte der Wirtschaftsrubrik der Tageszeitungen
- 7.1.2 Inhalte der Wirtschaftsmagazine
- 7.1.3 Vergleich der Inhalte
- 7.2 Textsorten
- 7.2.1 Klassifikationsmodelle
- 7.2.2 Vorherrschende Textsorten in der Presse
- 7.2.3 Textsorten in der Wirtschaftsrubrik der Tageszeitungen
- 7.2.4 Textsorten in den Wirtschaftsmagazinen
- 7.2.5 Vergleich der Verwendung der Textsorten
- 7.3 Gestaltung
- 7.3.1 Gestaltungsmittel
- 7.3.2 Gestaltung der Wirtschaftsrubrik der Tageszeitungen
- 7.3.3 Gestaltung der Wirtschaftsmagazine
- 7.3.4 Vergleich der Gestaltung
- 7.1 Inhaltsanalyse
- 8. Sprachliche Merkmale der Wirtschaftsberichterstattung
- 8.1 Syntax
- 8.1.1 Die Satzlänge
- 8.1.1.1 Satzlängen in der Wirtschaftsrubrik der Tageszeitungen
- 8.1.1.2 Satzlängen in den Wirtschaftsmagazinen
- 8.1.1.3 Vergleich der Satzlängen
- 8.1.2 Die Satzstruktur
- 8.1.2.1 Satzstrukturen in der Wirtschaftsrubrik der Tageszeitungen
- 8.1.2.2 Satzstrukturen in den Wirtschaftsmagazinen
- 8.1.2.3 Vergleich der Satzstrukturen
- 8.1.1 Die Satzlänge
- 8.2 Lexik
- 8.2.1 Fachsprache
- 8.2.1.1 Bestimmung des Begriffs „Fachsprache“
- 8.2.1.2 Der Anglizismus
- 8.2.1.3 Anglizismen in der Wirtschaftsrubrik der Tageszeitungen
- 8.2.1.4 Anglizismen in den Wirtschaftsmagazinen
- 8.2.1.5 Vergleich der Verwendung von Anglizismen
- 8.2.2 Bildhafte Sprache
- 8.2.2.1 Metapher, Phraseologismus, Personifizierung - Definitionen
- 8.2.2.2 Bildhafte Sprache in der Wirtschaftsrubrik der Tageszeitungen
- 8.2.2.3 Bildhafte Sprache in den Wirtschaftsmagazinen
- 8.2.2.4 Vergleich der Verwendung bildhafter Sprache
- 8.2.3 Nominalstil
- 8.2.3.1 Formen des Nominalstils
- 8.2.3.2 Nominalstil in der Wirtschaftsrubrik der Tageszeitungen
- 8.2.3.3 Nominalstil in den Wirtschaftsmagazinen
- 8.2.3.4 Vergleich des Nominalstils
- 8.2.4 Verbstruktur
- 8.2.4.1 Vollverben - verbale Gefüge
- 8.2.4.2 Das Passiv der Verben
- 8.2.4.3 Der Konjunktiv der Verben
- 8.2.4.4 Verbale Gefüge, Passiv und Konjunktiv in der Wirtschaftsrubrik der Tageszeitungen
- 8.2.4.5 Verbale Gefüge, Passiv und Konjunktiv in den Wirtschaftsmagazinen
- 8.2.4.6 Vergleich der Verwendung verbaler Gefüge, des Passivs und des Konjunktivs
- 8.2.1 Fachsprache
- 8.1 Syntax
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Wirtschaftsberichterstattung in Wirtschaftsmagazinen und Tageszeitungen. Ziel ist ein Vergleich unter inhaltlichen, lexikalischen und textlinguistischen Gesichtspunkten. Die Arbeit analysiert Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung wirtschaftlicher Themen.
- Inhaltliche Unterschiede in der Berichterstattung
- Lexikalische Besonderheiten der Wirtschaftsberichterstattung
- Textlinguistische Analyse der Satzstrukturen und -längen
- Vergleich der verwendeten Textsorten
- Analyse der Gestaltungsmittel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt die Forschungsfrage sowie die Methodik der Untersuchung. Sie erläutert den Aufbau der Arbeit und skizziert die einzelnen Kapitel.
2. Was ist Wirtschaftsjournalismus?: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Wirtschaftsjournalismus und beleuchtet seine spezifischen Merkmale und Funktionen. Es diskutiert die Rolle des Wirtschaftsjournalismus in der Gesellschaft und seinen Einfluss auf die öffentliche Meinung.
3. Die Zielgruppe der Wirtschaftsjournalisten: Hier wird die Zielgruppe der Wirtschaftsjournalisten analysiert, mit besonderem Fokus auf die Veränderungen des Marktes und der Leserschaft. Es werden die Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppe im Kontext der Wirtschaftsberichterstattung erörtert.
4. Wirtschaftspublizistik im Wandel der Zeit: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Wirtschaftspublizistik im Laufe der Zeit. Es vergleicht die Anforderungen an Wirtschaftsjournalisten früher und heute und beleuchtet die Herausforderungen im Zuge der Medienentwicklung.
5. Kritik an der Entwicklung des Wirtschaftsjournalismus: Das Kapitel befasst sich mit kritischer Auseinandersetzung mit der Entwicklung des Wirtschaftsjournalismus. Es analysiert potentielle Schwächen, Verzerrungen oder Tendenzen in der Berichterstattung und diskutiert deren Konsequenzen.
6. Vorstellung der untersuchten Publikationen: In diesem Kapitel werden die ausgewählten Tageszeitungen (Die Welt, Die Märkische Oderzeitung) und Wirtschaftsmagazine (Die Wirtschaftswoche, impulse) detailliert vorgestellt. Ihre jeweiligen Profile, Zielgruppen und Ausrichtungen werden erläutert.
7. Aufbau und Zusammensetzung der untersuchten Publikationen: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Inhaltsanalyse, der Textsortenanalyse und der Gestaltungsanalyse der untersuchten Publikationen. Es vergleicht die Ergebnisse der drei Analysekategorien (Inhalt, Textsorte, Gestaltung) und zieht erste Schlussfolgerungen.
8. Sprachliche Merkmale der Wirtschaftsberichterstattung: Dieser umfangreiche Kapitel analysiert die sprachlichen Merkmale der Wirtschaftsberichterstattung in den untersuchten Publikationen. Es untersucht die Syntax (Satzlänge, Satzstruktur) und die Lexik (Fachsprache, Anglizismen, bildhafte Sprache, Nominalstil, Verbstrukturen) und vergleicht die Ergebnisse zwischen den untersuchten Medien.
Schlüsselwörter
Wirtschaftsjournalismus, Wirtschaftsberichterstattung, Tageszeitungen, Wirtschaftsmagazine, Inhaltsanalyse, Textsortenanalyse, Sprachliche Merkmale, Syntax, Lexik, Fachsprache, Anglizismen, Bildhafte Sprache, Nominalstil, Vergleichende Analyse.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Analyse der Wirtschaftsberichterstattung
Was ist der Gegenstand der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit analysiert die Wirtschaftsberichterstattung in deutschen Tageszeitungen und Wirtschaftsmagazinen. Im Fokus steht ein detaillierter Vergleich der Berichterstattung unter inhaltlichen, lexikalischen und textlinguistischen Aspekten.
Welche Publikationen wurden untersucht?
Die Untersuchung umfasst vier Publikationen: Die Tageszeitungen „Die Welt“ und „Märkische Oderzeitung“ sowie die Wirtschaftsmagazine „Wirtschaftswoche“ und „impulse“. Die Auswahl dieser Medien ermöglicht einen Vergleich verschiedener Publikationsformate und Zielgruppen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine mehrschichtige Analysemethode. Es werden Inhaltsanalysen durchgeführt, um die thematischen Schwerpunkte zu identifizieren. Weiterhin werden Textsortenanalysen vorgenommen, um die vorherrschenden Textsorten in den jeweiligen Publikationen zu bestimmen. Schließlich erfolgt eine textlinguistische Analyse, die sich mit der Syntax (Satzlänge, Satzstruktur) und der Lexik (Fachsprache, Anglizismen, bildhafte Sprache, Nominalstil, Verbstrukturen) auseinandersetzt.
Welche Aspekte der Wirtschaftsberichterstattung werden verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf inhaltliche Unterschiede in der Berichterstattung, lexikalische Besonderheiten, textlinguistische Merkmale (Satzstrukturen und -längen), verwendete Textsorten und die angewandten Gestaltungsmittel.
Welche sprachlichen Merkmale wurden analysiert?
Die sprachliche Analyse umfasst die Syntax (Satzlänge und -struktur) und die Lexik. Im Bereich Lexik werden Fachsprache, Anglizismen, bildhafte Sprache, der Nominalstil und die Verbstrukturen (inklusive Passiv und Konjunktiv) untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Definition des Wirtschaftsjournalismus, Zielgruppenanalyse, historische Entwicklung der Wirtschaftspublizistik, Kritik am Wirtschaftsjournalismus, Vorstellung der untersuchten Publikationen, Aufbau und Zusammensetzung der Publikationen (Inhalts-, Textsorten- und Gestaltungsanalyse) und schließlich die sprachlichen Merkmale der Wirtschaftsberichterstattung.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Inhaltsanalysen, Textsortenanalysen und der textlinguistischen Analysen. Diese Ergebnisse werden verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Wirtschaftsberichterstattung der untersuchten Publikationen aufzuzeigen. Schlussfolgerungen werden gezogen und diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wirtschaftsjournalismus, Wirtschaftsberichterstattung, Tageszeitungen, Wirtschaftsmagazine, Inhaltsanalyse, Textsortenanalyse, Sprachliche Merkmale, Syntax, Lexik, Fachsprache, Anglizismen, Bildhafte Sprache, Nominalstil, Vergleichende Analyse.
Wozu dient die Zusammenfassung der Kapitel?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über den Inhalt und die Ergebnisse jedes Kapitels der Diplomarbeit. Sie dient der schnellen Orientierung und dem besseren Verständnis des Gesamtkontextes.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist ein Vergleich der Wirtschaftsberichterstattung in Wirtschaftsmagazinen und Tageszeitungen unter inhaltlichen, lexikalischen und textlinguistischen Gesichtspunkten. Es soll herausgearbeitet werden, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung wirtschaftlicher Themen bestehen.
- Citation du texte
- Sybille Zahn (Auteur), 2003, Die Wirtschaftsberichterstattung in Wirtschaftsmagazinen und Tageszeitungen im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22931