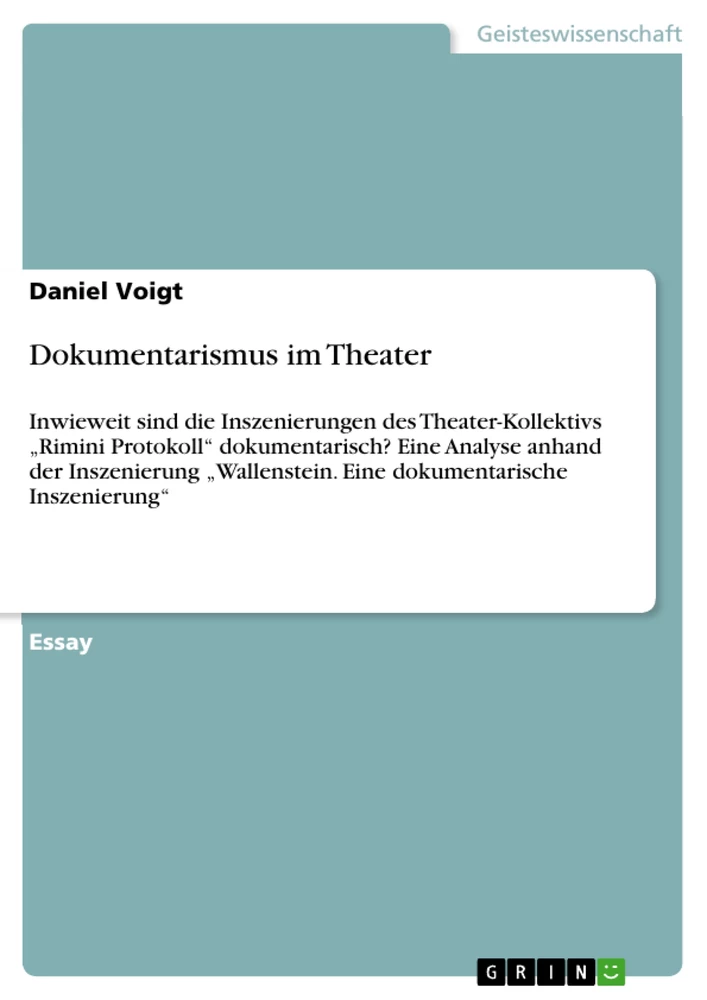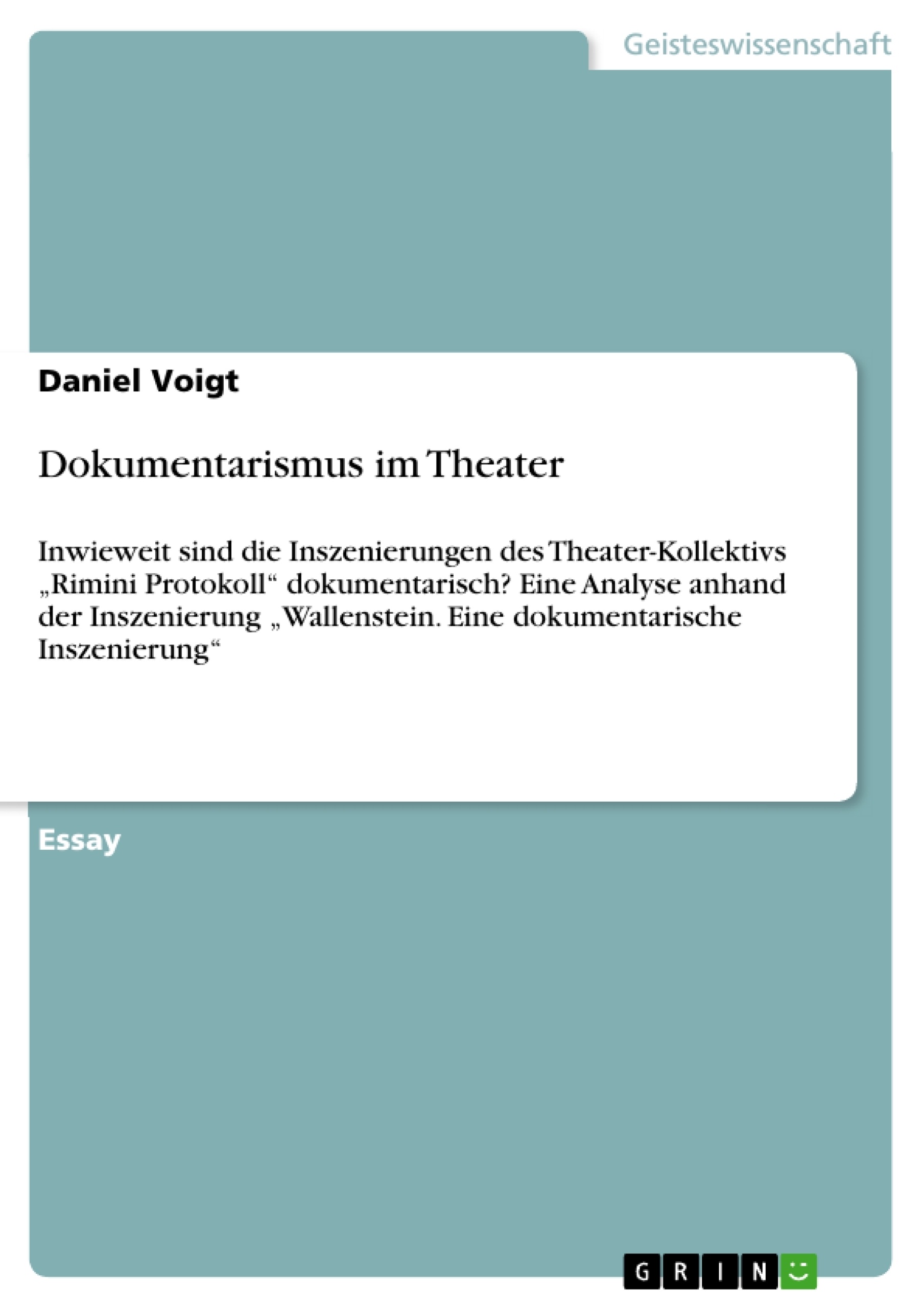Kann Theater dokumentarisch sein? Im ersten Moment erscheint das zweifelhaft, gilt Theater doch als eine Inszenierungskunst von Schauspielern, Regisseuren und Dramaturgen. Kritiker werfen den Dokumentartheater-Autoren vor, „daß das Theater als Institution einfach nicht imstande sei, diese Bedingungen zu erfüllen; da die ästhetischen Mittel der Bühne mit dem Begriff von 'Authentizität' im Grunde unvereinbar seien; und daß das Dokumentartheater daher – unabhängig von der gewählten dramatischen Struktur – auf einem unversöhnlichen Widerspruch basiere“1. Diese Kritik ist berechtigt, basiert traditionelles Theater doch auf der Verteilung von Rollen und dem Vortragen von Texten durch Schauspieler mithilfe visueller Mittel (Kostüm, Bühnenbild, Beleuchtung, Choreographie usw.), auf die auch das gängige Dokumentartheater meist nicht verzichten möchte. „Der Stoff werde [ ] nicht nur bearbeitet, sondern in einen anderen symbolischen Bereich versetzt; in dieser fremden Umgebung gewinnen Wörter und Handlungen neue Bedeutungen; Zitate werden zu 'Theater-Sätzen'“2. Auch die Produktionen des Theater-Kollektivs „Rimini Protokoll“ um die Regisseure Daniel Wetzel, Helgard Haug und Stefan Kaegi werden zum Genre des Dokumentartheaters gezählt und verzichten weder auf Bühnenbilder, noch auf bestimmte Beleuchtungs- oder Choreographie-Strategien. Während die meisten Regisseure des Dokumentartheaters konzeptuell allerdings auch nicht auf die Arbeit mit Profi-Schauspielern verzichten, stehen bei den Rimini-Produktionen der drei Performer normale Bürger aus dem Alltag auf der Bühne – „wahre“ Experten des Alltags, die bestimmte Erfahrungen, Interessen, Kenntnisse und Fähigkeiten teilen. „Ein Konzept, dass bewusst das Gegenteil vom Laientheater behauptet; die Protagonisten sollen nicht an dem gemessen werden, was sie nicht können (eben Schauspielen), sondern an dem, was der Grund für ihre Anwesenheit auf der Bühne ist. Von ihnen hängt es ab, welcher Verlauf ein Abend nehmen kann, welche Themen angeschnitten oder ausgeführt werden, welche Figuren, Texte, Räume entstehen“3. Inwieweit sind die Stücke von Rimini Protokoll damit aber dokumentarisch? Wie authentisch können sich die „Experten des Alltags“ auf der Bühne verhalten? Bildet das Regie-Kollektiv die behandeltenThemenkomplexe damit wirklichkeitsgetreu ab oder wird Realität nur unter dem Vorwand des beweisführenden Expertenwissen inszeniert?
Kann Theater dokumentarisch sein? Im ersten Moment erscheint das zweifelhaft, gilt Theater doch als eine Inszenierungskunst von Schauspielern, Regisseuren und Dramaturgen. Kritiker werfen den Dokumentartheater-Autoren vor, „daß das Theater als Institution einfach nicht imstande sei, diese Bedingungen zu erfüllen; da die ästhetischen Mittel der Bühne mit dem Begriff von 'Authentizität' im Grunde unvereinbar seien; und daß das Dokumentartheater daher - unabhängig von der gewählten dramatischen Struktur - auf einem unversöhnlichen Widerspruch basiere“1. Diese Kritik ist berechtigt, basiert traditionelles Theater doch auf der Verteilung von Rollen und dem Vortragen von Texten durch Schauspieler mithilfe visueller Mittel (Kostüm, Bühnenbild, Beleuchtung, Choreographie usw.), auf die auch das gängige Dokumentartheater meist nicht verzichten möchte. „Der Stoff werde [ ] nicht nur bearbeitet, sondern in einen anderen symbolischen Bereich versetzt; in dieser fremden Umgebung gewinnen Wörter und Handlungen neue Bedeutungen; Zitate werden zu 'Theater-Sätzen'“2. Auch die Produktionen des Theater-Kollektivs „Rimini Protokoll“ um die Regisseure Daniel Wetzel, Helgard Haug und Stefan Kaegi werden zum Genre des Dokumentartheaters gezählt und verzichten weder auf Bühnenbilder, noch auf bestimmte Beleuchtungs- oder Choreographie-Strategien. Während die meisten Regisseure des Dokumentartheaters konzeptuell allerdings auch nicht auf die Arbeit mit Profi-Schauspielern verzichten, stehen bei den Rimini-Produktionen der drei Performer normale Bürger aus dem Alltag auf der Bühne - „wahre“ Experten des Alltags, die bestimmte Erfahrungen, Interessen, Kenntnisse und Fähigkeiten teilen. „Ein Konzept, dass bewusst das Gegenteil vom Laientheater behauptet; die Protagonisten sollen nicht an dem gemessen werden, was sie nicht können (eben Schauspielen), sondern an dem, was der Grund für ihre Anwesenheit auf der Bühne ist. Von ihnen hängt es ab, welcher Verlauf ein Abend nehmen kann, welche Themen angeschnitten oder ausgeführt werden, welche Figuren, Texte, Räume entstehen“3. Inwieweit sind die Stücke von Rimini Protokoll damit aber dokumentarisch? Wie authentisch können sich die „Experten des Alltags“ auf der Bühne verhalten? Bildet das Regie-Kollektiv die behandeltenThemenkomplexe damit wirklichkeitsgetreu ab oder wird Realität nur unter dem Vorwand des beweisführenden Expertenwissen inszeniert?
Für Jens Roselt zeigt sich das Dokumentarische bereits im Namen des Theater-Kollektivs „Rimini Protokoll“. „Die Darstellung des Protokolls im Hier und Jetzt des Theaters durch die leibhaftigen Akteure auf der Bühne ist [ ]immer schon eine Form der Nachträglichkeit eingeschrieben, die kenntlich macht, dass die protokollierten Ereignisse bereits stattgefunden haben“4. Sie verweisen auf historisches Quellenmaterial, die Brian Barton in seiner Analyse vom Dokumentartheater als Beweismaterial für dokumentarische Materialität erkennt. Folgt man seiner Analyse, müssen die Quellen im Dokumentartheater durch selektives Zitieren in einen anderen Zusammenhang gebracht werden, um die Wirklichkeit auf der Bühne objektiv und kritisch zu betrachten. „Nur durch die Montagetechnik können einzelne faktische Elemente ihre Authentizität bewahren und gleichzeitig über den Stoff hinaus auf größere Themen verweisen. […] Durch seine Schnitttechnik ist das Dokumentartheater in der Lage, Fakten von verschiedenen Quellen in einen thematischen Zusammenhang zu bringen, besondere Aspekte des Themas hervorzuheben, auf Widersprüche im Beweismaterial hinzuweisen und Verfälschungen der Wahrheit zu enthüllen“5.Bei Rimini- Produktionen wählen die Regisseure ihre Darsteller bzw. „Experten des Alltags“ --nach Interessen und Erfahrungen sortiert - für jede Inszenierung neu aus und formieren sie im Rahmen von übergreifenden Themenkomplexen zu wechselnden Ensembles. „Indem dokumentarisches Material mit subjektiven Erfahrungen konfrontiert, das Gesellschaftliche mit dem Individuellen verbunden und Information um subjektive Wahrnehmung erweitert werden, fordern sie den einzelnen, konkreten Menschen gegen das politisch Allgemeine ein“6.. Damit werden Rimini-Produktionen dem gesellschaftskritischen Anspruch gerecht, der stets in das Dokumentarische eingeschrieben ist.
Greift man mit „Wallenstein. Eine dokumentarische Inszenierung“7 ein einzelnes Stück für eine Inszenierungsanalyse heraus, so verortet man hier „Experten des Alltags“ für den Aufstieg und Fall im politischen Ränkespiel der Macht, Loyalität und Gehorsam sowie des Individuums in politischen Umbruchphasen. Alle Darsteller haben miteinander gemeinsam, dass sie während des Kalten Krieges zu gegensätzlichen ideologischen Blöcken entlang des Eisernen Vorhangs gehörten; alle Biographien eint eine assoziative Verbindung zu Schillers Drama „Wallenstein“. Wie unterschiedlich jedoch die Biografien im mikrokosmischen Rahmen ausfallen und Schicksale das Leben jedes Einzelnen beeinflusst haben, wird deutlich, wenn die Protagonisten den Zuschauern in berichtenden Monologen von ihren Lebensläufen erzählen und in Handlungsszenen prägende Geschehnisse mithilfe der Schauspielkunst anderer Experten nachspielen.8 Vordergründig geht es den Experten dabei zwar um offene Mitteilung ihrer eigenen Lebenserfahrungen - und -erlebnisse. Doch transformiert man diese persönlichen und emotionalen Geschichten auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen - dann stößt man hier auf eine kritische Auseinandersetzung um Interessenskonflikten zwischen politischer Macht, Loyalität, Verantwortung, Gehorsam und Eigennutz - gerichtet mit dem assoziativen Blick auf Wallenstein innerhalb eines äußeren und inneren Rahmens und dessen Bedeutung für das eigene persönliche Lebensschicksal. So schildert der Elektromeister Fredermann Gassner, wie ihm die Verse der Schiller-Lektüre in einer schweren Lebenskrise vor dem Selbstmord bewahrten. Der Stadtamtsrat und ehemalige Luftwaffenhelfer Robert Helfert erinnert sich durch die Lektüre an seine Schulzeit in der Hitlerjugend, als er als Flakhelfer im Zweiten Weltkrieg kämpfte und setzt - anspielend auf das Schiller Lied „Auf, auf Kameraden“ - Assoziationen der militärischen Gehorsams- und Befehlspolitik frei. Der Ex- Zeitsoldat Hagen Reich berichtet von den nicht bewältigten psychischen und emotionalen Belastungen der realitätsnahen Bundeswehr-Simulationen, die Assoziationen zur immensen Verantwortung des Wallensteins im Schiller-Roman herbeirufen. Bei der tragischen Liebesgeschichte des stellvertretenden Polizeidirektions-Leiters Ralf Kirsten, die seine DDR- Karriere fast zum Scheitern brachte, werden Fragen der Kombinierbarkeit von loyaler Arbeit und privatem Glück diskutiert. Für Jens Roselt ist Ralf Kirsten äquivalent zur Figur Max Piccolomini, der im Stück ebenfalls in ein Gewissenskonflikt zwischen der Treue zum Kaiser und der privaten Liebe gebracht wird.9 Wenn der Ex-Oberkellner Wolfgang Brendel wiederum ohne Scheu von seinen beruflichen Erfahrungen mit Diktatoren als Gäste seines Hotels berichtet, werden Fragen zu gesellschaftlichen Moralvorstellungen besprochen und diskutiert, wo die Grenze zwischen Moral und Unmoral zu ziehen ist - und ebenfalls in „Wallenstein“ als Thema beleuchtet wird. Die beiden Vietnam-Veteranen Dave Blalock und Darnell S. Summers dokumentieren mit ihren Schilderungen schließlich die Gräuel des Vietnam-Krieges und werfen die Frage auf, wo der Gehorsam endet und die Revolte gegen skrupellos brutale Machtstrukturen beginnt - gleichzeitig vergegenwärtigen sie die Verwundbarkeit einer Supermacht, die bis dato ihre politische Unverwundbarkeit preiste. Doch auch in den Biografien der beiden Expertinnen können Assoziationen zu Wallenstein und gesellschaftlichen Fragestellungen geknüpft werden.
[...]
1 Brian Barton: Das Dokumentartheater. Stuttgart 1997. S.14
2 Ebd.
3 Florian Malzacher: Dramaturgien der Fürsorge und der Verunsicherung. In: Miriam Dreysse/ Florian Malzacher: Rimini Protokoll. Experten des Alltags. Das Theater von Rimini Protokoll. Hrsg. Von Miriam Dreysse/ Florian Malzacher. Berlin/ Köln 2007. S.14-43; hier: S.23f.
4 Jens Roselt: In Erscheinung treten. Zur Darstellungspraxis des Sich-Zeigens. In: Miriam Dreysse/ Florian Malzacher: Rimini Protokoll. Experten des Alltags. Das Theater von Rimini Protokoll. Hrsg. Von Miriam Dreysse/ Florian Malzacher. Berlin/ Köln 2007. S.46-61; hier: S.46
5 Barton 1997: S.5
6 Miriam Dreysse/ Florian Malzacher: Vorwort. In: Miriam Dreysse/ Florian Malzacher: Rimini Protokoll. Experten des Alltags. Das Theater von Rimini Protokoll. Hrsg. Von Miriam Dreysse/ Florian Malzacher. Berlin/ Köln 2007. S.8-11, hier: S.9
7 Vgl. Helgard Haug/ Daniel Wetzel: Wallenstein. Eine dokumentarische Inszenierung des Rimini Protokolls. Mannheim 2005. Online-Video der Gesamtaufführung verfügbar unter
http://vimeo.com/41480630
8 Vgl. Roselt 2007: S.56
9 Ebd. S.53
- Citar trabajo
- Daniel Voigt (Autor), 2013, Dokumentarismus im Theater, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229465