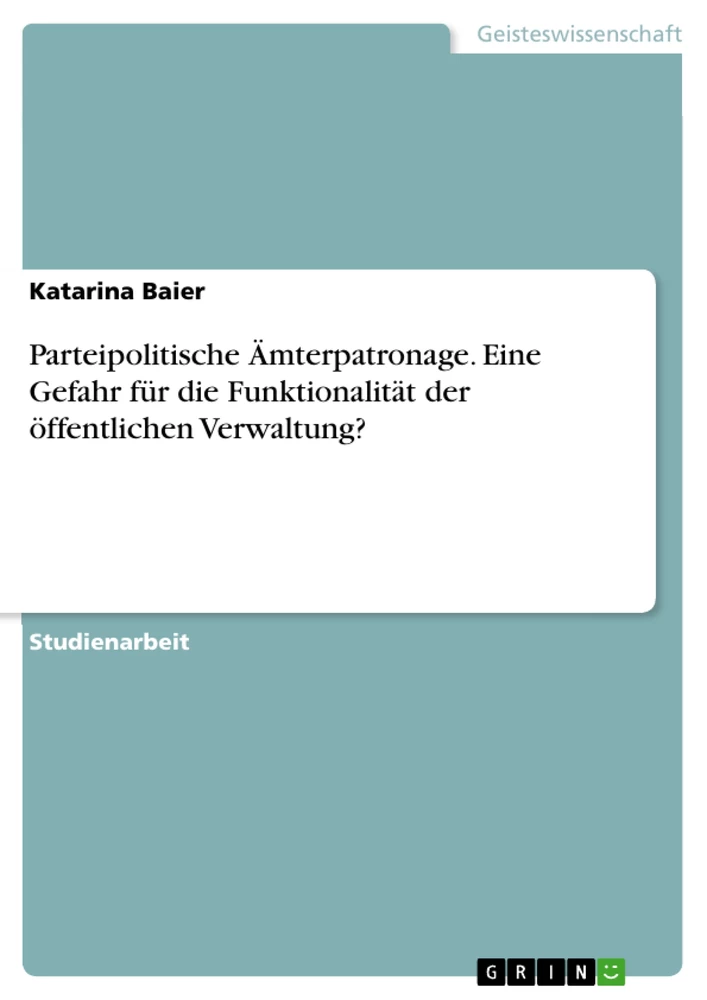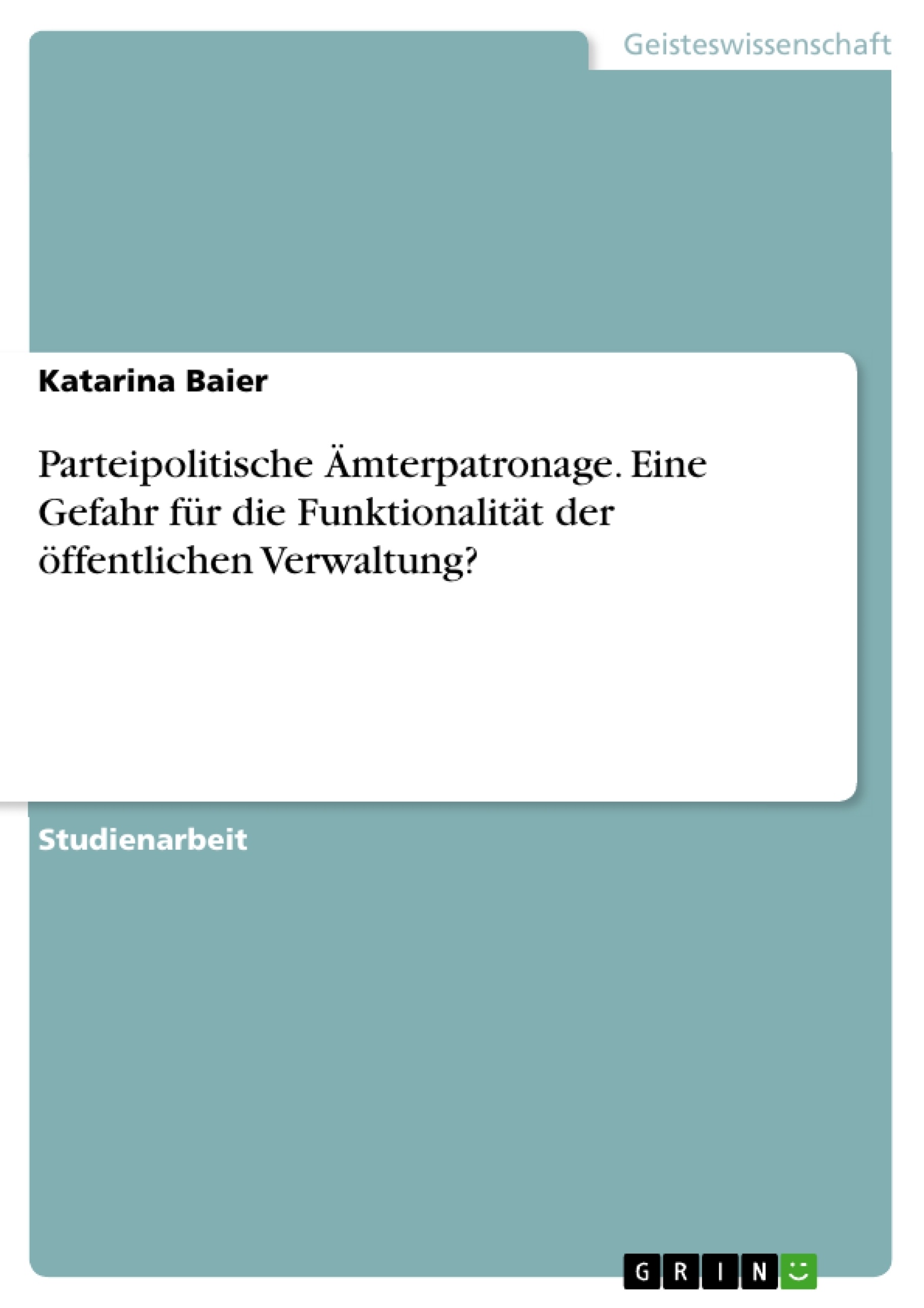Die deutsche Gesetzgebung gibt im Grundgesetz ein reines Leistungs- und Gleichheitsprinzip1 als Maß für Stellenbesetzungen in der öffentlichen Verwaltung vor. Dennoch diskutiert man ganz öffentlich die Besetzung von administrativen Spitzenpositionen mit Mitgliedern bestimmter Parteien, ungeachtet ihrer fachlichen Eignung. Zuletzt berichteten DIE ZEIT und auch SpiegelOnline im Dezember 2012 über die Verteilung von wichtigen Posten an Parteifreunde durch Minister von Union und FDP mit dem Subtext zur Schlagzeile: „Neun Monate vor der Bundestagswahl soll Schwarz-Gelb eilig Posten an Parteifreunde verteilen.2“ Die mediale Berichterstattung wälzt das Thema rund um das „richtige Parteibuch“ aus. Es geht um Täuschung der Öffentlichkeit durch undurchsichtig getroffene Personalentscheidungen, vorgeworfen werden Machtmissbrauch, Versorgungs- mentalität und Vorteilsnahme, oder mutmaßliche Ämterpatronage. Skandalös, wenn man eine Beeinträchtigung des Demokratieprinzips mitdenkt.
Auch wissenschaftlich wird das Phänomen ausführlich analysiert. Für den Verwaltungswissenschaftler Hans-Ulrich Derlien war es kein Geheimnis, dass in der oberen Ministerialbürokratie insbesondere bei Regierungswechseln Stellenbesetzungen nach Parteifärbung stattfinden 3 . Es erscheint also offensichtlich, dass ein Widerspruch zwischen dem verfassungsmäßigem Verbot und der gängigen Praxis existiert.
Im Vordergrund dieser Arbeit soll die theoretische Betrachtung von parteipolitischer Ämterpatronage in der öffentlichen Verwaltung stehen. Welche Gefahren bestehen für die öffentliche Verwaltung, wenn Ämter nicht mehr mit dem fachlich qualifiziertesten Kandidaten, sondern nach dem Parteibuch besetzt werden? Ob und in welchem Umfang Ämterpatronage gegen das Grundgesetz verstößt soll geklärt werden.
Dazu wird zunächst anhand der Beschäftigten der Ministerialbürokratie als oberste Ebene der Bundesverwaltung das besondere Verhältnis von Politik undVerwaltung analysiert und das klassische Beamtenverständnis dem des politisierten Beamten gegenübergestellt. Danach wird das Phänomen Ämterpatronage definiert und erläutert. Nach einer Differenzierung von Patronage-Formen, werden die Risiken für die Funktionalität der öffentlichen Verwaltung dargestellt, bevor ein Fazit gezogen wird um darin mögliche Ansätze zur Eindämmung von Ämterpatronage zu nennen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ministerialbürokratie und Beamtenstatus
- Zum Verhältnis von Politik und Verwaltung und was daraus folgt
- Formale Politisierung
- Funktionale Politisierung
- Wissenschaftlicher Stand zur Ämterpatronage
- Parteipolitische Ämterpatronage
- Begrifflichkeit und Definition
- Herrschaftspatronage
- Versorgungspatronage
- Proporzpatronage
- Feigenblattpatronage
- Funktionelle Patronage per Änderung des Aufgabenbereichs
- Rechtliche Bewertung und Risiken der Ämterpatronage
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die parteipolitische Ämterpatronage in der öffentlichen Verwaltung und deren Gefahren für die Funktionalität der Verwaltung. Es wird analysiert, ob und inwieweit diese Praxis gegen das Grundgesetz verstößt. Die Arbeit beleuchtet das Verhältnis von Politik und Verwaltung im Kontext der Ministerialbürokratie und des Beamtenstatus.
- Das Verhältnis von Politik und Verwaltung in Deutschland
- Definition und verschiedene Formen der Ämterpatronage
- Die Risiken der Ämterpatronage für die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung
- Rechtliche Bewertung der Ämterpatronage
- Mögliche Ansätze zur Eindämmung der Ämterpatronage
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der parteipolitischen Ämterpatronage ein und stellt den Widerspruch zwischen dem im Grundgesetz verankerten Leistungs- und Gleichheitsprinzip und der Praxis der Besetzung von Spitzenpositionen in der öffentlichen Verwaltung nach Parteizugehörigkeit heraus. Aktuelle Beispiele aus der Medienberichterstattung werden angeführt, um die Relevanz des Themas zu unterstreichen. Die Arbeit skizziert ihren Fokus auf die theoretische Betrachtung der Ämterpatronage und die damit verbundenen Gefahren für die öffentliche Verwaltung.
Ministerialbürokratie und Beamtenstatus: Dieses Kapitel beschreibt die Ministerialbürokratie als oberste Ebene der Bundesverwaltung und beleuchtet deren Struktur und Funktionsweise im Kontext des Weber'schen Idealtypus der rationalen Bürokratie. Es wird das Verhältnis zwischen der Ministerialbürokratie und der politischen Führung analysiert, wobei die Rolle des Ministers als Berufspolitiker und die Hauptaufgabe der Ministerien, politische Entscheidungen vorzubereiten und umzusetzen, hervorgehoben werden. Der Beamtenstatus und die damit verbundenen Rechte und Pflichten werden erläutert, mit Fokus auf die unparteiische und gerechte Erfüllung der Aufgaben, sowie die damit verbundene Unabhängigkeit gegenüber der politischen Behördenleitung. Das klassische Beamtenverständnis Max Webers wird im Kontext der Sachlichkeit und Fachmäßigkeit präsentiert.
Zum Verhältnis von Politik und Verwaltung und was daraus folgt: Dieses Kapitel analysiert das komplexe Zusammenspiel von Politik und Verwaltung. Es differenziert zwischen formaler und funktionaler Politisierung und beleuchtet den wissenschaftlichen Diskurs zur Ämterpatronage. Es untersucht, wie politische Einflüsse auf die Verwaltung wirken und wie die Verwaltung ihrerseits die Politik beeinflussen kann.
Parteipolitische Ämterpatronage: Dieses Kapitel liefert eine detaillierte Definition und differenziert verschiedene Formen der parteipolitischen Ämterpatronage, darunter Herrschafts-, Versorgungs-, Proporz- und Feigenblattpatronage. Es beleuchtet verschiedene Strategien der politischen Einflussnahme auf die Besetzung von Ämtern und analysiert die Mechanismen und Folgen dieser Praktiken. Die verschiedenen Formen werden im Detail erläutert, um die Komplexität des Phänomens darzustellen.
Rechtliche Bewertung und Risiken der Ämterpatronage: In diesem Kapitel wird die rechtliche Bewertung der Ämterpatronage und die damit verbundenen Risiken für die Funktionalität der öffentlichen Verwaltung analysiert. Es wird untersucht, inwiefern die Praxis der Ämterpatronage gegen das Grundgesetz verstößt und welche negativen Folgen sie für die Effizienz, die Neutralität und die Legitimität der öffentlichen Verwaltung hat. Die Analyse verknüpft die vorherigen Kapitel und integriert die Erkenntnisse zu den verschiedenen Formen der Patronage und deren rechtliche Implikationen.
Schlüsselwörter
Ämterpatronage, Ministerialbürokratie, Beamtenstatus, Politik und Verwaltung, Parteipolitik, Grundgesetz, Funktionalität der öffentlichen Verwaltung, Leistungs- und Gleichheitsprinzip, Risiken, Rechtliche Bewertung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Parteipolitische Ämterpatronage in der öffentlichen Verwaltung"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die parteipolitische Ämterpatronage in der öffentlichen Verwaltung Deutschlands. Sie analysiert die verschiedenen Formen der Ämterpatronage, deren rechtliche Bewertung und die Risiken für die Funktionalität der Verwaltung. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Widerspruch zwischen dem im Grundgesetz verankerten Leistungs- und Gleichheitsprinzip und der Praxis der Besetzung von Spitzenpositionen nach Parteizugehörigkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Ministerialbürokratie und Beamtenstatus, Zum Verhältnis von Politik und Verwaltung und was daraus folgt (inklusive formaler und funktionaler Politisierung und wissenschaftlichem Stand zur Ämterpatronage), Parteipolitische Ämterpatronage (mit detaillierter Betrachtung verschiedener Patronageformen wie Herrschafts-, Versorgungs-, Proporz- und Feigenblattpatronage), Rechtliche Bewertung und Risiken der Ämterpatronage, und Zusammenfassung und Fazit.
Welche Formen der Ämterpatronage werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert verschiedene Formen der parteipolitischen Ämterpatronage: Herrschaftspatronage, Versorgungspatronage, Proporzpatronage und Feigenblattpatronage. Zusätzlich wird die „funktionelle Patronage per Änderung des Aufgabenbereichs“ erwähnt. Diese Unterscheidung dient einer detaillierten Analyse der verschiedenen Strategien politischer Einflussnahme auf die Besetzung von Ämtern.
Wie wird das Verhältnis von Politik und Verwaltung betrachtet?
Die Arbeit analysiert das komplexe Zusammenspiel von Politik und Verwaltung, differenziert zwischen formaler und funktionaler Politisierung und beleuchtet den wissenschaftlichen Diskurs zur Ämterpatronage. Es wird untersucht, wie politische Einflüsse auf die Verwaltung wirken und wie die Verwaltung ihrerseits die Politik beeinflussen kann. Der Kontext der Ministerialbürokratie und des Beamtenstatus wird dabei berücksichtigt.
Welche Risiken birgt Ämterpatronage für die öffentliche Verwaltung?
Die Arbeit untersucht die Risiken der Ämterpatronage für die Funktionalität der öffentlichen Verwaltung. Es wird analysiert, inwiefern diese Praxis gegen das Grundgesetz verstößt und welche negativen Folgen sie für die Effizienz, Neutralität und Legitimität der öffentlichen Verwaltung hat. Die Arbeit betont die Gefährdung des Leistungs- und Gleichheitsprinzips.
Wie wird die Ämterpatronage rechtlich bewertet?
Die Arbeit analysiert die rechtliche Bewertung der Ämterpatronage und untersucht, inwieweit die Praxis gegen das Grundgesetz verstößt. Die rechtlichen Implikationen der verschiedenen Formen der Patronage werden im Detail betrachtet und mit den Risiken für die Funktionsfähigkeit der Verwaltung verknüpft.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Ämterpatronage, Ministerialbürokratie, Beamtenstatus, Politik und Verwaltung, Parteipolitik, Grundgesetz, Funktionalität der öffentlichen Verwaltung, Leistungs- und Gleichheitsprinzip, Risiken und Rechtliche Bewertung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die parteipolitische Ämterpatronage und deren Gefahren für die Funktionalität der Verwaltung. Es wird analysiert, ob und inwieweit diese Praxis gegen das Grundgesetz verstößt. Die Arbeit beleuchtet das Verhältnis von Politik und Verwaltung im Kontext der Ministerialbürokratie und des Beamtenstatus und untersucht mögliche Ansätze zur Eindämmung der Ämterpatronage.
- Quote paper
- Katarina Baier (Author), 2013, Parteipolitische Ämterpatronage. Eine Gefahr für die Funktionalität der öffentlichen Verwaltung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229546