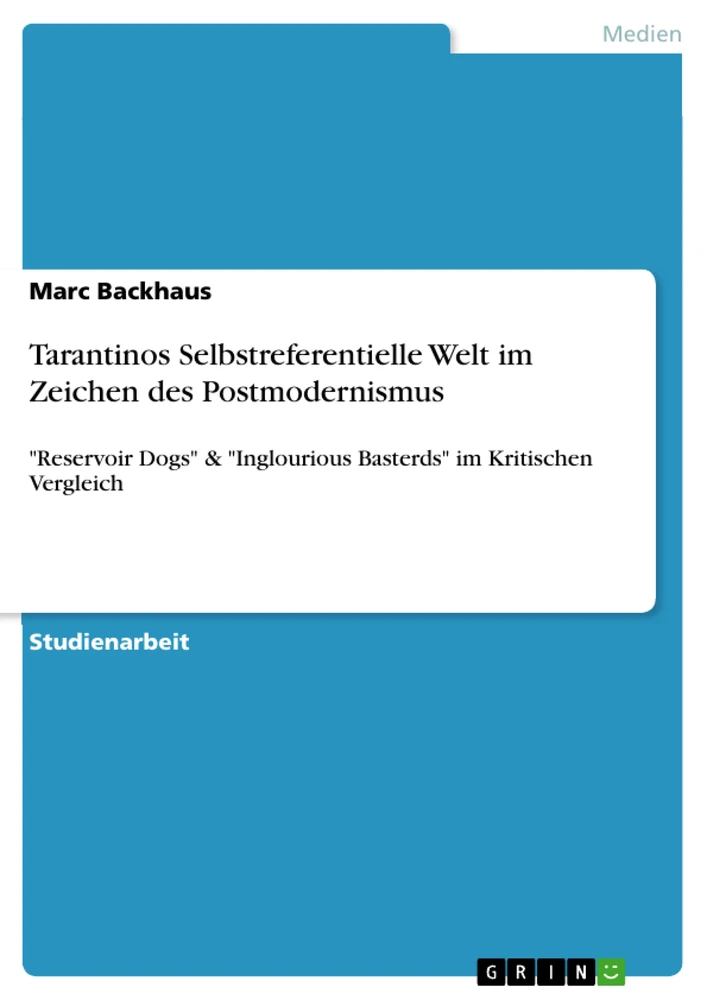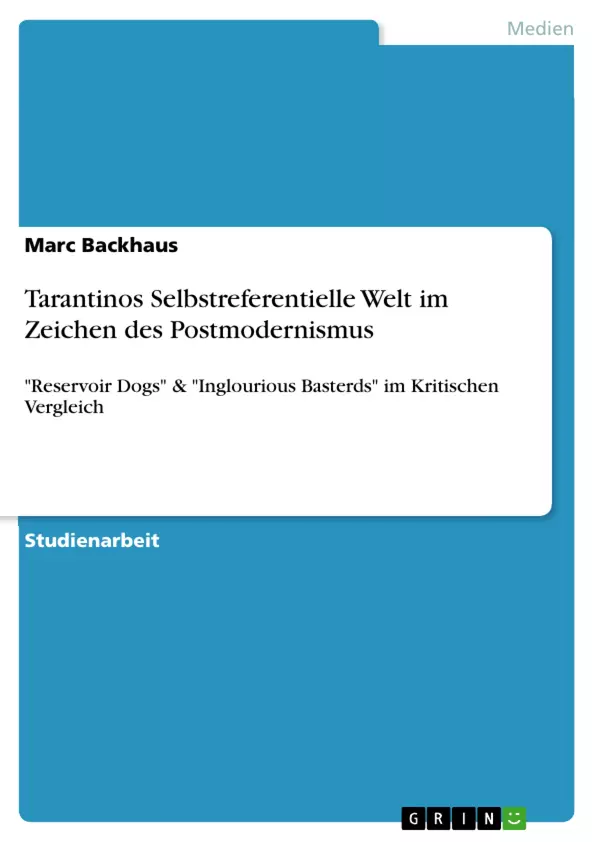Mit "Reservoir Dogs" (1992) und "Inglourious Basterds" (2009) schuf Quentin Tarantino zwei grundlegend verschiedene Filme, die dennoch viele Gemeinsamkeiten bergen. Während bei "Reservoir Dogs" die erfundene Geschichte eines Juwelierüberfalls als Kontext dient, ist der von "Inglourious Basterds" das historische Ereignis des Zweiten Weltkrieges. "Freilich hat diese Rückbesinnung auf die Geschichte nicht zu einer wirklichkeitsgetreuen Abbildung der Vergangenheit geführt" (Felix 2002:9), dennoch bleibt der Bezug auf die historischen Gegebenheiten unabstreitbar (vgl. Interview on ROVE, 4:20). Gleichzeitig sind beide Filme sprudelnde Quellen zahlreicher Bezüge und Referenzen an Film, Schauspiel, "Medienkultur" (Felix 2002:9) und sich selbst als Medium, fungieren als "<Kultfilme> [...] in einem Spiel mit Zeichen und Zuschauer[,] [...] [die] die zunehmende Mediatisierung unserer Selbst und Weltbilder [reflektieren]" (9).
Dieses "[sichere] Spiel[,] [...] die Substitution vorgegebener, existierender und präsenter Stücke" (Derrida 1990:137) in der Produktion eines neuen Stückes und die Selbstwahrnehmung beider Werke als Medium, als Kunstwerk und als Film in einer Art "Hyperrealismus" (Felix 2002:9) sind die postmodernistischen, stilistischen Gemeinsamkeiten von "Reservoir Dogs" und "Inglourious Basterds", während ihre Verschiedenheiten auf inhaltlicher und geschichtlicher Ebene liegen. Die entscheidende Frage im Vergleich der beiden Filme bildet sich sehr schnell aus diesem Verhältnis – darf Tarantino das? Ist ihm das selbstreferentielle, mediatisierungsgeladene Spiel im Zeichen des Postmodernismus erlaubt, wenn die Tarantino-Welt, die er im Film damit aufbaut, auf einem historischen Ereignis solch dramatischen Ausmaßes wie des Zweiten Weltkrieges basiert?
Diese Hausarbeit wird die Darstellungsebenen von Fiktion und Wirklichkeit in einem kritischen Vergleich beider Filme ergründen, die Elemente Farbe, Musik, Schauspiel, Film und Zeichensprache im Netz der eigenen medialen Selbstwahrnehmung beider Filme einander gegenüberstellen, analysieren und dabei als Ausgangspunkt den postmodernistischen Ansatz nach dem "Zitat von Umberto Eco [verwenden]: dass die Vergangenheit auf neue Weise ins Auge gefasst werden muss – mit Ironie, ohne Unschuld, oder anders und aus dem Blickwinkel des Filmhistorikers gesagt: Nur wer die Geschichte kennt, versteht die Gegenwart!" (Felix 2002:10).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was wird dargestellt - Fiktion oder Wirklichkeit?
- Teil 1
- Teil 2
- Darf Der Das? - Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Darstellungsebenen von Fiktion und Wirklichkeit in Quentin Tarantinos Filmen "Reservoir Dogs" und "Inglourious Basterds" im Hinblick auf die postmodernen Ansätze Tarantinos. Dabei wird die mediale Selbstwahrnehmung beider Filme unter Betrachtung der Elemente Farbe, Musik, Schauspiel, Film und Zeichensprache analysiert.
- Analyse der Darstellungsebenen von Fiktion und Wirklichkeit in "Reservoir Dogs" und "Inglourious Basterds"
- Untersuchung der Selbstreferenzialität und der Medialisierung in Tarantinos Werken
- Erforschung der postmodernen Spielarten der Verwendung von Farbe, Musik und Schauspiel in den Filmen
- Bewertung der kritischen Auseinandersetzung mit historischen Ereignissen in "Inglourious Basterds"
- Interpretation der Interaktion von Fiktion und Realität durch die Nutzung von Zeichensprache
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die beiden Filme "Reservoir Dogs" und "Inglourious Basterds" von Quentin Tarantino vor und hebt ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervor. Es wird die Frage gestellt, inwieweit Tarantinos selbstreferentielles Spiel im Zeichen des Postmodernismus gerechtfertigt ist, insbesondere angesichts der Verwendung des Zweiten Weltkriegs in "Inglourious Basterds".
Was wird dargestellt - Fiktion oder Wirklichkeit? Teil 1
Dieser Abschnitt untersucht die Vermischung von Fiktion und Wirklichkeit in "Reservoir Dogs" und "Inglourious Basterds". Es wird analysiert, wie die Filme Referenzen auf reale Kultur und Ereignisse einbauen, um den Zuschauer in die Geschichte zu involvieren. Der Abschnitt beleuchtet auch den ironischen Effekt, der durch die Verwendung von Genre-Erwartungen entsteht.
Was wird dargestellt - Fiktion oder Wirklichkeit? Teil 2
Dieser Abschnitt setzt die Analyse der Darstellungsebenen von Fiktion und Wirklichkeit fort. Es werden verschiedene Beispiele aus den Filmen, wie das Frühstücksszenario in "Reservoir Dogs" und die "Rache des Riesengesichts"-Szene in "Inglourious Basterds", näher betrachtet. Der Abschnitt zeigt, wie Tarantino die Grenzen zwischen Fiktion und Realität bewusst verwischt und die mediale Selbstwahrnehmung des Zuschauers in Frage stellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter, die im Text eine zentrale Rolle spielen, sind Postmodernismus, Selbstreferenzialität, Medialisierung, Fiktion und Wirklichkeit, Zeichensprache, Film, und Kulturreferenzen. Diese Begriffe bilden den Kern der Analyse und helfen, die komplexe Beziehung zwischen Tarantinos Filmen und dem postmodernen Diskurs zu verstehen.
Häufig gestellte Fragen
Was macht Tarantinos Filme "postmodern"?
Postmodern sind vor allem die Selbstreferenzialität, das Spiel mit Filmzitaten (Intertextualität) und die Vermischung von Hoch- und Popkultur.
Darf Tarantino historische Ereignisse wie den Zweiten Weltkrieg fiktionalisieren?
Die Arbeit diskutiert kritisch, ob ein selbstreferentielles Spiel erlaubt ist, wenn es auf dramatischen Ereignissen wie dem Holocaust oder dem Zweiten Weltkrieg basiert.
Welche Rolle spielt die Musik in seinen Filmen?
Musik dient nicht nur der Untermalung, sondern ist oft ein ironisches oder kontrastierendes Element, das die mediale Selbstwahrnehmung des Films unterstreicht.
Was ist der Unterschied zwischen "Reservoir Dogs" und "Inglourious Basterds"?
Während "Reservoir Dogs" eine rein erfundene Kriminalgeschichte ist, bettet "Inglourious Basterds" seine Fiktion in einen realen historischen Kontext ein.
Was bedeutet "Selbstreferenzialität" bei Tarantino?
Es bedeutet, dass der Film sich selbst als Medium wahrnimmt und den Zuschauer ständig daran erinnert, dass er gerade ein Kunstwerk konsumiert.
- Quote paper
- Marc Backhaus (Author), 2013, Tarantinos Selbstreferentielle Welt im Zeichen des Postmodernismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229549