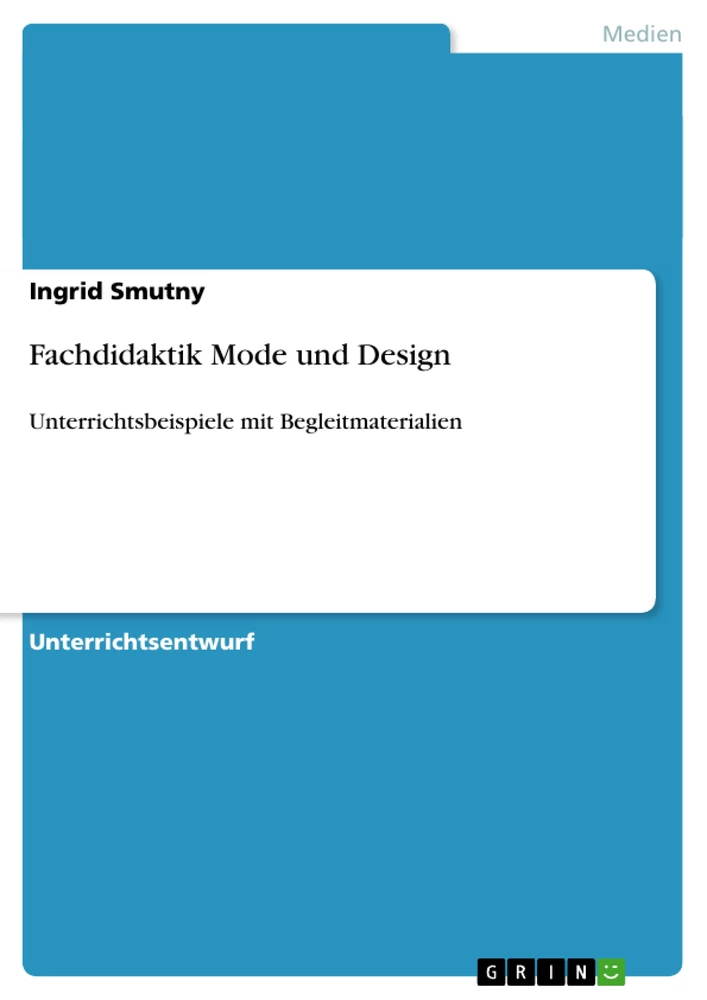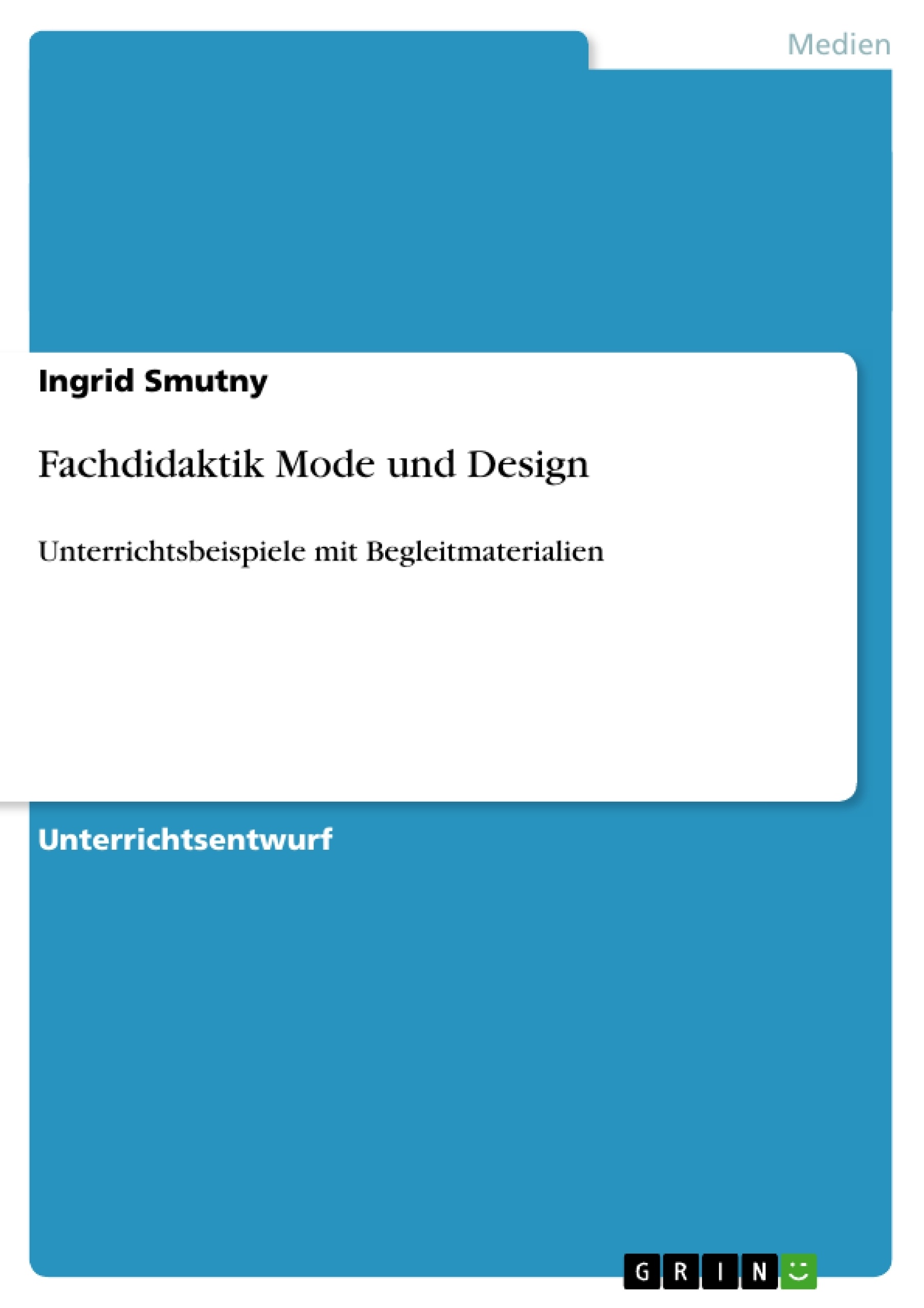Die vorliegende Unterlage beinhaltet Unterrichtsentwürfe für den Fachbereich Mode und Design.
Die Unterrichtsbeispiele sind für Fachschulen und für Höheren Lehranstalten für Mode erstellt und auch ausprobiert worden.
Die Schwerpunktsetzung der Modeschulen bedingt eine differente Sichtweise in der Tiefe der Lehrinhalte in den einzelnen Gegenständen.
Die Vorschläge erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind für die unterschiedlichen Schultypen, Ausbildungsschwerpunkte und Schulstufen durch geringfügige Veränderung einfach zu adaptieren.
Alle Unterrichtsentwürfe sind nach dem 4-Phasen-Modell nach Seel aufgebaut.
Bei allen Beispielen erhalten die Schülerinnen und Schülern zu Beginn der Unterrichtseinheit einen Überblick über den Stundenablauf und das Stundenziel, daher ist dies in den Beispielen nicht explizit beschrieben.
1 Vorwort
Die vorliegende Unterlage beinhaltet Unterrichtsentwürfe für den Fachbereich Mode und Design.
Die Unterrichtsbeispiele sind für Fachschulen und für Höheren Lehranstalten für Mode erstellt und auch ausprobiert worden.
Die Schwerpunktsetzung der Modeschulen bedingt eine differente Sichtweise in der Tiefe der Lehrinhalte in den einzelnen Gegenständen.
Die Vorschläge erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind für die unterschiedlichen Schultypen, Ausbildungsschwerpunkte und Schulstufen durch geringfügige Veränderung einfach zu adaptieren.
Alle Unterrichtsentwürfe sind nach dem 4-Phasen-Modell nach Seel[1] aufgebaut.
Bei allen Beispielen erhalten die Schülerinnen und Schülern zu Beginn der Unterrichtseinheit einen Überblick über den Stundenablauf und das Stundenziel, daher ist dies in den Beispielen nicht explizit beschrieben.
Viel Erfolg beim Ausprobieren!
Ingrid Smutny
Alle Entwürfe mit Begleitmaterialien dürfen ausschließlich für Unterrichtszwecke vervielfältigt werden
2 Aufbau der Beispiele
Jedes Beispiel besteht aus:
- Einem Überblick zum Stundenablauf (Unterrichtsentwurf) mit Inhalts- und Handlungsebene,
- der Methodenbeschreibung
- und dem verwendeten Begleitmaterial (Beschreibungen und Kopiervorlagen)
3 Überblick
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4 Beispiel 1 - Textiltechnologie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.1 Unterrichtsentwurf (Zeitrahmen 50 Minuten)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.2 Methodenbeschreibung
In dieser Lehreinheit werden mehrere Methoden eingesetzt um die Schüler/innen zu aktivieren. Der Stundeneinstieg erfolgt mittels Brainstorming, um die Inhalte der letzten Einheit zu wiederholen.
Pro und Contra:[2]
Im Hauptteil geht es um die Unterschiede der Edlen und er Wilden Seide.
Dazu wird eine Geschichte von der Lehrperson vorgelesen (siehe Begleitmaterial) die eine Diskussion über die Eigenschaften der Seide auslösen soll.
Die Schülerinnen ziehen eine Karte mit einem Farbpunkt (rot, blau und grün), und bilden pro Farbe eine Gruppe.
Gruppe blau: Vertreter/innen des Wildseidenproduzenten
Gruppe grün: Vertreter/innen des Maulbeerseidenproduzenten
Gruppe rot: Berater/innen der Prinzessin (Lehrer/in)
Die Schüler/innen (blau und grün) haben nun 10 Minuten Zeit um die Aufgabenstellung (siehe Begleitmaterial) zu lesen, einen Gruppensprecher zu wählen und sich Argumente zu überlegen.
Die Schüler/innen (rot) haben ebenfalls 10 Minuten Zeit um Parameter für den Kaiserlichen Bewertungsbogen (siehe Begleitmaterial) zu erstellen, und einen Berater zu bestimmen.
Nun setzen sich die Sprecher aus der Gruppe der Produzenten der Prinzessin gegenüber und der Sprecher der Beratergruppe sitzt seitlich um Informationen auch flüstern zu können.
Hinter den Sprechern sitzen die restlichen Gruppenmitglieder, die während der Argumentation/Diskussion ihrem Sprechen schriftliche Argumente/Infos auf Kärtchen geben dürfen – es darf aber nicht laut gesprochen werden.
Die Lehrperson beginnt die Diskussion mit einem Sprecher der Produzenten durch eine Fragestellung. Sie kann die Diskussion in die richtige Richtung lenken hält sich aber auch nach den Vorgaben des Beraters. Ist der Zeitrahmen verbraucht gibt die Lehrperson (Prinzessin) das Ergebnis/ihre Entscheidung bekannt.
Zum Abschluss ist noch ein Arbeitsblatt zu Festigung des Wissens geplant - die wesentlichsten Unterschiede werden schriftlich festgehalten.
4.3 Begleitmaterial: Kopiervorlagen
Wildseide
Sie sind Wildseidenproduzent und haben von Ihrer Prinzessin eine Ausschreibung bekommen. Die Prinzessin möchte sich als Modedesignerin versuchen. Sie hat die Idee, dass sie eine reine Seidenkollektion entwirft. Als Unternehmer haben Sie sofort einen Termin mit der Prinzessin vereinbart, denn das könnte das Geschäft Ihres Lebens werden. Sie würden dabei nicht nur einen riesen Gewinn machen, sondern auch Ihr Ansehen würde weltweit enorm steigen.
Im Vorfeld haben Sie bereits erfahren, dass es nur einen Konkurrenten gibt. Dieser produziert Maulbeerseide. Sie treffen also noch schnell letzte Maßnahmen, um sich auf Ihr Treffen mit der Prinzessin vorzubereiten:
- Finden Sie so viele Argumente wie möglich, warum die Prinzessin Ihr Produkt kaufen soll.
- Um richtig vorbereitet zu sein, können Sie auch die Konkurrenz analysieren. Finden Sie Argumente wieso Wildseide besser für die Kollektion der Prinzessin sein könnte (Sie dürfen dabei kreativ sein).
- Am Hof gibt es besondere Sitten: Generell gilt am Hof ein allgemeines Sprechverbot. Bei Anlässen wie diesen ist es üblich, dass nur eine Person mit der Prinzessin sprechen darf. Bestimmen Sie also innerhalb der Gruppe einen Sprecher.
- Die anderen Gruppenmitglieder dürfen dem Sprecher während des Meetings Kärtchen überreichen. Auf die Kärtchen können während des Treffens noch „neue“ Informationen bzw. Argumente geschrieben werden.
- Sie haben 10 Minuten Vorbereitungszeit: Teilen Sie die Aufgaben untereinander auf.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 Siegel der Wildseide
Maulbeerseide
Sie sind Maulbeerseidenproduzent und haben von Ihrer Prinzessin eine Ausschreibung bekommen. Die Prinzessin möchte sich als Modedesignerin versuchen. Sie hat die Idee, dass sie eine reine Seidenkollektion entwirft. Als Unternehmer haben Sie sofort einen Termin mit der Prinzessin vereinbart, denn das könnte das Geschäft Ihres Lebens werden. Sie würden dabei nicht nur einen riesen Gewinn machen, sondern auch Ihr Ansehen würde weltweit enorm steigen.
Im Vorfeld haben Sie bereits erfahren, dass es nur einen Konkurrenten gibt. Dieser produziert Wildseide. Sie treffen also noch schnell letzte Maßnahmen, um sich auf Ihr Treffen mit der Prinzessin vorzubereiten:
- Finden Sie so viele Argumente wie möglich, warum die Prinzessin Ihr Maulbeerseide für ihre Kollektion verwenden soll.
- Um richtig vorbereitet zu sein, können Sie auch die Konkurrenz analysieren. Finden Sie Argumente wieso Maulbeerseide besser für die Kollektion der Prinzessin sein könnte (Sie dürfen dabei kreativ sein).
- Am Hof gibt es besondere Sitten: Generell gilt am Hof ein allgemeines Sprechverbot. Bei Anlässen wie diesen ist es üblich, dass nur eine Person mit der Prinzessin sprechen darf. Bestimmen Sie also innerhalb ihrer Gruppe einen Sprecher.
- Die anderen Gruppenmitglieder dürfen dem Sprecher während des Meetings Kärtchen überreichen. Auf die Kärtchen können während des Treffens noch „neue“ Informationen bzw. Argumente geschrieben werden.
- Sie haben 10 Minuten Vorbereitungszeit: Teilen Sie die Aufgaben untereinander auf.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Seidensiegel
Berater
Sie sind Berater am königlichen Hof und vor allem für wirtschaftliche Entscheidungen zuständig. Die Prinzessin möchte sich als Modedesignerin versuchen. Sie hat die Idee, eine reine Seidenkollektion zu entwerfen. Dafür hat sie bereits einen Termin mit den zwei größten Seidenproduzenten des Landes (Maulbeerseide und Wildseide) vereinbart. Der König hat Sie gebeten, der Prinzessin bei der Entscheidung mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Da Sie weder Kaiser noch Prinzessin enttäuschen wollen, bereiten sie sich gut für das Treffen vor:
- Erstellen Sie ein Bewertungsschema für die Maulbeerseide und Wildseide:
- Finden Sie Parameter, mit denen die Seiden verglichen werden können
- Vergeben Sie eine Höchstpunkteanzahl für die einzelnen Parameter
- Am Hof gibt es besondere Sitten: Generell gilt am Hof ein allgemeines Sprechverbot. Bei Anlässen wie diesen ist es üblich, dass nur ein einziger Berater die Prinzessin mit Fragen an die Produzenten unterstützen darf. Bestimmen Sie also innerhalb der Gruppe einen Sprecher.
- Die anderen Gruppenmitglieder dürfen dem Sprecher während des Meetings Kärtchen überreichen. Auf die Kärtchen können während des Treffens noch neue bzw. wichtige Fragen geschrieben werden.
- Die anderen Gruppenmitglieder bewerten während dem Meeting die Aussagen der Produzenten. Anschließend müssen Sie Ihre Entscheidung für einen Produzenten bekannt geben.
- Sie haben 10 Minuten Vorbereitungszeit: Teilen Sie die Aufgaben untereinander auf.
Kaiserlicher Bewertungsbogen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Eigene Tabelle
Gegenüberstellung _ Arbeitsblatt
Maulbeerseide - Wildseide
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Eigene Tabelle
Gegenüberstellung _ Arbeitsblatt/Lösung
Maulbeerseide - Wildseide
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3: EigeneTabelle
5 Beispiel 2 - Textiltechnologie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.1 Unterrichtsentwurf (Zeitrahmen 50 Minuten)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.2 Methodenbeschreibung
- Der Einstieg der Unterrichtsstunde basiert visuell durch Anschauungsmaterialien aus Funktionstextilen. Die Schülerinnen und Schüler werden auf ihrem Wissensstand abgeholt, bzw. können auf vorhandenem Wissen aufbauen.
- Auf Grund eigener Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler werden die Eigenschaften im Gespräch erarbeitet.
- Versuch1: Verhalten von Baumwoll-Polyester Stoffen und Transtex-Stoffen bei
Kontakt mit Wasser = Verhalten von Funktionsmaterialen
- Versuch2: Handwärmer PCM wird flüssig und erzeugt Wärme
PCM wird fest und gibt die gespeicherte Wärme ab
5.3 Begleitmaterial: Kopiervorlagen
5.3.1 Lückentext - Aufgabe
TEXTILIEN MIT BESONDEREN FUNKTIONEN
Setzen Sie die folgenden Wörter (bzw. Wortteile) in die Lücken im Text:
Ausrüstung chemische Gewebekonstruktionen abgeben Hohlraum Kapillarwirkung Käfigmoleküle textilen Mikrokapseln Sonnenschutz Waschvorgang Bakterien Temperaturunterschiede Umgebungsluft Wärme Zellulosefasern Zweischichtkonstruktionen auffangen Hohlraum Käfigmoleküle Temperaturbereich
TEXTILIEN MIT FEUCHTIGKEITSTRANSPORT:
Für Alltagssituationen, in denen nur wenig geschwitzt wird, eignen sich ______________________________ wie Baumwolle oder Viskose. Sie saugen den Schweiß auf und leiten ihn ab. Beim Sport oder im Sommer haben sich _____________________________________ bewährt. Eine Feuchtigkeitstransportierende Schicht wird auf der Haut getragen – die selbst keine Feuchtigkeit aufnimmt. Durch ____________________________ wird der Schweiß auf die Außenseite der Textilien transportiert und dort in eine zweite Schicht aufgesaugt, welche die Feuchtigkeit speichert. Diese Feuchtigkeit wird dann langsam an die __________________________ abgegeben.[3]
TEXTILIEN MIT THERMOREGULIERUNG (PCM):
„Textilien mit schoeller®-PCM™ enthalten unzählige winzige ________________________ , die mit Phase Change Materials (PCM) gefüllt sind. Diese Mikrokapseln reagieren auf __________________________________, indem sie ihren Aggregatzustand verändern - von fest zu flüssig und umgekehrt. Dabei ist das PCM in den Kapseln auf einen bestimmten ___________________ eingestellt. Erhöht sich die Körper- oder Umgebungstemperatur, speichern die Kapseln überflüssige ____________, sinkt die Temperatur wieder, geben sie die gespeicherte Wärme wieder an den Körper ab.“[4]
TEXTILIEN MIT SCHUTZ VOR UV-STRAHLEN:
Da UV-Strahlen Krebs erzeugen können ist ein Sonnenschutz wichtig. Abgesehen davon, sich einzucremen, gibt es auch einen ________________ ________________________. Zum Beispiel werden UV-Strahlen durch dichte ________________________________________, __________________ ______________________ oder durch Einlagerung von Pigmenten absorbiert oder reflektiert.
TEXTILIEN MIT GERUCHSBINDUNG:
__________________ führen häufig zu gesundheitlichen Problemen oder können zu üblem Geruch führen. Moleküle mit einem Hohlraum, sogenannte ______________________________ , die auf Textilien fixiert werden, können Gerüche im Hohlraum __________________ , binden und auch wieder ______________ . Wollen sich also unangenehme Gerüche an solchen Textilien festsetzen, werden sie von dem ________________ aufgenommen und neutralisiert. Beim nächsten ________________________ werden sie dann aus den Hohlräumen entfernt. In diesen Käfigmolekülen können auch Duft- oder Pflegesubstanzen eingelagert werden, die durch Wärme oder Feuchtigkeit abgegeben werden.
Gutes Gelingen! J
5.3.2 Lückentext - Lösung
LÜCKENTEXT - LÖSUNG
TEXTILIEN MIT BESONDEREN FUNKTIONEN
TEXTILIEN MIT FEUCHTIGKEITSTRANSPORT:
Für Alltagssituationen, in denen nur wenig geschwitzt wird, eignen sich Zellulosefasern wie Baumwolle oder Viskose. Sie saugen den Schweiß auf und leiten ihn ab. Beim Sport oder im Sommer haben sich Zweischichtkonstruktionen bewährt. Eine Feuchtigkeitstransportierende Schicht wird auf der Haut getragen – die selbst keine Feuchtigkeit aufnimmt. Durch Kapillarwirkung wird der Schweiß auf die Außenseite der Textilien transportiert und dort in eine zweite Schicht aufgesaugt, welche die Feuchtigkeit speichert. Diese Feuchtigkeit wird dann langsam an die Umgebungsluft abgegeben.[5]
TEXTILIEN MIT THERMOREGULIERUNG (PCM):
„Textilien mit schoeller®-PCM™ enthalten unzählige winzige Mikrokapseln, die mit Phase Change Materials (PCM) gefüllt sind. Diese Mikrokapseln reagieren auf Temperaturunterschiede, indem sie ihren Aggregatzustand verändern - von fest zu flüssig und umgekehrt. Dabei ist das PCM in den Kapseln auf einen bestimmten Temperaturbereich eingestellt. Erhöht sich die Körper- oder Umgebungstemperatur, speichern die Kapseln überflüssige Wärme sinkt die Temperatur wieder, geben sie die gespeicherte Wärme wieder an den Körper ab.“[6]
TEXTILIEN MIT SCHUTZ VOR UV-STRAHLEN:
Da UV-Strahlen Krebs erzeugen können ist ein Sonnenschutz wichtig. Abgesehen davon, sich einzucremen, gibt es auch einen textilen Sonnenschutz. Zum Beispiel werden UV-Strahlen durch dichte Gewebekonstruktionen,
chemische Ausrüstung oder durch Einlagerung von Pigmenten absorbiert oder reflektiert.
TEXTILIEN MIT GERUCHSBINDUNG:
Bakterien führen häufig zu gesundheitlichen Problemen oder können zu üblem Geruch führen. Moleküle mit einem Hohlraum, sogenannte Käfigmoleküle, die auf Textilien fixiert werden, können Gerüche im Hohlraum auffangen, binden und auch wieder abgeben. Wollen sich also unangenehme Gerüche an solchen Textilien festsetzen, werden sie von dem Hohlraum aufgenommen und neutralisiert. Beim nächsten Waschvorgang werden sie dann aus den Hohlräumen entfernt. In diesen Käfigmolekülen können auch Duft- oder Pflegesubstanzen eingelagert werden, die durch Wärme oder Feuchtigkeit abgegeben werden.
5.3.3 Folien
TEXTILIEN MIT FEUCHTIGKEITSTRANSPORT
Zweischichtkonstruktion
1. INNERE SCHICHT:
leitet den Schweiß von der Haut
an die Außenschicht
2. ÄUSSERE SCHICHT:
saugt Feuchtigkeit auf und
lässt sie verdunsten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Zwei-Schicht - Konstruktion
TEXTILIEN MIT THERMOREGULIERUNG
Phase Change Materials
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: PCM Material
TEXTILIEN MIT SCHUTZ VOR UV-STRAHLEN
Etikett der Firma Hohenstein
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: UV Standard
TEXTILIEN MIT GERUCHSBILDUNG
Trevira Bioactive®
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
TEXTILIEN MIT NANOTECHNOLOGIE
Oberfläche - Lotuseffekt
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Nanotechnologie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Lotusblüte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9: Nanotechnologie
6 Beispiel 3 - Textiltechnologie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6.1 Unterrichtsentwurf (Zeitrahmen 50 Minuten)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6.2 Methodenbeschreibung
Phase 1:
Die Lehrer/In erklärt am Anfang der Stunde den Arbeitsauftrag und Ablauf der Stunde:
Phase 2:
Die Schüler/innen der Klasse werden durch Ziehen verschiedener Stoffproben aus einer Box, zu Gruppen a 4 Personen. Diese erhalten jeweils einen Begleittext zu der jeweiligen Faser, die aus der Box gezogen wurde, ein leeres Stoffprobenblatt und den Arbeitsauftrag. Den Schülern wird nicht verraten, um welche Faser es sich handelt, dies gilt im Laufe der Stunde für jedes Team herauszufinden, indem sie die richtigen Antworten zu den Fragen finden und am Ende das Lösungswort erhalten.
Gleichzeitig zum Beantworten der Fragen ist das Stoffprobenblatt als Lösungsblatt auszufüllen – nach Beantwortung der ersten 4 Fragen, kontrolliert die Lehrperson die Lösungen am Stoffprobenblatt und korrigiert (falls nötig) bzw. teilt die nächsten Fragen aus.
Die Kleingruppen werden zu Experten – sie haben für die Beantwortung aller Fragen und das Ausfüllen ihrer Spalte am Stoffprobenblatt ca. 15 Minuten Zeit.
Nachdem das Lösungswort (es ist der Name der Faser), gefunden wurde trennen sich die Kleingruppen und bilden Mischgruppen. Nun sitzt an jedem Tisch ein Experte der über eine ganz bestimmte Chemiefaser Bescheid weiß.
Phase 3:
Jetzt sind die Experten an der Reihe sich nacheinander die wichtigsten Merkmale ihrer Faser mitzuteilen und die Zuhörer sind dazu aufgefordert, diese Punkte in ihrem Stoffprobenblatt einzutragen. Diese Phase dauert ca. 15 Minuten.
Festigungsphase:
In den letzten 10 Minuten der Stunde vergleichen die Schüler/innen gemeinsam mit der Lehrperson und einer Powerpointfolie, das ausgefüllte Stoffprobenblatt und können evtl. Fehlendes ergänzen. Die Lehrperson erklärt gewisse Eigenschaften und wichtigen Merkmale der Faser in der Festigungsphase eingehender und stellt den Schüler/innen auch noch gezielt Fragen, die sie jeweils in der Gruppe beantworten können.[7]
6.2.1 Begleitmaterial: Kopiervorlagen (Aufgaben mit Lösungen)
Arbeitsauftrag (Lösung in blau)
Beantworten Sie die folgenden Fragen in Partnerarbeit mit Hilfe des Informationstextes zu der jeweiligen gesuchten Faser, welchen Sie bekommen haben. Sie beginnen mit den ersten 4 Fragen und erhalten die weiteren Fragen immer erst, wenn die Fragen richtig beantwortet wurden.
Für 4 richtige Antworten erhalten Sie also die weiteren Fragen und am Ende dann das Lösungswort.
Viel Spaß beim Lösen der Aufgaben J
1. Aus welchem Rohstoff/ welchen Rohstoffen wird die gesuchte Faser hergestellt?
Erdöl, Steinkohle
2. Wie werden die Molekülketten der gesuchten Faser gebildet?
Polymerisation, Polykondensation, Polyaddition
3. Die Herstellung der gesuchten Faser erfolgt mit Hilfe des dargestellten Spinnverfahrens – wie heißt es?
Schmelzspinnverfahren, Nassspinnverfahren, Trockenspinnverfahren
4. Welche unterschiedlichen Formen der gesuchten Faser werden hergestellt?
Filamente, Filamentgarne, Spinnfasern, Mikrofasern
5. 3 wichtige Eigenschaften sind in der Tabelle auf dem Stoffsammlungsblatt bereits vorgegeben – beschreiben Sie die Eigenschaften mit Hilfe des Informationsblattes!
Beschreibungen unterschiedlich
6. Welche sonstigen Eigenschaften weist die gesuchte Faser auf?
Wählen Sie noch 2 weitere Fasermerkmale die Ihnen wichtig erscheinen und ergänzen Sie die Tabelle!
Abhängig vom gezogenen Fasermaterial
7. Was bedeutet der Begriff „pflegeleicht“? Erläutern Sie den Begriff in Stichworten!
Waschbar in der Waschmaschine, schnell trocknend, weitgehend bügelfrei
8. Nennen Sie 1 – 2 gängige Handelsbezeichnungen der gesuchten Faser!
Je nach Faser unterschiedlich
6.2.2 Expertentext 1
Um die gesuchte Faser herzustellen werden hauptsächlich aus den Rohstoffen Erdöl und Steinkohle chemische Verbindungen synthetisiert.
Die Molekülkettenbildung erfolgt mit Hilfe von Polykondensation oder auch Polymerisation. Dadurch ergeben sich zwei Substanzen, die für die Erzeugung zweier verschiedener Fasertypen benötigt werden.
Die eigentliche Herstellung der Filamente (Endlosfäden) erfolgt nach dem Schmelzspinnverfahren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 10: Schmelzspinnverfahren
Der Ausgangsstoff wird geschmolzen und die so entstandene Spinnmasse wird durch Düsen gepresst. Die austretenden Filamente erstarren im Kaltluftstrom und werden anschließend verstreckt.
Die Faser wird überwiegend als Filamentgarn (Endlosgarn) hergestellt, wobei auch Spinnfasern (d.h. geschnittene Endlosfäden) und Mikrofasern produziert werden.
Bei der Herstellung der Filamente können auch die bekleidungsphysiologischen Eigenschaften beeinflusst werden: glatte Filamente schließen kaum Luft ein und isolieren daher schlecht – texturierte (gekräuselte) Filamente sorgen aufgrund der eingeschlossenen Luft für ein gutes Wärmerückhaltevermögen.
Die Feuchtigkeitsaufnahme ist, wie bei allen synthetischen Chemiefasern, gering.
Im textilen Bereich zeichnet sich die Faser auch durch die höchste Reißfestigkeit, sowohl im nassen als auch im trockenen Zustand, aus.
Scheuerfestigkeit und Elastizität der Faser sind sehr hoch und die Formbarkeit der Faser ist thermoplastisch d. h. sie kann unter Wärmeeinfluss und Druck (Bügeln) permanent verformt werden z.B. Falten und Plissees.
Eher schlecht ist die Lichtbeständigkeit der Faser, da sie zum Vergilben neigt und intensive Sonneneinstrahlung die Faser schwächt – daher ist sie nicht für die Herstellung von Vorhängen geeignet.
Im Handel findet man die Filamentgarne und Spinnfasern häufig unter der Bezeichnung Nylon oder Perlon und die Einsatzgebiete der Faser sind sehr vielseitig: Für Strick- und Webwaren, die besonders strapaziert werden – von Strumpfhosen bis hin zu Teppichen – rein oder in Mischung mit anderen Fasern.
Auch wird die Faser für die Produktion von Kleider-, Blusen- und Futterstoffen verwendet und man findet sie häufig in der Freizeit-, Sport- und Badebekleidung, bei Unterwäsche aber auch in der Produktion von Regenbekleidung und Schirmen.
[...]
[1] Seel 1999, S. 2-11
[2] Vgl.: Hugenschmidt; Technau, 2010, S.141 ff
[3] Vgl.:http://shop.laufshirt-discounter.net/Laufbekleidung
[4] http://www.schoeller-textiles.com/technologien/schoeller-pcm.html
[5] Vgl.:http://shop.laufshirt-discounter.net/Laufbekleidung
[6] http://www.schoeller-textiles.com/technologien/schoeller-pcm.html
[7] Vgl: Huber 2012, S29 ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das 4-Phasen-Modell nach Seel?
Es ist ein didaktisches Modell zur Unterrichtsplanung, das in Einstieg, Erarbeitung, Übung und Ergebnissicherung unterteilt ist.
Wie wird das Thema Seide im Unterricht behandelt?
Durch eine Rollenspiel-Methode ("Pro und Contra"), bei der Schüler als Produzenten von Wildseide oder Maulbeerseide argumentieren.
Was sind "Funktionstextilien"?
Textilien mit speziellen Eigenschaften wie Feuchtigkeitstransport oder Wärmeregulierung, die in dieser Fachdidaktik durch Experimente untersucht werden.
Für welche Schultypen sind die Entwürfe gedacht?
Sie sind speziell für Fachschulen und Höhere Lehranstalten für Mode (HLM) konzipiert.
Welche Rolle spielt das "Kaiserliche Bewertungsschema"?
Es dient im Rollenspiel als Instrument für die "Berater", um die Argumente der verschiedenen Seidenproduzenten objektiv zu vergleichen.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Päd. Ingrid Smutny (Autor:in), 2013, Fachdidaktik Mode und Design, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229562