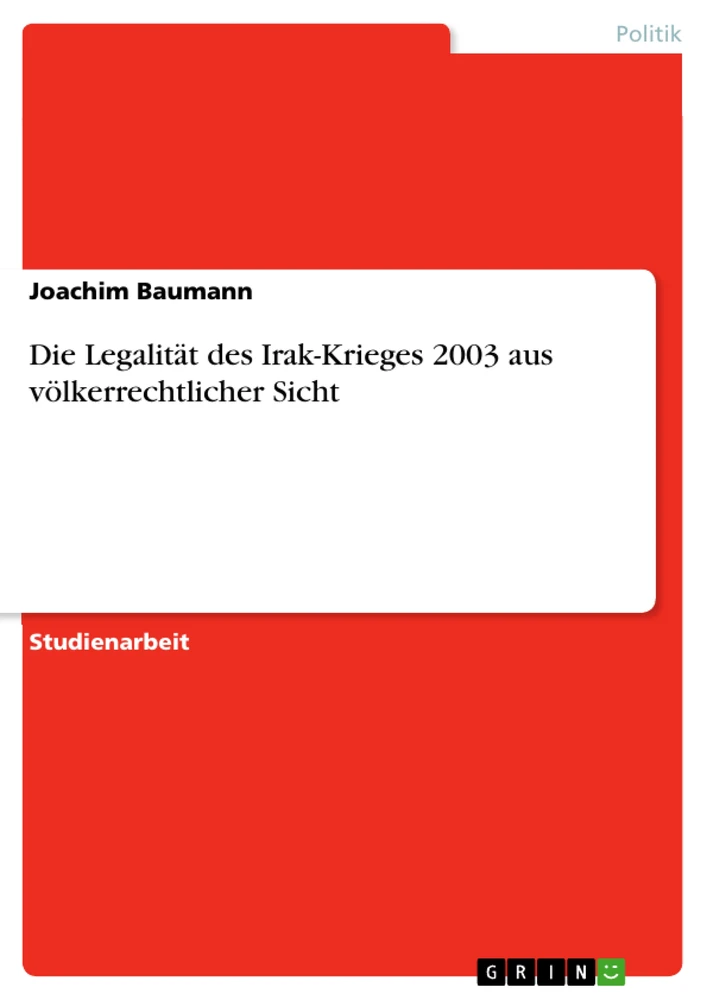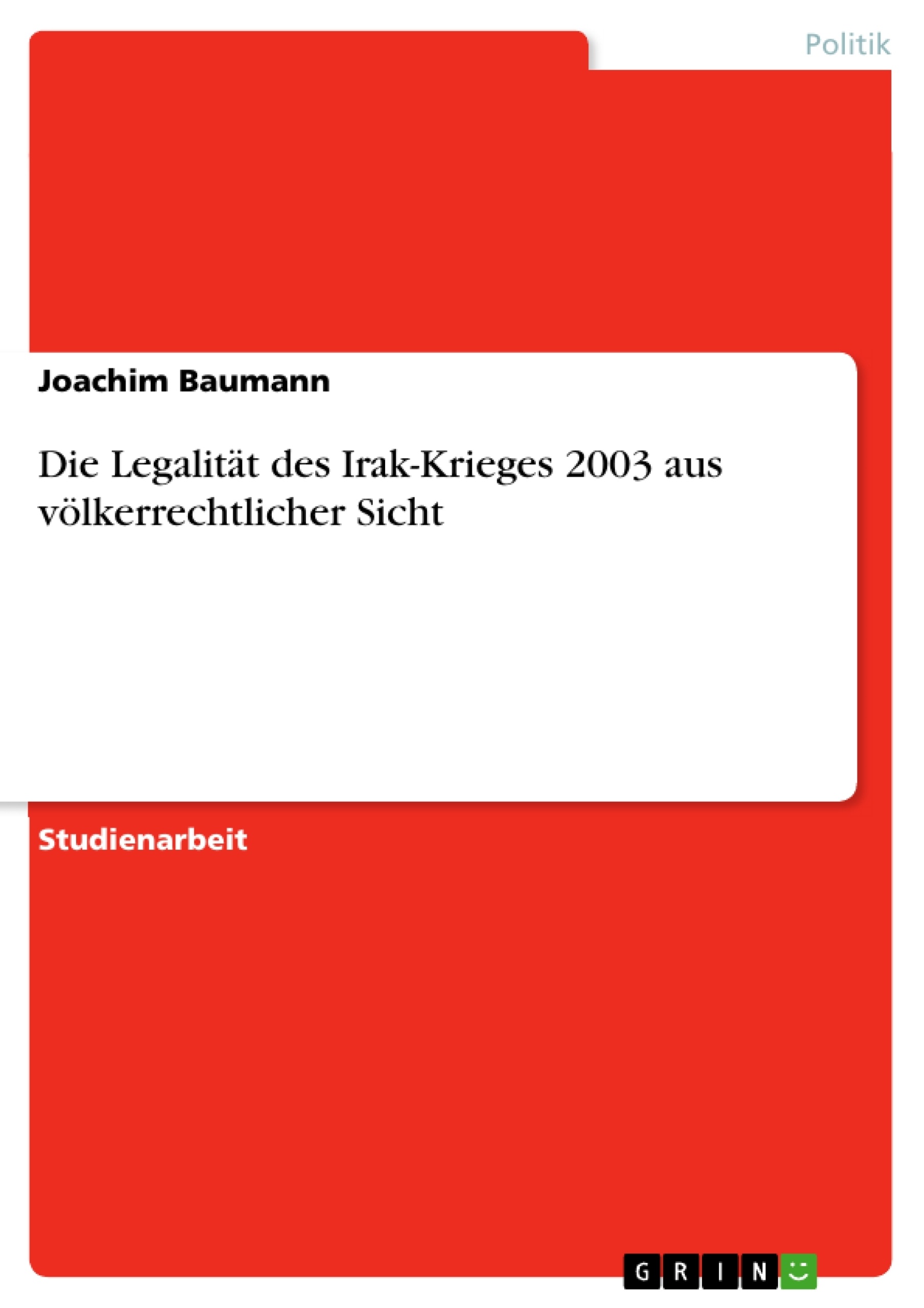Ein Jahr nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center und das Pentagon wurde von der Bush-Administration die Neue Nationale Sicherheitsstrategie (NSS) veröffentlicht, die eine Antwort auf die neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen darstellen sollte. Den Kern dieser Strategie bildet das Konzept der „vorbeugenden Selbstverteidigung“, in der sich die USA ein Recht auf Präventivkriegsführung vorbehalten. Ein präventives Selbstverteidigungsrecht gegen so genannte „Schurkenstaaten“ und Terroristen bildet laut amerikanischer Vorstellungen neben den Strategien von „containment“ und „deterrence“ eine legitime Grundlage in der „Bush-Doktrin“.
In den Militärschlägen gegen den Irak im Jahr 2003 machten die USA mit Unterstützung anderer Staaten ihre neuen Sicherheitsvorstellungen deutlich. Ziel dieses Krieges war der Sturz des irakischen Diktators Saddam Hussein, dem der Besitz von Massenvernichtungswaffen und Verbindungen zum Terrornetzwerk Al Qaida vorgeworfen wurden. Der Feldzug wurde ohne Mandat der Vereinten Nationen durchgeführt und löste weltweit heftige Debatten über seine Rechtmäßigkeit aus. Während Kritiker die Aktion als Widerspruch zu den Normen der UN-Charta und zum geltenden Völkerrecht werteten, stützten sich Befürworter auf das in der UN-Charta verankerte Selbstverteidigungsrecht. Die amerikanische bzw. britische Regierung rechtfertigte den Irakkrieg zu Beginn des Konfliktes auf zwei Arten: Erstens mithilfe des Selbstverteidigungsrechts gemäß Art. 51 der UN-Charta, indem die vermuteten Massenvernichtungswaffen und die angebliche Verbindung zum Terrornetzwerk Al Qaida des irakischen Regimes als eine Bedrohung dargestellt wurden. Die angemessene Antwort auf diese Bedrohung wäre laut USA und Großbritannien ein Krieg gegen den Irak als vorbeugende Selbstverteidigung. Zweitens könne eine Autorisierung für einen Krieg aus den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates abgeleitet werden, gemäß Kapitel VII der UN-Charta.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, der Frage nachzugehen, ob es sich bei den Militärschlägen gegen den Irak 2003 um eine legale Vorgehensweise von Seiten der USA und deren Verbündeten handelte. Es soll grundsätzlich untersucht werden, inwieweit die Rechtfertigungen der „coalition of the willing“ einer völkerrechtlichen Prüfung standhalten können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Völkerrechtliche Aspekte
- Rechtfertigung des Militärschlages nach Art. 51 der UN-Charta
- Der Besitz von Massenvernichtungswaffen
- Die Verbindung zum Terrornetzwerk Al Qaida
- Rechtfertigung über Kap. VII der UN-Charta
- Resolution 678 vom 28.11.1990 und 687 vom 03.04.1991
- Resolution 1441 vom 08.11.2002
- Entmachtung des Regimes
- Humanitäre Gründe
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Legalität des Irakkrieges von 2003 aus völkerrechtlicher Sicht. Sie untersucht, ob die Militärschläge der USA und ihrer Verbündeten im Einklang mit den Normen des Völkerrechts standen. Die Arbeit analysiert die Rechtfertigungen der "coalition of the willing" im Hinblick auf das Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 der UN-Charta und die Anwendung von Kapitel VII der UN-Charta.
- Rechtfertigung des Irakkrieges durch das Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 der UN-Charta
- Rechtfertigung des Irakkrieges durch Kapitel VII der UN-Charta
- Das Argument des Regimewechsels im Irak
- Humanitäre Gründe als potenzielle Rechtfertigung
- Die Bedeutung der UN-Charta für das Völkerrecht und die Anwendung von Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit beginnt mit der Darstellung der neuen Sicherheitsstrategie der Bush-Administration nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und dem Konzept der „vorbeugenden Selbstverteidigung“. Sie führt den Irakkrieg 2003 als Beispiel für die Anwendung dieser Strategie ein und skizziert die Rechtfertigungsargumente der USA und Großbritanniens. Das Ziel der Arbeit ist es zu analysieren, ob der Irakkrieg völkerrechtlich gerechtfertigt war.
Völkerrechtliche Aspekte
Dieses Kapitel behandelt die wichtigsten völkerrechtlichen Aspekte im Zusammenhang mit dem Irakkrieg, insbesondere das Gewaltverbot nach Artikel 2(4) der UN-Charta und die Ausnahmen des Selbstverteidigungsrechts (Artikel 51) und der Anwendung von Kapitel VII der UN-Charta.
Rechtfertigung des Militärschlages nach Art. 51 der UN-Charta
Hier wird untersucht, ob sich die USA und Großbritannien auf das Selbstverteidigungsrecht berufen konnten. Die Argumente des Besitzes von Massenvernichtungswaffen und der Verbindung zum Terrornetzwerk Al Qaida werden analysiert.
Rechtfertigung über Kap. VII der UN-Charta
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob eine Autorisierung für den Irakkrieg aus den Resolutionen des Sicherheitsrates abgeleitet werden konnte. Die Resolutionen 678, 687 und 1441 werden im Kontext der Rechtfertigung des Krieges untersucht.
Entmachtung des Regimes
Dieses Kapitel beleuchtet das Argument des Regimewechsels im Irak als weiteres Motiv für den Krieg. Die USA und Großbritannien argumentierten, dass der Sturz Saddam Husseins notwendig war, um die Bedrohung durch den Irak zu beseitigen.
Humanitäre Gründe
Dieses Kapitel geht kurz auf die Möglichkeit einer Rechtfertigung des Irakkrieges aus humanitären Gründen ein, obwohl es sich nicht um eine humanitäre Intervention im klassischen Sinne handelte.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Irakkrieg, Völkerrecht, UN-Charta, Selbstverteidigungsrecht, Kapitel VII, Massenvernichtungswaffen, Al Qaida, Regimewechsel, humanitäre Intervention, „coalition of the willing“. Diese Begriffe reflektieren die zentralen Themen der Arbeit und die völkerrechtlichen Aspekte, die bei der Bewertung der Rechtmäßigkeit des Irakkrieges eine Rolle spielen.
Häufig gestellte Fragen
War der Irak-Krieg 2003 völkerrechtlich legal?
Die Arbeit untersucht diese kontroverse Frage und analysiert, ob die Militärschläge ohne UN-Mandat mit dem Völkerrecht vereinbar waren oder das Gewaltverbot der UN-Charta verletzten.
Was besagt das Konzept der „vorbeugenden Selbstverteidigung“?
Dieses Konzept der Bush-Doktrin sieht ein Recht auf Präventivschläge gegen „Schurkenstaaten“ vor, um potenzielle Bedrohungen abzuwenden, bevor ein Angriff stattfindet.
Wie wurde der Krieg mit Artikel 51 der UN-Charta begründet?
Die USA und Großbritannien argumentierten, dass der vermutete Besitz von Massenvernichtungswaffen und Verbindungen zu Al-Qaida eine unmittelbare Bedrohung darstellten, die ein Selbstverteidigungsrecht auslöste.
Welche Rolle spielten die UN-Resolutionen 678 und 1441?
Befürworter des Krieges versuchten, eine Autorisierung aus früheren Resolutionen abzuleiten, während Kritiker anführten, dass diese kein automatisches Recht zur Gewaltanwendung ohne erneuten Beschluss gaben.
Galt der Sturz Saddam Husseins als legitimer Kriegsgrund?
Ein „Regimewechsel“ ist im Völkerrecht grundsätzlich kein anerkannter Grund für eine militärische Intervention, wurde aber politisch als notwendige Maßnahme zur Beseitigung einer Bedrohung angeführt.
- Citar trabajo
- Joachim Baumann (Autor), 2008, Die Legalität des Irak-Krieges 2003 aus völkerrechtlicher Sicht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229567