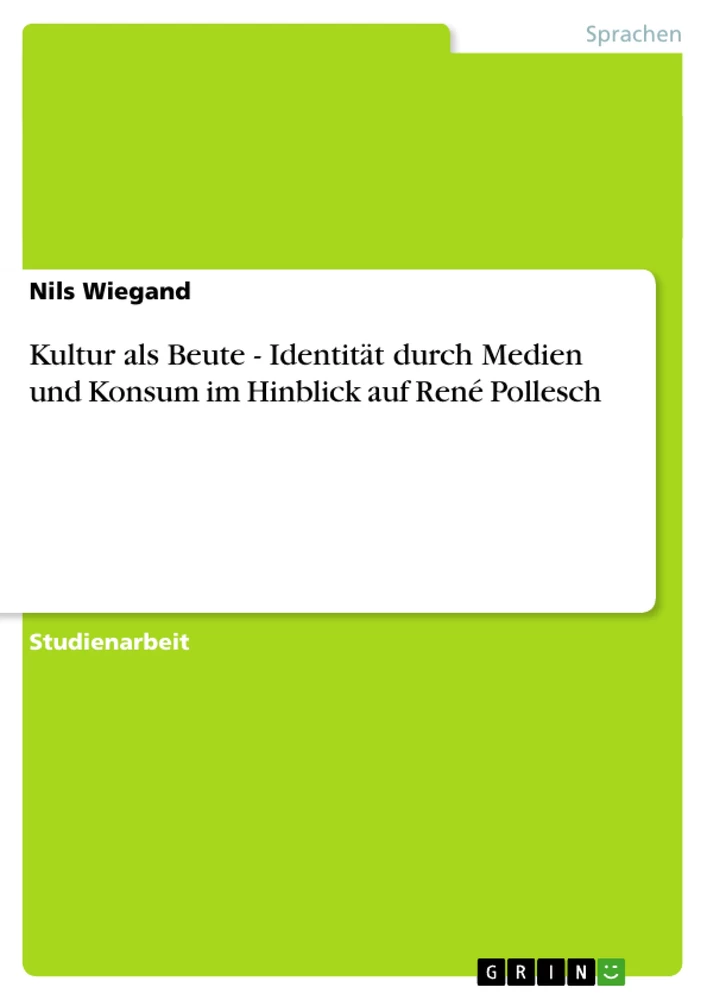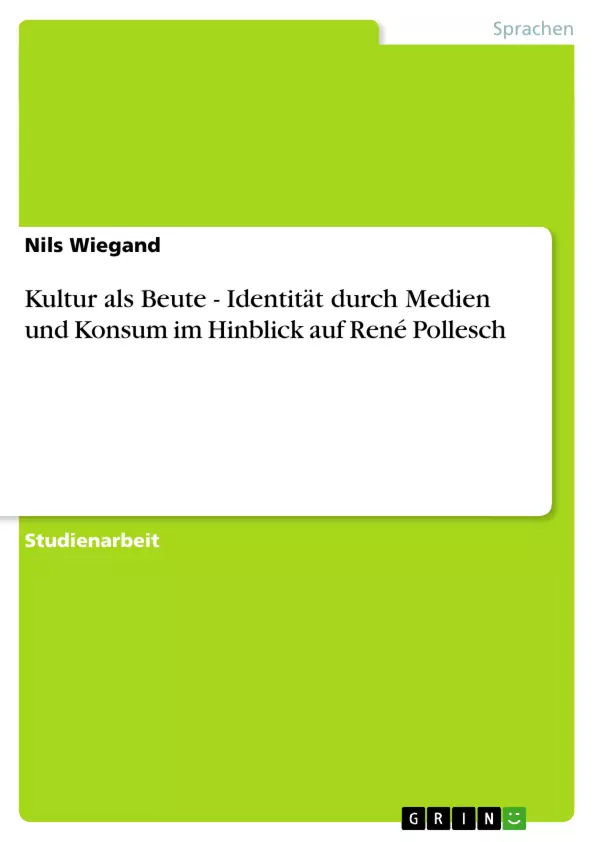„Was meine Natur ist, bestimme ich immer noch selbst, IHR VERDAMMTEN FICKSÄUE!“ Mit diesem Slogan warb das Staatstheater Stuttgart für René Polleschs Stück „Smarthouse 1+2“. Er lotet darin anhand von vier hysterischen Subjekten der Globalisierung die Grenzen der Identität, bzw. Subjektivität aus und stellt die Frage nach ihrer Penetrier- und Lenkbarkeit im Zeitalter von Medien, Globalisierung und Turbokapitalismus. Die Gegenwart erfordert ihm zufolge ne ue „Darstellungsformen von Subjektivität“ 1 . Zu untersuchen, wie eine Kultur charakterisiert werden könnte, dessen Diskursteilnehmer zwischen User-Profilen switchen, anstatt ihre Identitäten gegen die Medien zu vertreten, soll Ziel dieser Hausarbeit sein. D ie Frage nach Identität, Individualität und Subjektivität wird auf der Folie der Diskussion um die hyperreale, beschleunigte Postmoderne und ihrer Gesellschaft kulturkritisch reflektiert, wodurch sich eine mitunter pessimistische Diagnose ergibt: Ihre Kult ur verkommt zum Trash, wenn sie sie lediglich performt (Pollesch). In diesen Diskurs sind werbe - psychologische, theatertheoretische, (architektur- und kunst-) soziologische sowie gesellschafts- und kulturkritische Aspekte aufgenommen, die wiederum im Werk Polleschs ihren Widerklang finden, und exemplarisch in diesem diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Alles ist käuflich: die Liebe, die Kunst, der Planet Erde, Sie, ich.“
- Die Postmoderne – Ende der Moderne?
- Medialität - Tod der Kunst: Hyperrealität?
- „Alles was du hast, hat irgendwann dich!“ – Normativität und Identität
- Generation @: Schleichende Übernahme des Subjekts?
- Nationen, Konzerne, Marken, Subjekte
- Identität, Individualität, Subjektivität
- Soziale Mimesis: Denn sie wissen, was sie nicht leben wollen
- René Polleschs (postdramatisches) Theater: „Perform Normativität!“
- „Verdammte Scheiße. Ich bin in einer Soap gelandet!“
- smarthouse: Die Ekstase der Kommunikation
- Kokain und Mascara: ICH WILL DAS NICHT LEBEN!
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Frage nach Identität und Subjektivität in der hyperrealen, beschleunigten Postmoderne. Dabei wird die Kulturkritik René Polleschs als Ausgangspunkt genommen, der in seinen Theaterarbeiten die Grenzen der Identität im Zeitalter von Medien, Globalisierung und Turbokapitalismus erforscht. Die Arbeit beleuchtet die Transformation von Kultur und Gesellschaft durch Medien und Konsum und analysiert, wie diese Prozesse die Subjektivität beeinflussen.
- Die Postmoderne als Epoche der Undarstellbarkeit
- Die Rolle der Kulturindustrie und des Konsums in der Gestaltung von Identität
- Die Auswirkungen der Medialität auf die Wahrnehmung und das kulturelle Leben
- Die Frage nach der Performativität von Identität in der postmodernen Gesellschaft
- René Polleschs Theater als Beispiel für eine kulturkritische Auseinandersetzung mit der Frage nach Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Frage nach der Veränderung von Subjektivität in der heutigen Gesellschaft. Kapitel 2 beleuchtet die Konzepte der Postmoderne und der Medialität und deren Einfluss auf die Kunst und die Kultur. Kapitel 3 untersucht die Generation @, die durch die Medien und den Konsum geprägt ist, und beleuchtet die Auswirkungen auf Identität und Individualität. Kapitel 4 widmet sich dem Theater René Polleschs, der in seinen Stücken die Performativität von Identität und die Grenzen der Subjektivität in der postmodernen Gesellschaft thematisiert.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Postmoderne, Medialität, Identität, Subjektivität, Kulturindustrie, Konsum, Performativität und Theater. Im Zentrum steht eine kulturkritische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen von Medien und Konsum auf die heutige Gesellschaft und deren Einfluss auf das Selbstverständnis des Individuums. René Polleschs Theater dient als exemplarischer Fall für die Auseinandersetzung mit diesen Themen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema der Hausarbeit?
Die Arbeit untersucht Identität, Individualität und Subjektivität in der hyperrealen Postmoderne am Beispiel der Theaterarbeiten von René Pollesch.
Welche Rolle spielt René Pollesch in dieser Untersuchung?
Sein Werk dient als exemplarischer Fall für eine kulturkritische Auseinandersetzung mit den Grenzen der Identität im Zeitalter von Globalisierung und Turbokapitalismus.
Was wird unter dem Begriff „Generation @“ verstanden?
Es beschreibt ein Subjekt, das durch Medien und Konsum geprägt ist und zwischen User-Profilen wechselt, anstatt eine feste Identität zu vertreten.
Welche Auswirkungen haben Medien laut der Arbeit auf die Kultur?
Die Arbeit diagnostiziert eine Verwandlung der Kultur zu „Trash“, wenn Identität nur noch performt wird und die Medialität zur Hyperrealität führt.
Welche theoretischen Aspekte werden in den Diskurs einbezogen?
Es werden werbepsychologische, theatertheoretische, soziologische sowie gesellschafts- und kulturkritische Aspekte analysiert.
- Quote paper
- Nils Wiegand (Author), 2003, Kultur als Beute - Identität durch Medien und Konsum im Hinblick auf René Pollesch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22959