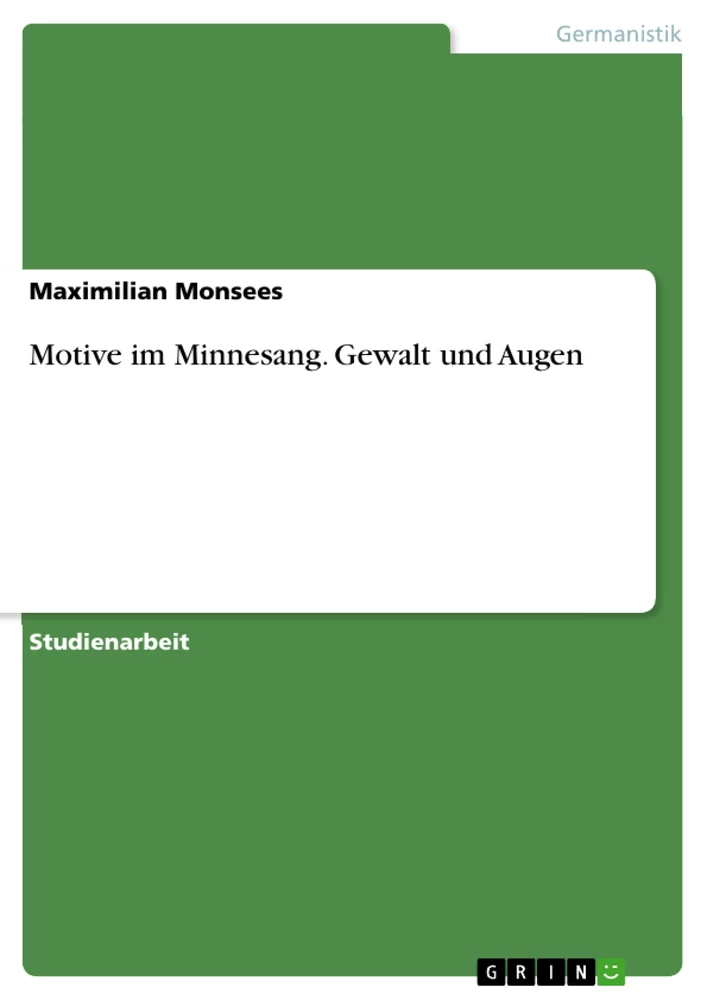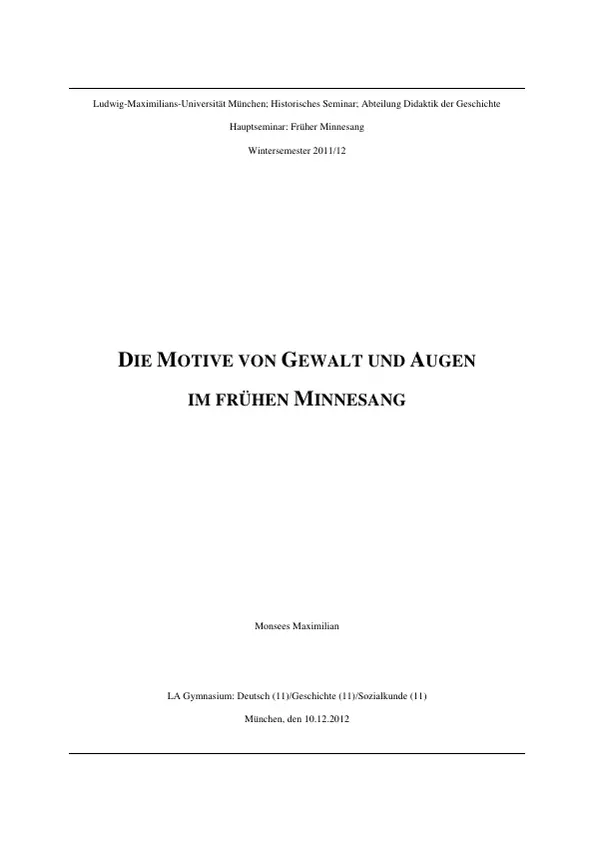Die vorliegende Hauptseminararbeit beschäftigt sich mit ausgewählten Motiven des frühen Minnesangs, allen voran die Motive der Gewalt und des "schouwens" bzw. die Metaphorik von Augen. Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit Funktion von Augen und schauen sowie mit Gewaltmotiven im Minnesang allgemein und baut u.a. gegenwärtige Forschungsdiskussionen mit ein. Abseits der bereits häufig diskutierten Motiven von Minneparadox und Kreuzfahrerliedern versucht die Arbeit hiervon abzusehen und sich dieser noch eher unbeleuchteten Thematik zuzuwenden, obschon auf das Minneparadoxon in der Argumentation häufig zurückgegriffen werden muss.
Die Arbeit analysiert im zweiten Teil zwei ausgewählte Textbeispiele Friedrich von Hausens und Heinrich von Morungens. Hier werden Überlegungen des ersten Teils zu den behandelten Motiven aufgegriffen und textkritisch in den Inhalt der Beispiellieder eingebunden, wobei auch auf eine klassische Lied- und Textüberlieferungsanalyse zurückgegriffen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gewalt und bedrohliche Minne
- Augenmetaphorik und "schouwen"
- Friedrich v. Hausen "Wåfenå, wie hat mich minne geläzen"
- Überlieferung und Aufbau
- Inhalt und Erscheinungsform von Gewalt
- Zusammenfassung
- Heinrich v. Morungen "Von der elbe wirt entsehen"
- Überlieferung und Aufbau
- Inhalt und Augenmotiv
- Zusammenfassung
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Motiven von Gewalt und Augen im frühen Minnesang, indem sie zwei ausgewählte Lieder analysiert und interpretiert. Ziel ist es, die verschiedenen Formen von Gewalt, die in Minneliedern zum Ausdruck kommen, zu untersuchen und die besondere Rolle der Augen als „Portal" zum Herz des Geliebten zu beleuchten.
- Die Darstellung von Gewalt im Minnesang
- Die Rolle der Augen als Symbol für Schönheit und Zugang zum Herzen
- Die Verbindung von Gewalt und Augenmetaphorik
- Die Analyse von zwei Liedern: Friedrich v. Hausen "Wåfenå, wie hat mich minne geläzen" und Heinrich v. Morungen "Von der elbe wirt entsehen"
- Die Bedeutung der antiken Optiktheorie für die Interpretation der Lieder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen kurzen Überblick über das Minneparadox und die Rolle der Gewalt in Minneliedern. Sie stellt die beiden zentralen Motive der Arbeit - Gewalt und Augen - vor und erläutert ihre Relevanz im Kontext des frühen Minnesangs.
Das Kapitel "Gewalt und bedrohliche Minne" untersucht die Doppelsemantik des Wortes "gewalt" im Mittelhochdeutschen und seine Anwendung auf die Frau Minne. Es zeigt, wie die personifizierte Minne als eine gewalttätige Macht dargestellt wird, die über Leben und Tod des Minners bestimmen kann.
Das Kapitel "Augenmetaphorik und "schouwen"" beleuchtet die besondere Bedeutung der Augen im Minnesang. Es erklärt, wie die Augen als Symbol für Schönheit, Zugang zum Herzen und als "Portal" zur Seele des Geliebten dienen.
Das Kapitel "Friedrich v. Hausen "Wåfenå, wie hat mich minne geläzen"" analysiert das Lied von Friedrich v. Hausen und untersucht die darin enthaltenen Gewaltphantasien des Sängers. Es zeigt, wie der Sänger die personifizierte Minne als Feind betrachtet und sich in seinen Phantasien an ihr rächen will.
Das Kapitel "Heinrich v. Morungen "Von der elbe wirt entsehen"" analysiert das Lied von Heinrich v. Morungen und konzentriert sich auf das Augenmotiv. Es zeigt, wie die Elbenfrau mit ihrem Bannblick dem Sänger die Kontrolle über sein Herz raubt und ihn in eine tiefe Abhängigkeit bringt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den frühen Minnesang, Gewalt, Augenmetaphorik, "schouwen", Minneparadox, Frau Minne, Herz, Schönheitsideal, Friedrich v. Hausen, Heinrich v. Morungen, antike Optiktheorie.
- Quote paper
- Maximilian Monsees (Author), 2012, Motive im Minnesang. Gewalt und Augen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229718