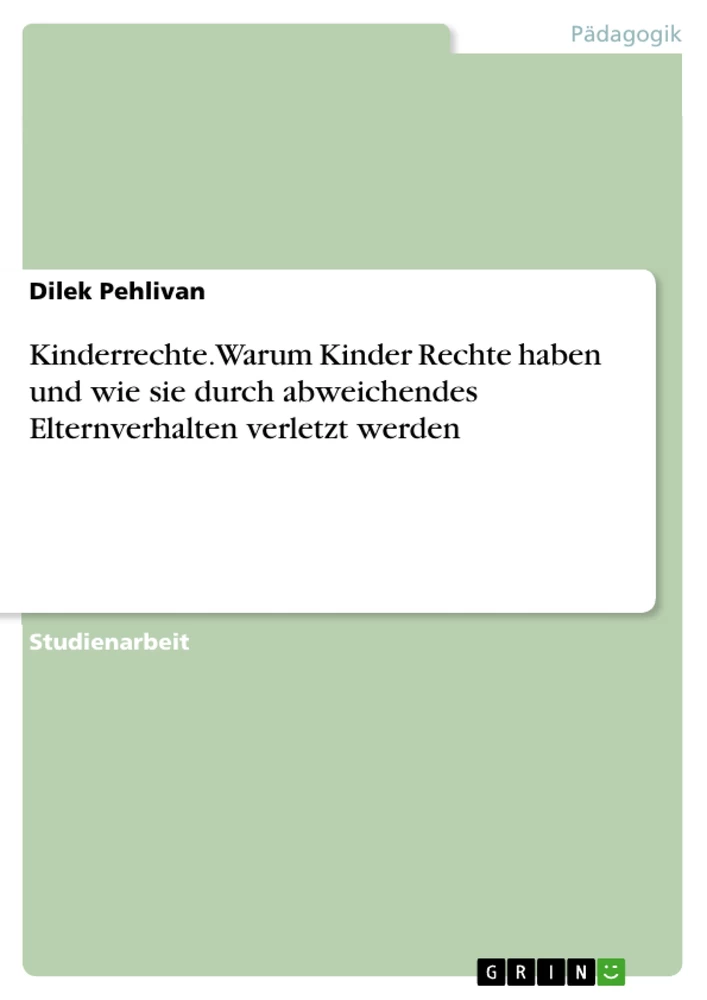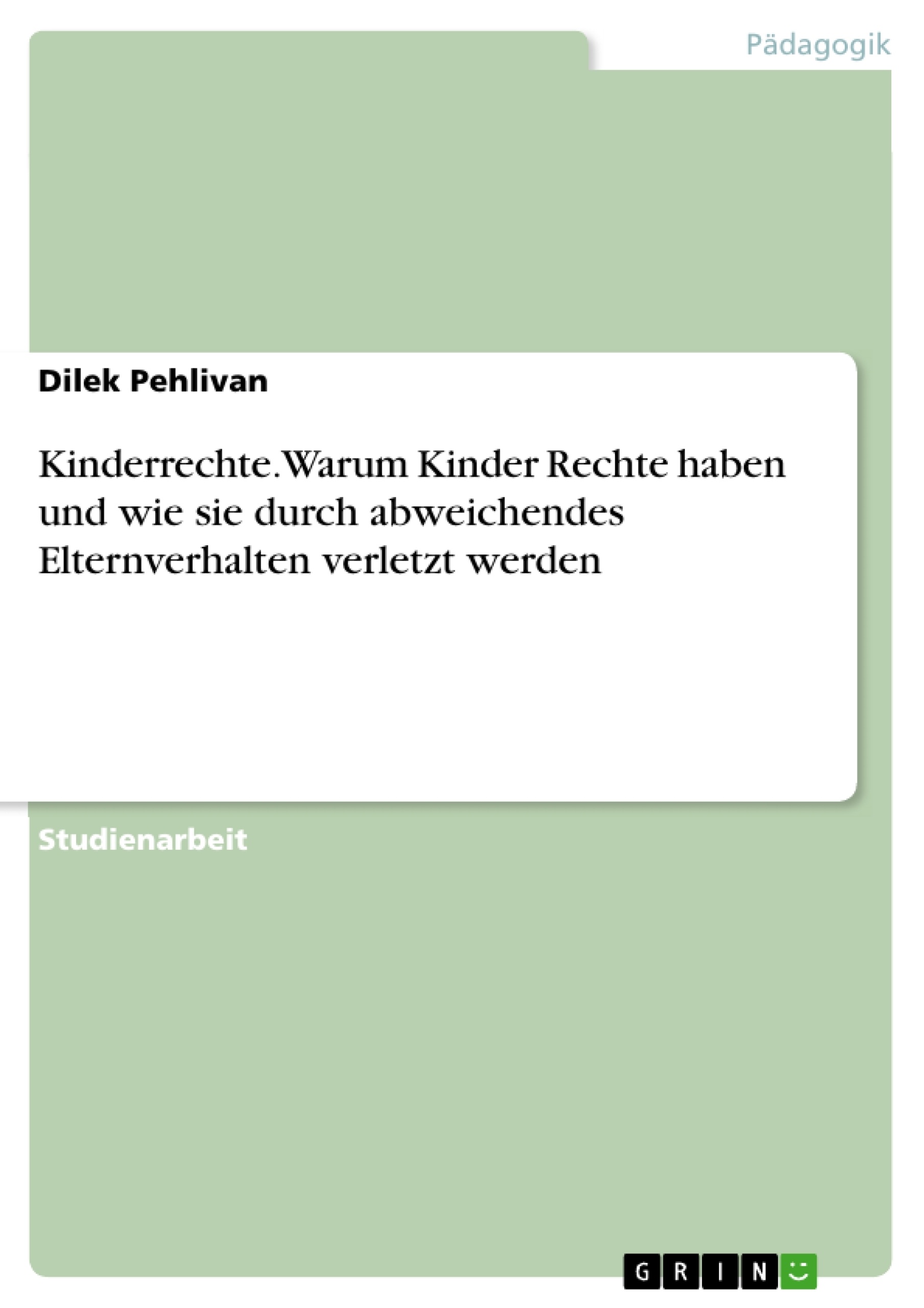Grob geschätzt leben heute rund zwei Milliarden Kinder auf der Erde, 144 Millionen davon in der Europäischen Union. Eines haben alle diese Kinder gemeinsam: Ihre Rechte. 193 Nationen, darunter auch Deutschland, haben mittlerweile die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet, die den Kindern verspricht ihre Rechte zu achten. Den Kindern, die vor einigen hundert Jahren nur gelebt haben, wenn es die Eltern so entschieden, die dann rechtlich als unmündiges, minderwertiges Eigentum der Familie galten, werden dadurch heute eigene Rechte zugesprochen: Rechte auf Überleben, Entwicklung, Beteiligung und nicht zuletzt auch Schutz, sogar gegenüber den eigenen Eltern. Das in den Medien durch aktuelle Geschehnisse immer wiederkehrende Thema der Kindesmisshandlung macht deutlich, warum Kinder sogar gegenüber ihren Eltern Rechte brauchen, geschieht doch ein signifikant großer Anteil dieser Misshandlungen innerhalb der eigenen Familie.
Wie und warum hat sich dieser Wandel des Kindes vollzogen, vom unmündigen Objekt zum Subjekt und Träger eigener Rechte? Welche Rechte werden heute dem Kind zugesprochen und was sind dabei die Leitprinzipien und Grenzen? Wie hat sich das Eltern-Kind-Verhältnis in dem Maße verändert, dass Eltern nicht mehr wie in der Antike über Leben und Tod des Kindes entscheiden dürfen, sondern sich heute nach dem Wohl des Kindes zu richten haben und in welchen Fällen des abweichenden Elternverhaltens liegt eine Kindesmisshandlung vor? Dies sind die Fragen, denen sich die nachfolgende Arbeit widmet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kinderrechte im Überblick
- Entwicklung des Kindseins
- Entstehung und Inhalte der Kinderrechtskonvention
- Kind und Kindeswohl in der Kinderrechtskonvention
- Kind und Eltern
- Von den Kinderrechten abweichendes Elternverhalten
- Körperliche und psychische Misshandlung
- Vernachlässigung
- Sexueller Missbrauch
- Folgen der Kindesmisshandlung
- Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Rechten von Kindern und wie diese durch abweichendes Elternverhalten verletzt werden können. Sie analysiert die Entwicklung des Kindseins und die Entstehung der UN-Kinderrechtskonvention, die Kindern weltweit ein Recht auf Leben, Entwicklung, Schutz und Beteiligung zuspricht. Im Fokus stehen die verschiedenen Formen von Kindesmisshandlung, wie körperliche und psychische Misshandlung, Vernachlässigung und sexueller Missbrauch, sowie die Folgen dieser Handlungen für die betroffenen Kinder. Die Arbeit beleuchtet auch den Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe, die im Falle von Kindeswohlgefährdung eingreifen und Kinder vor ihren Eltern schützen muss.
- Die Entwicklung des Kindseins und der Wandel vom Objekt zur Subjekt
- Die UN-Kinderrechtskonvention und ihre Bedeutung für den Schutz von Kindern
- Die verschiedenen Formen von Kindesmisshandlung und ihre Folgen
- Der Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe und die Bedeutung des Kindeswohls
- Die Bedeutung der Kinderrechte für die Gesellschaft und die Notwendigkeit der Aufklärung von Kindern über ihre Rechte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Kinderrechte ein und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Kapitel 2 bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des Kindseins, die Entstehung und Inhalte der Kinderrechtskonvention sowie die Bedeutung des Kindeswohls in diesem Kontext. Es analysiert auch das Verhältnis von Kind und Eltern im Lichte der Kinderrechte und die Herausforderungen, die sich aus der gleichberechtigten Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern ergeben.
Kapitel 3 widmet sich den verschiedenen Formen von Kindesmisshandlung, die von den Kinderrechten abweichen. Es beschreibt die körperliche und psychische Misshandlung, die Vernachlässigung und den sexuellen Missbrauch und analysiert die Folgen dieser Handlungen für die betroffenen Kinder. Es beleuchtet auch die Rolle der Kinder- und Jugendhilfe im Schutz von Kindern vor Misshandlung und die Bedeutung des staatlichen Eingriffs im Falle von Kindeswohlgefährdung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Kinderrechte, die UN-Kinderrechtskonvention, Kindeswohl, Kindesmisshandlung, körperliche und psychische Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch, Folgen der Kindesmisshandlung, Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe, Elternverantwortung, Selbstbestimmung, Entwicklung, Schutz und Beteiligung von Kindern.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die rechtliche Grundlage für Kinderrechte weltweit?
Die zentrale Grundlage ist die UN-Kinderrechtskonvention, die von 193 Nationen (einschließlich Deutschland) unterzeichnet wurde.
Wie hat sich die Stellung des Kindes historisch verändert?
Das Kind wandelte sich vom „unmündigen Objekt“ und Eigentum der Eltern hin zu einem eigenständigen Subjekt und Träger eigener Rechte.
Welche Formen von Kindeswohlgefährdung werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert körperliche und psychische Misshandlung, Vernachlässigung sowie sexuellen Missbrauch durch Eltern.
Was ist der Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe?
Die staatliche Instanz ist verpflichtet einzugreifen, wenn das Kindeswohl gefährdet ist, um Kinder notfalls auch vor dem Verhalten ihrer eigenen Eltern zu schützen.
Dürfen Eltern heute noch über „Leben und Tod“ entscheiden?
Nein, im Gegensatz zur Antike müssen Eltern sich heute strikt nach dem Wohl des Kindes richten; abweichendes Verhalten wird rechtlich verfolgt.
- Citar trabajo
- Dilek Pehlivan (Autor), 2013, Kinderrechte. Warum Kinder Rechte haben und wie sie durch abweichendes Elternverhalten verletzt werden, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229774