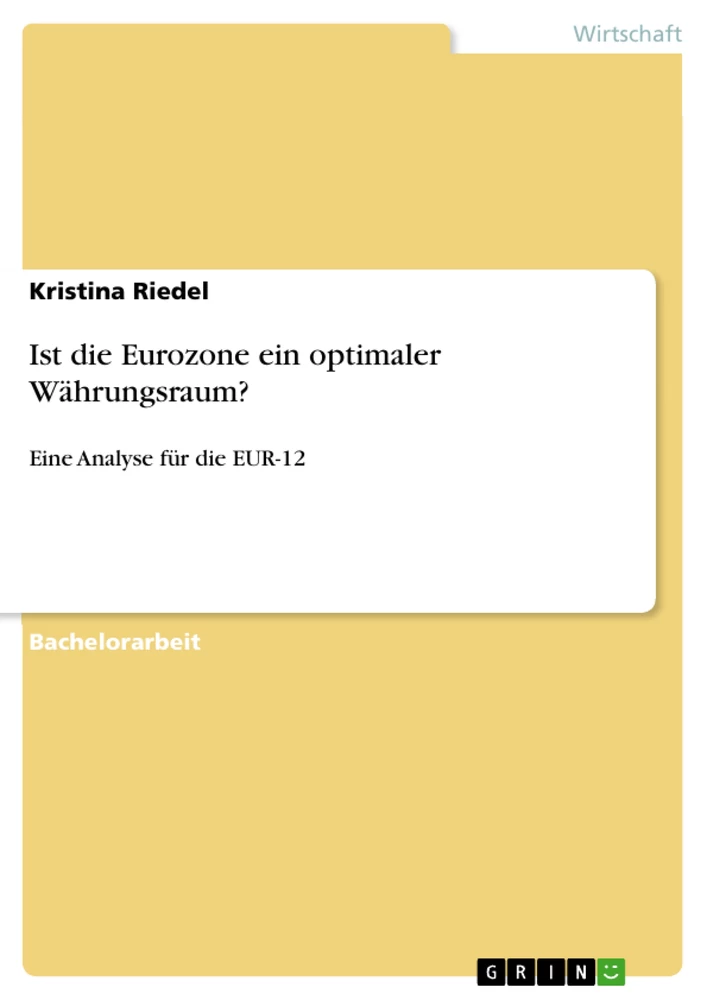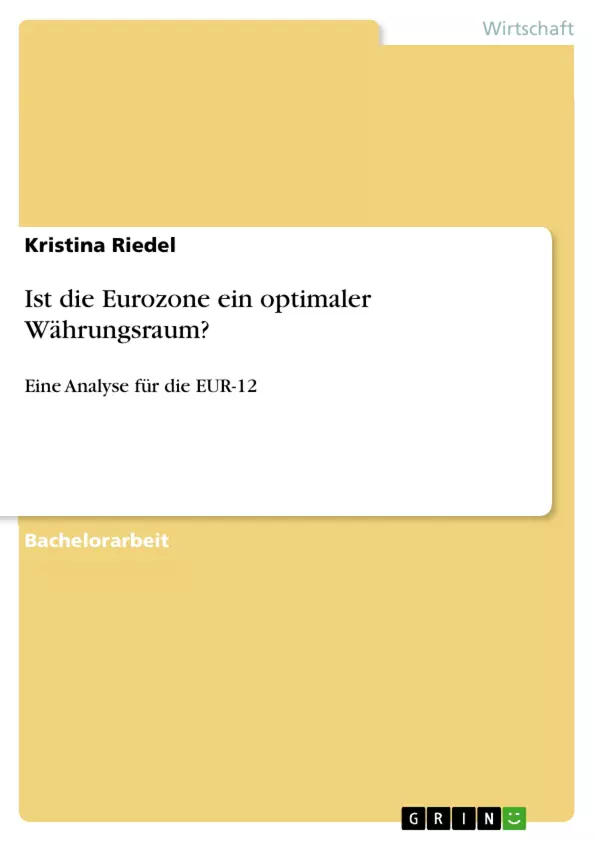Schon in den 1920-er Jahren – nach Ende des ersten Weltkriegs – wurden Rufe nach einer wirtschaftlichen und politischen Einigung Europas laut. Angst vor einem erneuten Krieg, dem wirtschaftlichen Verfall und der zunehmenden Bedeutungslosigkeit der europäischen Staaten im weltweiten Machtgefüge unterstützten diese Einigungspläne, die auch den Wunsch nach einer gemeinsamen Währung enthielten. Von denselben Motiven geleitet verfolgen die europäischen Regierungen seit dem Ende des zweiten Weltkriegs die europäische Einigung, die sich bisher vor allem auf eine wirtschaftliche und monetäre Integration beschränkt. Nach einigen gescheiterten Versuchen gibt es nun seit 1999 zumindest in einem wachsenden Teil Europas eine einheitliche Währung – den Euro (vgl. Clemens et al. 2008).
Da in erster Linie politische Interessen bei der Gründung der Währungsunion ausschlaggebend waren, soll in der folgenden Arbeit nachträglich untersucht werden, ob die Einigung auch aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht Erfolg versprechend ist. Die Analyse für die ersten zwölf Mitgliedsländer der Eurozone basiert auf der Theorie optimaler Währungsräume und soll letzten Endes die Frage, ob die EUR-12 ein optimaler Währungsraum ist, beantworten. Aufgrund der statischen Betrachtung durch die OCA-Theorie soll weiterhin untersucht werden, ob sich das Ergebnis der Analyse durch die Finanzkrise seit 2007 verändert hat.
In der vorliegenden Arbeit werden zunächst die theoretischen Grundlagen dargestellt, wobei einerseits die Vor- und Nachteile einer gemeinsamen Währung gegenübergestellt und andererseits die Kriterien der Theorie optimaler Währungsräume erläutert werden. Im zweiten Teil wird die Eurozone auf Grundlage der vorgestellten Kriterien der OCA-Theorie evaluiert. Es folgt eine kritische Auseinandersetzung mit der Theorie optimaler Währungsräume und ein Blick auf die Zukunft der Eurozone.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Währungsräume
- Vorteile einer Währungsunion
- Nachteile einer Währungsunion
- Theorie optimaler Währungsräume
- Robert A. Mundell: Arbeitsmobilität
- Ronald McKinnon: Offenheit
- Peter Kenen: Diversifikation von Handel und Produktion
- Neuere Kriterien
- Gleiche Inflationsraten
- Kapitalmobilität
- Fiskaltransfers
- Zusammenfassung
- Währungsräume
- Ist die Eurozone ein optimaler Währungsraum?
- Asymmetrische Schocks und Inflation
- Asymmetrische Schocks
- Inflationsraten
- Faktormobilität
- Arbeitsmobilität
- Kapitalmobilität
- Offenheit
- Diversifikation von Handel und Produktion
- Fiskaltransfers
- Ergebnis
- Asymmetrische Schocks und Inflation
- Kritische Würdigung
- Ausblick
- Quellenverzeichnis
- Rechtsquellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit analysiert die Eurozone anhand der Theorie optimaler Währungsräume (OCA-Theorie) und untersucht, ob die EUR-12 ein optimaler Währungsraum ist. Die Arbeit betrachtet dabei die Auswirkungen der Finanzkrise seit 2007 auf die relevanten Kriterien der OCA-Theorie.
- Die Vor- und Nachteile einer Währungsunion
- Die Kriterien der OCA-Theorie, insbesondere Arbeitsmobilität, Offenheit, Diversifikation und Fiskaltransfers
- Die Anpassungsfähigkeit der Eurozone auf asymmetrische Schocks
- Die Rolle der Faktormobilität (Arbeit und Kapital) innerhalb der Eurozone
- Die Bedeutung der Fiskaltransfers für die Stabilität der Eurozone
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der europäischen Integration und die Entstehung der Eurozone ein. Sie erläutert die politische und wirtschaftliche Motivation zur Gründung der Währungsunion und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Ist die EUR-12 ein optimaler Währungsraum?
Das Kapitel "Theoretische Grundlagen" beleuchtet die Grundgedanken der Theorie optimaler Währungsräume. Es erklärt die Begriffe Währungsraum und Optimalität und stellt die Vor- und Nachteile einer gemeinsamen Währung gegenüber. Anschließend werden die ursprünglichen Kriterien für einen optimalen Währungsraum - Arbeitsmobilität, Offenheit und Diversifikation - analysiert und Möglichkeiten zur empirischen Überprüfung dieser Kriterien vorgestellt. Weitere Kriterien, wie gleiche Inflationsraten, Kapitalmobilität und Fiskaltransfers, werden ebenfalls erläutert.
Das Kapitel "Ist die Eurozone ein optimaler Währungsraum?" untersucht die Eurozone anhand der Kriterien der OCA-Theorie. Es analysiert die Anpassungsfähigkeit der Eurozone auf asymmetrische Schocks und die Rolle der Faktormobilität (Arbeit und Kapital) innerhalb der Eurozone.
Das Kapitel "Kritische Würdigung" setzt sich kritisch mit der Theorie optimaler Währungsräume auseinander. Es hinterfragt die Annahmen der Theorie und die Wirksamkeit nationaler Geldpolitik und diskutiert die Endogenität und Spezialisierungstendenzen innerhalb einer Währungsunion.
Der Ausblick befasst sich mit der zukünftigen Entwicklung der Eurozone und den Herausforderungen, die sich aus der fehlenden Arbeitsmobilität und den fehlenden Fiskaltransfers ergeben. Es werden die Chancen und Risiken der weiteren Integration und die Bedeutung des politischen Willens für den Erhalt der Eurozone beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Eurozone, die Theorie optimaler Währungsräume (OCA-Theorie), asymmetrische Schocks, Faktormobilität, Offenheit, Diversifikation, Fiskaltransfers, Preisstabilität, Arbeitslosigkeit, Inflation, Kapitalmobilität, Handelsvolumen, Konvergenz, Integration, Finanzkrise, Staatsschuldenkrise, und die politische und wirtschaftliche Zukunft der Eurozone.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Theorie optimaler Währungsräume (OCA-Theorie)?
Die OCA-Theorie untersucht die wirtschaftlichen Kriterien, unter denen eine Region von einer gemeinsamen Währung profitiert, anstatt unabhängige nationale Währungen zu führen.
Welche Kriterien nannte Robert Mundell für einen optimalen Währungsraum?
Mundell betonte vor allem die Arbeitsmobilität als Ausgleichsmechanismus bei wirtschaftlichen Schocks.
Was sind asymmetrische Schocks?
Das sind wirtschaftliche Erschütterungen, die nur einen Teil der Währungsunion betreffen und dort Anpassungsprobleme verursachen, wenn Wechselkurse als Ventil fehlen.
Ist die Eurozone laut der Analyse ein optimaler Währungsraum?
Die Analyse zeigt Defizite auf, insbesondere bei der Arbeitsmobilität und fehlenden Fiskaltransfers, was die Stabilität der Eurozone (besonders in Krisenzeiten) gefährdet.
Welchen Einfluss hatte die Finanzkrise 2007 auf die Eurozone?
Die Krise verschärfte die Unterschiede zwischen den Mitgliedsländern und stellte die Belastbarkeit der OCA-Kriterien in der Praxis auf die Probe.
- Citation du texte
- Kristina Riedel (Auteur), 2012, Ist die Eurozone ein optimaler Währungsraum?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229776