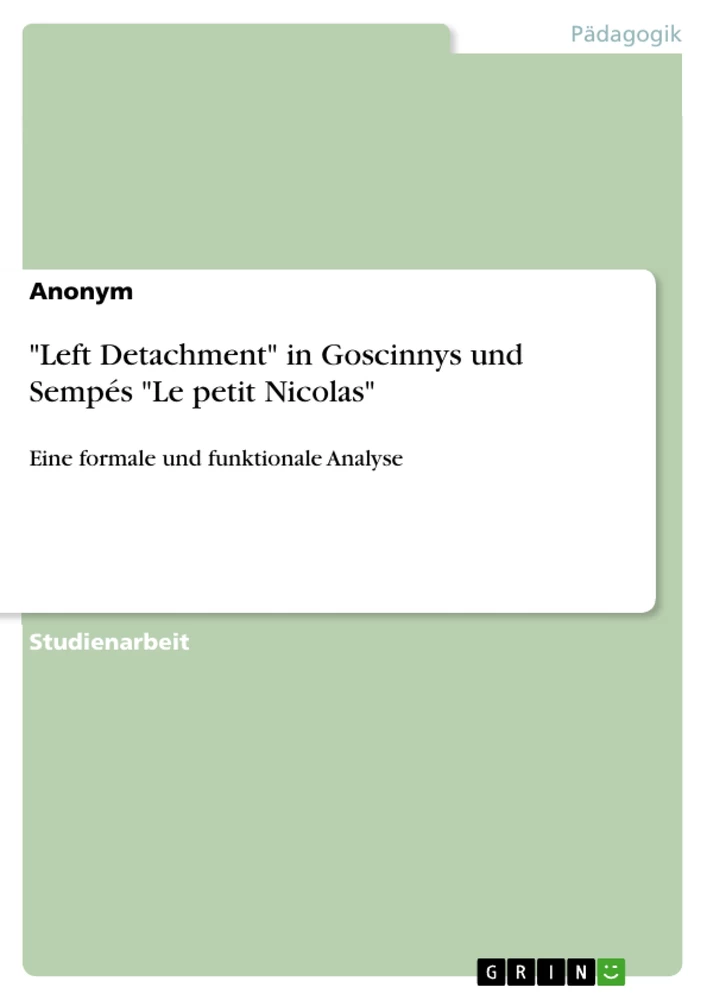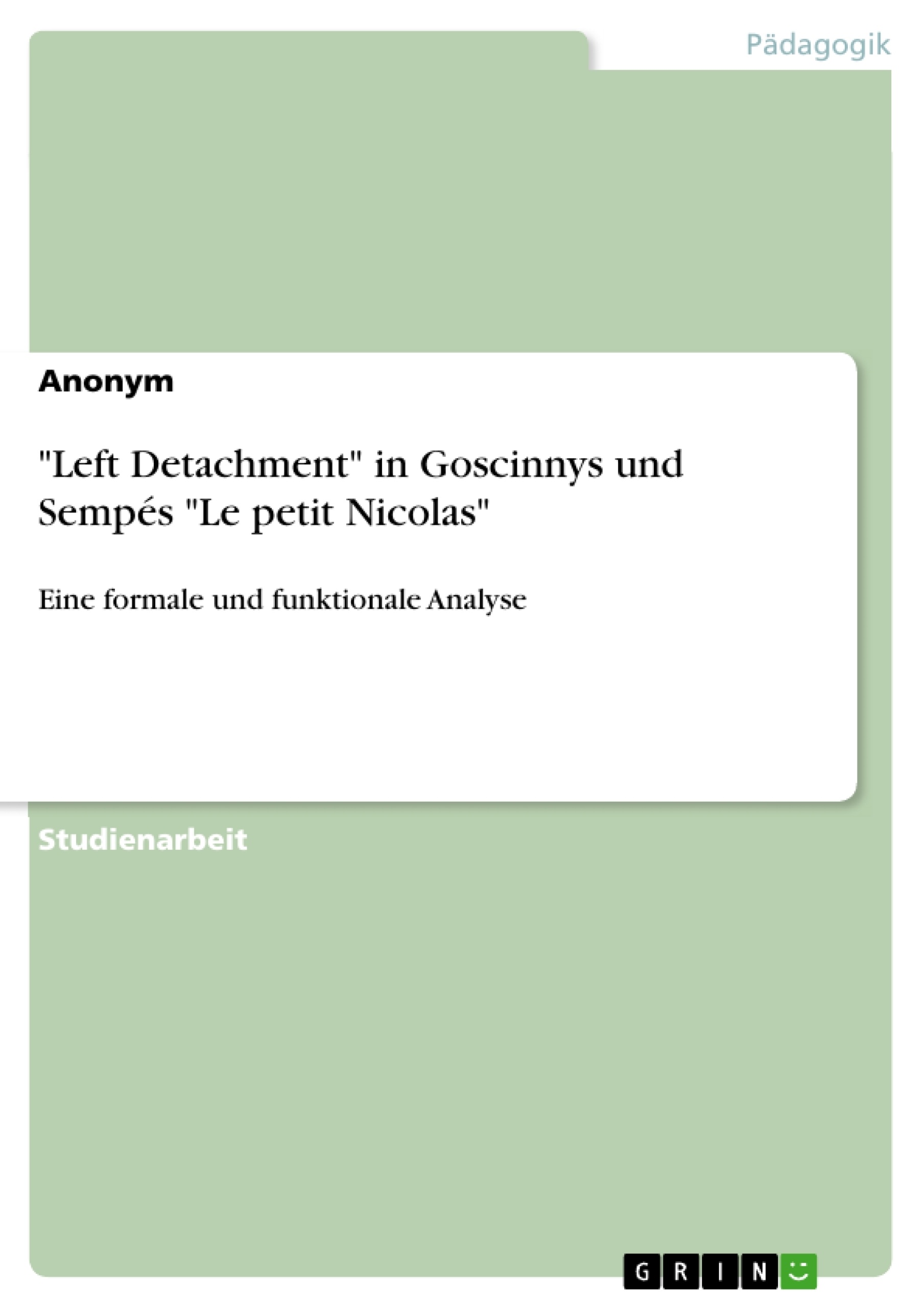Die Unterscheidung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit innerhalb einer Sprache ist wohlbekannt, lange jedoch wurde nur die geschriebene Sprache linguistisch untersucht, da man die gesprochene Sprache als fehlerhaft und damit als der Wissenschaft unwürdig erachtete (cf. Ewert-Kling 2010:19).
Geschriebene und gesprochene Sprache unterscheiden sich bezüglich der „Verpackungsverfahren“ ihrer Inhalte, ein und derselbe außersprachliche Sachverhalt kann somit auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck gebracht, sprich „verpackt“ werden, wobei zwischen „unmarkierten“ und „markierten“ Konstruktionen zu unterscheiden ist. Als „markierte“ Konstruktion ist auch das so genannte „Left Detachment“ (im Folgenden auch LD) zu beschreiben, das als „universelle[s] [Merkmal] gesprochener Sprache“ (Ewert-Kling 2010: 37) gilt.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist nun die formale und funktionale Analyse des „Left Detachment“ im français parlé , einer Konstruktion, die aufgrund ihrer besonderen pragmatischen Eigenschaften (nicht nur) im gesprochenen Französisch wichtige Funktionen erfüllt: „Um eine erfolgreiche sprechsprachliche Kommunikation gewährleisten zu können, ist es erforderlich, dem Gegenüber das Gesprächsthema deutlich anzuzeigen. Eine Möglichkeit hierfür bietet die Verwendung Topic-markierender Left Detachment- und Right-Detachment-Konstruktionen […], die sich durch ihre besondere syntaktische und pragmatische Beschaffenheit als ideale Topic-Anzeiger im Gespräch auszeichnen“ (Ewert-Kling 2010: 15).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Corpus
- Theoretische Grundlagen
- Informationsstrukturelle Parameter
- Topic
- „Left Detachment“ im „Petit Nicolas“ – formale und funktionale Analyse
- Formale Analyse der LD-Konstruktionen
- LD mit Subjekten: NP+ c'(est)/ ça
- Spezialfälle
- Hanging Topic
- Mehrfaches LD
- Problemfälle
- Funktionen von LD im Diskurs
- Topic- Beibehaltung
- Topic- Etablierung
- Topic- Reetablierung
- Topic-Hervorholung
- Topic- Ableitung
- Moi, je... - Topic- Markierung des Sprechers
- Formale Analyse der LD-Konstruktionen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die formale und funktionale Verwendung von „Left Detachment“ (LD) im gesprochenen Französisch, anhand des literarischen Werks „Le petit Nicolas“. Ziel ist es, die syntaktischen Eigenschaften von LD zu beschreiben und seine pragmatischen Funktionen im Diskurs zu beleuchten. Die Arbeit untersucht, wie LD zur Strukturierung von Informationen und zur Markierung von Themenbeiträgen im Gespräch beiträgt.
- Formale Analyse von LD-Konstruktionen im „Petit Nicolas“
- Pragmatische Funktionen von LD im Diskurs
- Der Zusammenhang zwischen LD und der Informationsstruktur
- Die Rolle von LD als Topic-Marker
- Die Imitation gesprochener Sprache in einem schriftlichen Corpus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der sprachlichen Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation ein. Sie betont die zunehmende Bedeutung der Erforschung der Grammatik gesprochener Sprache und die Rolle von Konstruktionen wie „Left Detachment“ (LD) als funktionale Mittel zur Informationsverpackung in mündlichen Interaktionen. Besonders wird auf die pragmatischen Eigenschaften von LD und seine Funktion als Topic-Marker hingewiesen. Die Arbeit beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der folgenden Analyse von LD im „Petit Nicolas“.
Corpus: Dieses Kapitel beschreibt das gewählte Corpus: „Le petit Nicolas“ von Goscinny/Sempé. Es wird die Eignung des Textes aufgrund seiner Nähe zur gesprochenen Sprache und die Notwendigkeit der Berücksichtigung, dass es sich um imitierte und nicht authentische Sprache handelt, hervorgehoben. Die spezifischen Charakteristika der Erzählperspektive und des Sprachstils werden diskutiert und deren Relevanz für die Untersuchung von LD im Kontext des französischen Kinder-Alltags betont.
Theoretische Grundlagen: Dieser Abschnitt legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse von LD. Es wird das Konzept der Informationsstruktur erläutert, wobei die Parameter [+/-IDENTIFIZIERBAR] und [+/-NEU] zur Bestimmung des Informationsstatus von Konzepten im Diskurs eingeführt werden. Die Definition des Begriffs „Topic“ bildet die Basis für die anschließende Analyse von LD.
Schlüsselwörter
Left Detachment, Français parlé, gesprochene Sprache, Informationsstruktur, Topic, Diskursanalyse, „Le petit Nicolas“, Goscinny/Sempé, pragmatische Funktionen, formale Analyse, imitierte Sprache.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von „Left Detachment“ im „Petit Nicolas“
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die formale und funktionale Verwendung von „Left Detachment“ (LD) im gesprochenen Französisch, anhand des literarischen Werks „Le petit Nicolas“. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der syntaktischen Eigenschaften von LD und der Beleuchtung seiner pragmatischen Funktionen im Diskurs. Untersucht wird, wie LD zur Strukturierung von Informationen und zur Markierung von Themenbeiträgen beiträgt.
Welches Corpus wurde verwendet?
Das Corpus besteht aus „Le petit Nicolas“ von Goscinny/Sempé. Die Auswahl begründet sich auf der Nähe des Textes zur gesprochenen Sprache, wobei die imitierte Natur der Sprache berücksichtigt wird. Die Erzählperspektive und der Sprachstil werden hinsichtlich ihrer Relevanz für die Untersuchung von LD im Kontext des französischen Kinder-Alltags diskutiert.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf das Konzept der Informationsstruktur, insbesondere die Parameter [+/-IDENTIFIZIERBAR] und [+/-NEU] zur Bestimmung des Informationsstatus von Konzepten im Diskurs. Die Definition des Begriffs „Topic“ bildet die Grundlage für die Analyse von LD.
Welche Aspekte von „Left Detachment“ werden analysiert?
Die Analyse umfasst sowohl die formale Analyse der LD-Konstruktionen (z.B. LD mit Subjekten, Spezialfälle wie Hanging Topic und Mehrfaches LD, Problemfälle) als auch die pragmatischen Funktionen von LD im Diskurs (z.B. Topic-Beibehaltung, -Etablierung, -Reetablierung, -Hervorholung, -Ableitung, „Moi, je...“-Markierung des Sprechers).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die syntaktischen Eigenschaften von LD zu beschreiben und seine pragmatischen Funktionen im Diskurs zu beleuchten. Es soll der Zusammenhang zwischen LD und der Informationsstruktur sowie die Rolle von LD als Topic-Marker untersucht werden. Ein weiterer Aspekt ist die Betrachtung der Imitation gesprochener Sprache in einem schriftlichen Corpus.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Corpus, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen, ein Kapitel zur Analyse von „Left Detachment“ im „Petit Nicolas“, und eine Zusammenfassung. Das Kapitel zur Analyse von LD beinhaltet sowohl die formale als auch die funktionale Betrachtungsweise.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Left Detachment, Français parlé, gesprochene Sprache, Informationsstruktur, Topic, Diskursanalyse, „Le petit Nicolas“, Goscinny/Sempé, pragmatische Funktionen, formale Analyse, imitierte Sprache.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2010, "Left Detachment" in Goscinnys und Sempés "Le petit Nicolas", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229844