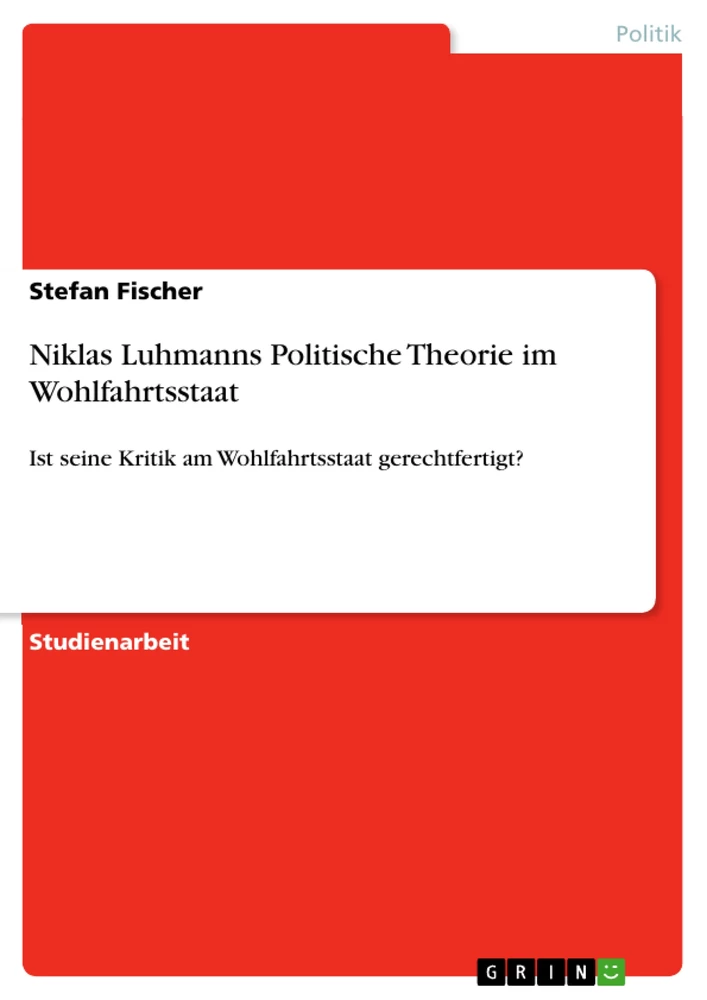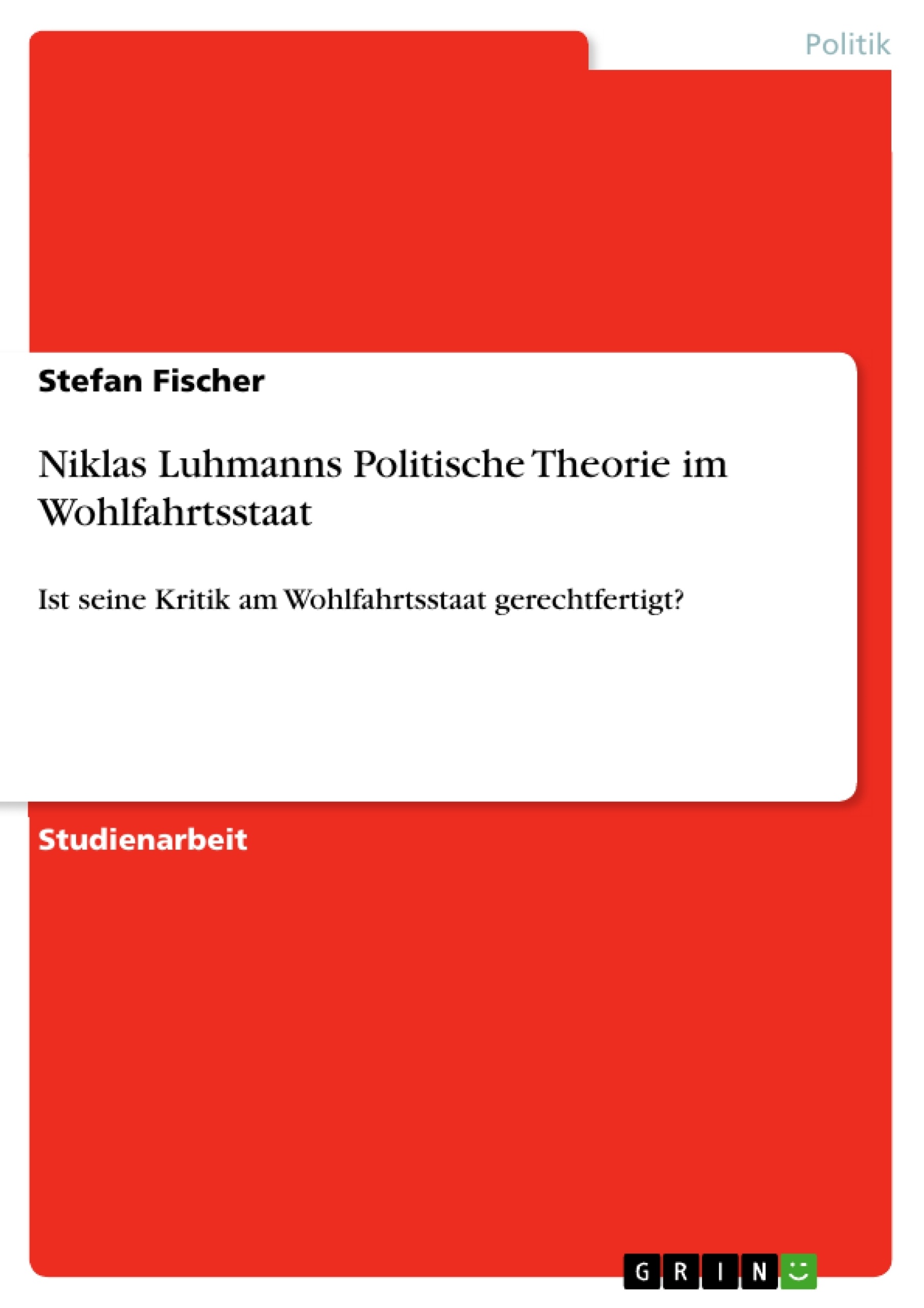"Luhmanns Theorie ist Magie. Sie jongliert mit einem kleinen, genau bestimmten Satz von Grundbegriffen – wie Sinn, System, Umwelt, Kommunikation – und bietet eine scharfe und eiskalte Sicht der modernen Gesellschaft". Ein Zitat aus einem Nachruf zum im November 1998 verstorbenen Soziologen Niklas Luhmann, das kurz und prägnant seine Betrachtungsweise darstellt. Ebenso nüchtern betrachtete Luhmann in seinem 1981 erschienenen 'Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat' den Wohlfahrtsstaat, wobei er sich auch nicht mit Kritik zurückhält. Dabei ist Luhmanns Kritik selbst nicht frei von Kritik. So sagt Lutz Leisering, Professor der Sozialpolitik an der Universität Bielefeld: "Luhmanns Wohlfahrtsstaatskritik ist dezidiert immanent". Und Leisering ist nicht der einzige Soziologe, der Luhmanns Kritik als ein Produkt seiner Systemtheorie bezeichnet. Doch ist Luhmanns Kritik nur mit Hilfe der Systemtheorie zu erklären? Daraus ergibt sich die Kernfrage dieser Arbeit: ist Luhmanns Kritik am Wohlfahrtsstaat gerechtfertigt?
Der Begriff des Wohlfahrtsstaates zieht sich wie ein roter Faden durch diese Arbeit, deshalb muss an dieser Steller gesagt sein, dass sich dieser Begriff im weiteren Verlauf der Arbeit an der Klassifizierung nach Gøsta Esping-Andersen orientiert. Esping-Andersen unterscheidet drei Grundtypen, den liberalen, den konservativen und den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat. Der liberale Wohlfahrtsstaat ist durch relativ geringe soziale Sicherheit durch die Politik, aber Rechtssicherheit am Markt gekennzeichnet. Der konservative Wohlfahrtsstaat dagegen bietet mehr soziale Sicherheit durch Pflichtversicherungen, und der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat bindet eine stärkere soziale Sicherheit an das Bürgerrecht. Die BRD und weitere West- und Mitteleuropäische Staaten fallen nach dieser Klassifizierung in den Typ des konservativen Wohlfahrtsstaates. Wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit vom Wohlfahrtsstaat gesprochen, ist, nach der Esping-Andersen Klassifizierung, vom konservativen Wohlfahrtsstaat die Rede.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Luhmanns Systembegriff
- Der Wohlfahrtsstaat nach Luhmann
- Luhmanns Kritik am Wohlfahrtsstaat
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die politische Theorie von Niklas Luhmann im Kontext des Wohlfahrtsstaates, insbesondere im Hinblick auf seine Kritik an diesem. Sie analysiert Luhmanns Systembegriff und dessen Anwendung auf den Wohlfahrtsstaat, um die Legitimität seiner Kritik zu beurteilen.
- Luhmanns Systembegriff und dessen Anwendung auf den Wohlfahrtsstaat
- Die Kritik am Wohlfahrtsstaat aus Luhmanns Sicht
- Die Problemfelder Finanzierung, sozialer Wandel und Instabilität des Wohlfahrtsstaates
- Die Relevanz einer klaren Definition des Wohlfahrtsstaates und einer neuen politikwissenschaftlichen Theorie
- Die Frage, ob Luhmanns Kritik gerechtfertigt ist oder ein Produkt seiner Systemtheorie.
Zusammenfassung der Kapitel
-
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die Forschungsfrage: Ist Luhmanns Kritik am Wohlfahrtsstaat gerechtfertigt? Sie erläutert die Definition des Wohlfahrtsstaates im Kontext dieser Arbeit, die sich an der Klassifizierung nach Gøsta Esping-Andersen orientiert.
-
Das zweite Kapitel stellt Luhmanns Systembegriff vor und erläutert die Beziehung zwischen System und Umwelt. Es wird auf die drei Grundformen von Systemen eingegangen: das biologische, das psychische und das soziale System. Das soziale System und das Gesellschaftssystem werden genauer beleuchtet, wobei Kommunikation als der Knotenpunkt sozialer Systeme hervorgehoben wird.
-
Das dritte Kapitel beleuchtet den Wohlfahrtsstaat aus Luhmanns Sicht. Es wird ein allgemeines wissenschaftliches Bild des Wohlfahrtsstaates gezeichnet und diesem Luhmanns Vorstellung gegenübergestellt. Der historische Kontext der Entstehung des Wohlfahrtsstaates wird dabei berücksichtigt.
-
Das vierte Kapitel analysiert Luhmanns Kritik am Wohlfahrtsstaat, die stark an seinem Werk 'Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat' angelehnt ist. Die Kritikpunkte werden dargestellt und mit den Beobachtungen von Susanne Lütz und Manfred G. Schmidt verglichen. Es werden Problemfelder wie die fehlende Begriffsdefinition, die Inkompetenzkompensations-kompetenz, die dynamische Gesellschaft und das Finanzierungsproblem beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Niklas Luhmann, politische Theorie, Wohlfahrtsstaat, Systemtheorie, Kritik, Finanzierung, sozialer Wandel, Instabilität, Begriffsdefinition, Inklusion, Gesellschaftssystem, politische Inklusion, Funktionsysteme, Kompensation, Legitimation, politische Entscheidungen, Wahlzyklus, demokratische Prozesse, Sozialpolitik, soziale Desintegration.
Häufig gestellte Fragen
Welche Kritik übt Niklas Luhmann am Wohlfahrtsstaat?
Luhmann kritisiert den Wohlfahrtsstaat als systemtheoretisches Produkt, das mit Problemen wie Finanzierung, Instabilität und mangelnder Begriffsdefinition kämpft.
Wie definiert Luhmann soziale Systeme?
Soziale Systeme basieren auf Kommunikation als zentralem Knotenpunkt und unterscheiden sich strikt von ihrer Umwelt.
Welche Wohlfahrtsstaatstypen unterscheidet Esping-Andersen?
Er unterscheidet den liberalen, den konservativen (z. B. BRD) und den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat.
Ist Luhmanns Kritik am Wohlfahrtsstaat laut der Arbeit gerechtfertigt?
Dies ist die Kernfrage der Arbeit; sie untersucht, ob die Kritik eine sachliche Grundlage hat oder lediglich ein zwangsläufiges Ergebnis seiner Systemtheorie ist.
Was ist die "Inkompetenzkompensations-kompetenz"?
Ein von Luhmann thematisiertes Problemfeld, das die Grenzen staatlicher Steuerungsfähigkeit im komplexen Wohlfahrtsstaat beschreibt.
- Quote paper
- Stefan Fischer (Author), 2012, Niklas Luhmanns Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229870