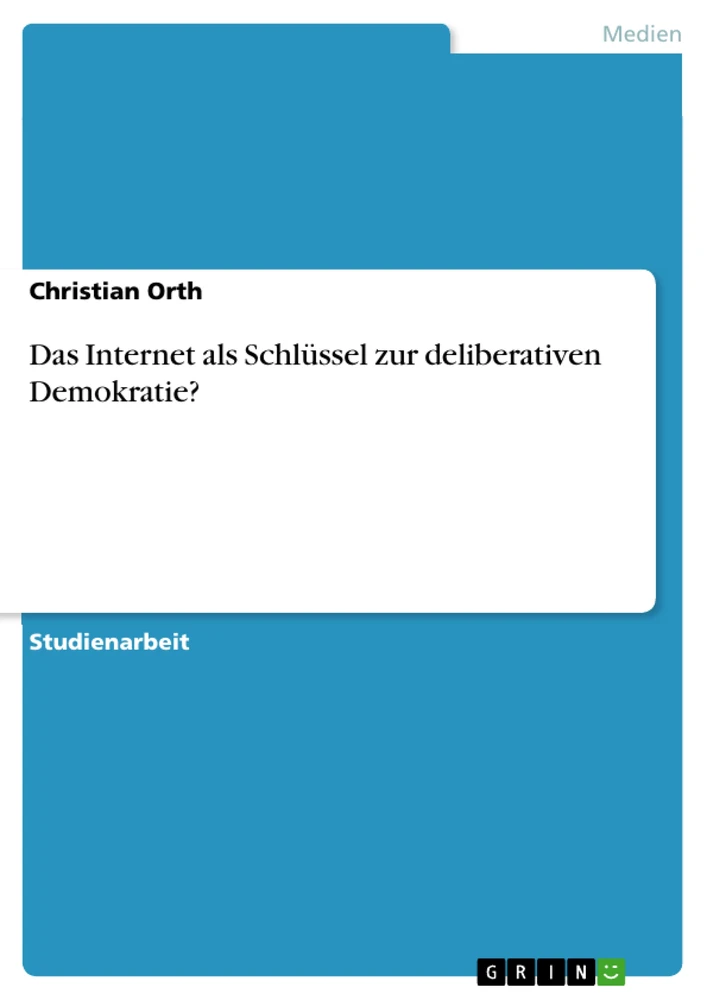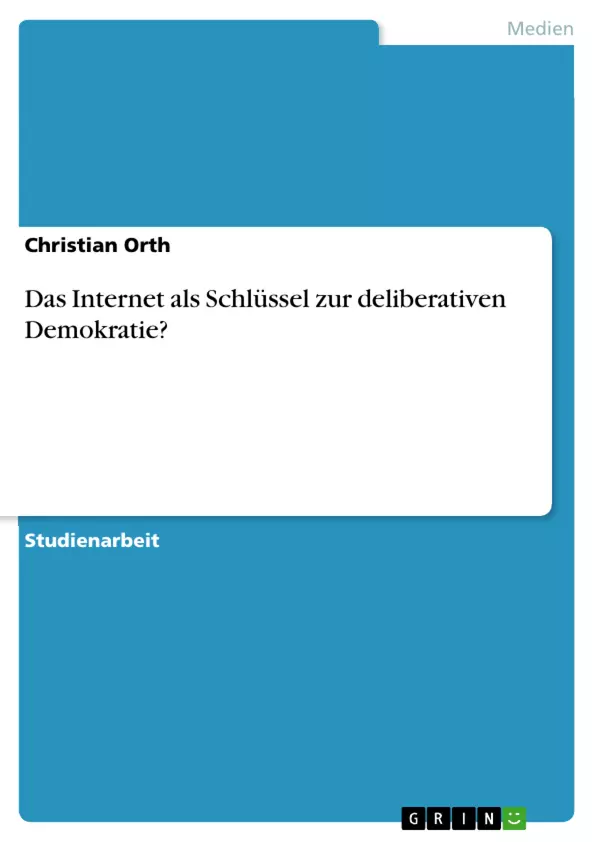Das Internet hat seit Beginn seines Daseins allerlei Hoffnungen und Utopien im akademischen Diskurs hervorgebracht. Von Anfang an lag dabei der Fokus auf dem Verhältnis zur Politik. Die Erwartungen hinsichtlich der Auswirkungen des WWW auf die politische Arena erstreckten sich über eine große Bandbreite. Der Mainstream der Forschung sah in dem neuen Medium die Möglichkeit, die Gesellschaft (wieder) stärker zu politisieren.Die Bürger könnten durch das Internet frei und in einem öffentlichen Raum miteinander kommunizieren, Informationen bereitstellen, ihre Meinung leicht und kostengünstig artikulieren und dieser Aufmerksamkeit verschaffen. Dadurch würden die Chancen von allen Menschen steigen, ihre Interessen und Bedürfnisse in die öffentliche Arena einzuspeisen.(...) Auch der Diskurs sollte durch das Internet verändert werden. Durch den wesentlich einfacheren Zugang der Bürger zur Öffentlichkeit erhoffte man sich, dass sich dieser nun durch eine stärkere Präsenz an Teilnehmern aus der Peripherie auszeichnen, mehr von Argumenten geprägt und fairer, offener und einflussreicher sein würde als bisher. Damit wurde dem neuen Medium nichts weniger als die Kraft zugeschrieben deliberative Ideale zu verwirklichen. Doch reicht die Erfindung eines neuen Kommunikationsraums, um die Bürger stärker zu politisieren und damit die Demokratie zu stärken, vielleicht sogar zu verbessern? Ist das Internet als neue Diskursplattform der Schlüssel zur deliberativen Demokratie?
In einem ersten, theoretischen Teil sollen auf die grundsätzlichen, demokratietheoretischen Überlegungen des hierzulande entscheidend von Jürgen Habermas geprägten, deliberativen Paradigmas eingegangen werden. Ein besonderes Augenmerk soll in diesem Abschnitt auf der Bedeutung von Öffentlichkeit und Diskurs für das politische System liegen. Der Schwerpunkt der Arbeit konzentriert sich allerdings auf den zweiten, empirischen Teil. Durch das Heranziehen von zwei Studien, die mit der Gleichheit der Partizipation und der Qualität des Diskurses jeweils zwei zentrale Elemente des normativen Ideals thematisieren, soll überprüft werden, inwieweit das Netz diese Ideale verwirklichen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Paradigma der deliberativen Demokratie
- Die Rolle der Öffentlichkeit
- Der Diskurs - Bedeutung und Bedingungen
- Online-Diskurse im Licht deliberativer Ideale.
- Diskursplattform Internet – Wirklich ausgeglichene Beteiligung? -
- Diskursplattform Internet - Wirklich hohe Qualität?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Frage, ob das Internet als Diskursplattform den Schlüssel zur deliberativen Demokratie darstellt. Dazu werden zunächst die grundlegenden demokratietheoretischen Überlegungen des deliberativen Paradigmas, insbesondere die Bedeutung von Öffentlichkeit und Diskurs für das politische System, beleuchtet. Anschließend wird im empirischen Teil anhand von zwei Studien geprüft, inwieweit das Netz die zentralen Elemente des deliberativen Ideals - Gleichheit der Partizipation und Qualität des Diskurses - verwirklicht.
- Das Konzept der deliberativen Demokratie
- Die Rolle der Öffentlichkeit im politischen System
- Die Bedeutung von Diskurs für die deliberative Demokratie
- Die Gleichheit der Partizipation in Online-Diskursen
- Die Qualität von Online-Diskursen im Hinblick auf deliberative Ideale
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Hausarbeit vor: Ist das Internet als Diskursplattform der Schlüssel zur deliberativen Demokratie? Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil behandelt das deliberative Paradigma und die Rolle von Öffentlichkeit und Diskurs in diesem Konzept. Der empirische Teil analysiert zwei Studien, die die Gleichheit der Partizipation und die Qualität des Diskurses in Online-Diskursen untersuchen.
Das Paradigma der deliberativen Demokratie
Dieser Abschnitt erläutert das Konzept der deliberativen Demokratie, insbesondere im Hinblick auf das Habermas'sche Verständnis. Es werden die zentralen Elemente des Paradigmas beleuchtet, wie die Bedeutung der öffentlichen Sphäre als kommunikativer Raum zwischen Gesellschaft und politischem System sowie die Rolle des Diskurses für die Willensbildung und die Begründung von Normen.
Die Rolle der Öffentlichkeit
Das Kapitel fokussiert auf die Habermas'sche Konzeption der Öffentlichkeit als politische Sphäre, die durch Sachlichkeit, Zeitlichkeit und soziale Unbegrenztheit gekennzeichnet ist. Es wird die Bedeutung der Öffentlichkeit als Agenda-Setter und Kontrolleur des politischen Systems hervorgehoben sowie die Rolle der Massenmedien in der Konstitution der Öffentlichkeit diskutiert.
Der Diskurs – Bedeutung und Bedingungen
Dieser Abschnitt beleuchtet die zentrale Rolle des Diskurses in der deliberativen Demokratie. Es wird das Habermas'sche Verständnis von Diskurs als einem Prozess der Klärung von Gültigkeitsansprüchen erläutert. Darüber hinaus werden die Bedingungen für einen argumentativen Diskurs, wie die Notwendigkeit der argumentativen Gestaltung und die Akzeptanz bestimmter Prinzipien, diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen der deliberativen Demokratie, Online-Diskurse, Partizipation, Diskursqualität, Öffentlichkeit, Massenmedien und das Internet als Diskursplattform. Im Mittelpunkt stehen die Frage, ob und wie das Internet zur Verwirklichung deliberativer Ideale beitragen kann, sowie die Analyse der Gleichheit der Partizipation und der Qualität des Diskurses in Online-Diskursen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist deliberative Demokratie?
Ein Demokratiemodell, das auf der öffentlichen Beratung (Deliberation) und dem Austausch von Argumenten als Grundlage für legitime politische Entscheidungen basiert.
Welche Rolle spielt Jürgen Habermas in diesem Kontext?
Habermas prägte das deliberative Paradigma entscheidend, insbesondere durch seine Theorien zur Öffentlichkeit und zum herrschaftsfreien Diskurs.
Fördert das Internet eine gleichberechtigte politische Teilhabe?
Die Arbeit untersucht empirisch, ob das Netz tatsächlich Barrieren abbaut oder ob bestehende Ungleichheiten in der Partizipation bestehen bleiben.
Wie wird die Qualität von Online-Diskursen bewertet?
Kriterien sind unter anderem die Sachlichkeit, die argumentative Tiefe und die Fairness im Umgang mit anderen Meinungen.
Kann das Internet die Demokratie stärken?
Das Internet bietet neue Räume für Öffentlichkeit, doch die Arbeit hinterfragt kritisch, ob diese Räume die normativen Ideale der Deliberation tatsächlich erfüllen.
- Citar trabajo
- Christian Orth (Autor), 2013, Das Internet als Schlüssel zur deliberativen Demokratie?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230043