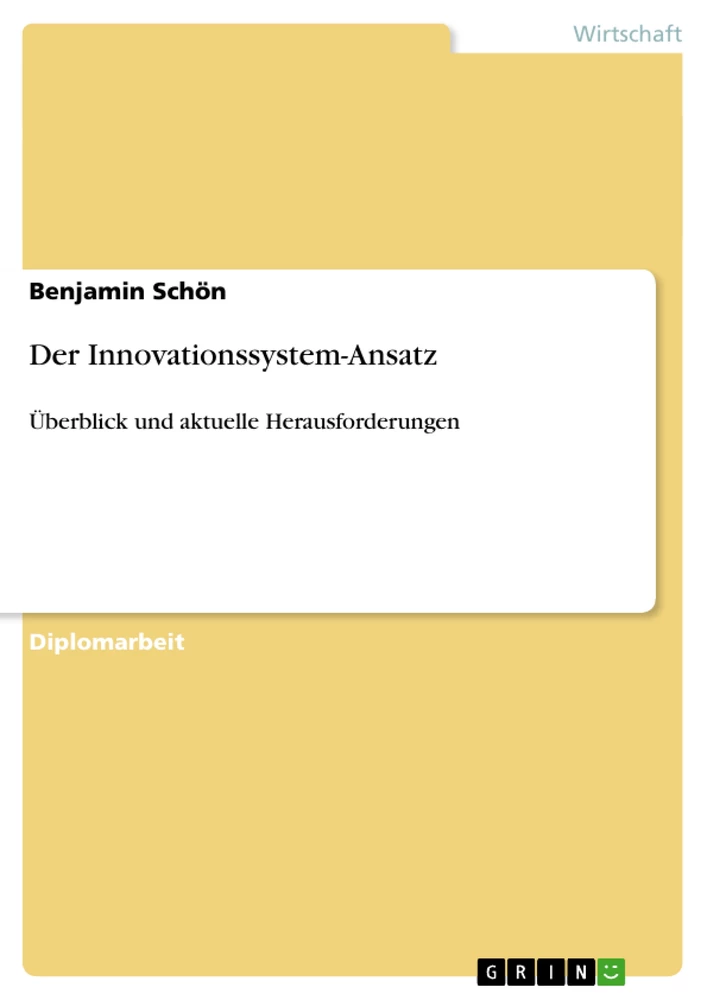Die Bedeutung von Innovation als ein entscheidender Faktor für wirtschaftliches Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit einzelner Unternehmen und Branchen, aber auch ganzer Regionen und Volkswirtschaften, ist in der heutigen ’wissensbasierten Wirtschaft’ unbestritten.
Durch Innovation sind Unternehmen in der Lage ihre Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und so zum Wachstum und Wohlstand ihrer Region und Nation beizutragen. Die zunehmende technologische Komplexität neuer Produkte und Verfahren, der steigende
Wettbewerbsdruck einer globalisierten Wirtschaft und die damit einhergehende Verkürzung der Produktlebenszyklen, machen es den einzelnen Akteuren jedoch zunehmend schwer, die erforderliche Innovationsleistung im Alleingang zu erbringen. Entsprechend basiert der moderne Innovationsprozess weniger auf den Leistungen einzelner Individuen oder Unternehmen, als vielmehr auf der Interaktion einer Vielzahl von heterogenen Akteuren in kooperativen Netzwerken und Systemen. An dieser Interaktion beteiligt sind neben vertikal verbundenen Unternehmen (Zulieferer und Abnehmer), auch Wettbewerber und Dienstleiter, sowie Akteure der Wissenschaft (Universitäten, Forschungs- und Transfereinrichtungen) und Politik (Ämter, Behörden und Ministerien). Nur durch die Realisierung von Synergieeffekten aus der Vernetzung und Verschmelzung heterogener Wissensbasen und Kompetenzen, können die erforderlichen Ressourcen freigesetzt und auf effiziente Weise im Innovationsprozess eingesetzt werden. Die Beziehungen zwischen diesen Akteuren beinhalten sowohl den Transfer von Gütern und Dienstleistungen über den Markt, als auch den informellen Austausch von Wissen und Information. Damit eine derartige Interaktion überhaupt möglich ist, bedarf es eines gemeinsamen, institutionellen Rahmens (Gesetze, Normen, Regeln, Verhaltensweisen etc.), in welchen sowohl die Akteure selbst, als auch deren Beziehungen eingebunden sind.
Das sich aus diesen Zusammenhängen ergebende System institutionell determinierter Interaktion, ist gekennzeichnet von Interdependenzen, Wechselwirkungen und Feedback zwischen seinen Elementen. Die Veränderung nur einer Komponente, führt auch zu einer Veränderung des Systems als Ganzes. Neues Wissen beispielsweise, erweitert die Wissensbasis des betreffenden Bereiches (Region, Nation, Technologie, Sektor) und eröffnet neue technologische oder organisatorische Möglichkeiten und Marktchancen.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- KOOPERATION UND NETZWERKE ALS GRUNDLAGE VON INNOVATIONSSYSTEMEN
- SPILLOVER, TAZITES WISSEN UND DIE BEDEUTUNG VON RÄUMLICHER NÄHE
- Der Cluster-Ansatz
- Die Innovationssystem-Ansätze
- Begriffsklärung
- Definition von Innovation
- Definition von System
- Definition von Innovationssystem
- Das Regionale Innovationssystem
- Arten Regionaler Innovationssysteme
- Die Wissensbasis
- Die systemische Eingebundenheit
- Die institutionelle und soziale Eingebundenheit
- Die Barrieren
- Regionale Innovationssysteme, externes Wissen und nationale Institutionen
- Das Nationale Innovationssystem
- Die Rolle von Institutionen im Innovationssystem-Ansatz
- Nationale Innovationssysteme, Globalisierung und Regionalisierung
- Das Internationale Innovationssystem
- Das Sektorale Innovationssystem
- Das Technologische Innovationssystem
- Zusammenfassung der Erkenntnisse
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Innovationssystem-Ansätze
- Wann welcher Ansatz sinnvoll ist
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Verzeichnis der Intemetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Innovationssystem-Ansatz und dessen aktuellen Herausforderungen. Ziel ist es, die verschiedenen Ansätze des Innovationssystems zu erläutern und zu analysieren, um ein umfassendes Verständnis des modernen Innovationsprozesses zu erlangen.
- Die Bedeutung von Kooperation und Netzwerken für die Generierung und Verbreitung von Innovationen
- Die Rolle von Spillover und tazitem Wissen für den Innovationsprozess
- Die verschiedenen Arten von Innovationssystemen (regional, national, international, sektoral, technologisch)
- Die Bedeutung von Institutionen für die Gestaltung von Innovationssystemen
- Die Herausforderungen des Innovationssystem-Ansatzes im Kontext von Globalisierung und Regionalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Grundlagen des Innovationssystem-Ansatzes. Es werden die Bedeutung von Kooperation und Netzwerken, sowie die Rolle von Spillover und tazitem Wissen für den Innovationsprozess erläutert. Der Cluster-Ansatz als eine spezielle Form der räumlichen Konzentration von innovativer Tätigkeit wird ebenfalls vorgestellt.
Das dritte Kapitel stellt die verschiedenen Ansätze des Innovationssystems vor. Neben den territorialen Ansätzen (regional, national, international) werden auch die technologiebasierten Ansätze (sektoral, technologisch) betrachtet. Es werden die jeweiligen Elemente, Beziehungen, Institutionen und Dynamiken der einzelnen Ansätze dargestellt und analysiert.
Das vierte Kapitel fasst die Erkenntnisse der vorangegangenen Kapitel zusammen und beschreibt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen IS-Ansätze. Es wird untersucht, welcher Ansatz in welchem Zusammenhang am besten geeignet ist, um gezielte Handlungsempfehlungen abzuleiten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Innovationssystem-Ansatz, die Generierung, Diffusion und Nutzung von Innovationen, die Interaktion heterogener Akteure, die Bedeutung von Institutionen, Spillover, tazites Wissen, räumliche Nähe, Cluster, Regionale Innovationssysteme, Nationale Innovationssysteme, Internationale Innovationssysteme, Sektorale Innovationssysteme, Technologische Innovationssysteme, Globalisierung, Regionalisierung, und die Herausforderungen des Innovationssystem-Ansatzes.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern des Innovationssystem-Ansatzes?
Der Ansatz besagt, dass Innovation nicht isoliert in einem Unternehmen entsteht, sondern durch die Interaktion verschiedener Akteure wie Firmen, Universitäten und Politik in einem gemeinsamen Rahmen.
Warum ist räumliche Nähe für Innovation wichtig?
Räumliche Nähe erleichtert den Austausch von „tazitem Wissen“ (Erfahrungswissen), das schwer zu kodifizieren ist, und fördert Synergieeffekte durch informelle Kontakte.
Was unterscheidet ein nationales von einem regionalen Innovationssystem?
Nationale Systeme konzentrieren sich auf den institutionellen Rahmen eines Landes (Gesetze, Bildung), während regionale Systeme die spezifische Vernetzung und Clusterbildung in einer bestimmten geografischen Zone betrachten.
Was ist ein sektorales Innovationssystem?
Hier liegt der Fokus auf einer bestimmten Branche (Sektor). Es wird untersucht, wie technologische Trends und Akteure innerhalb dieses spezifischen Marktes interagieren.
Welche Rolle spielen Institutionen im Innovationsprozess?
Institutionen wie Gesetze, Normen und Regeln bilden den stabilen Rahmen, der Kooperationen erst ermöglicht und Anreize für Forschung und Entwicklung setzt.
- Quote paper
- Benjamin Schön (Author), 2006, Der Innovationssystem-Ansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230083