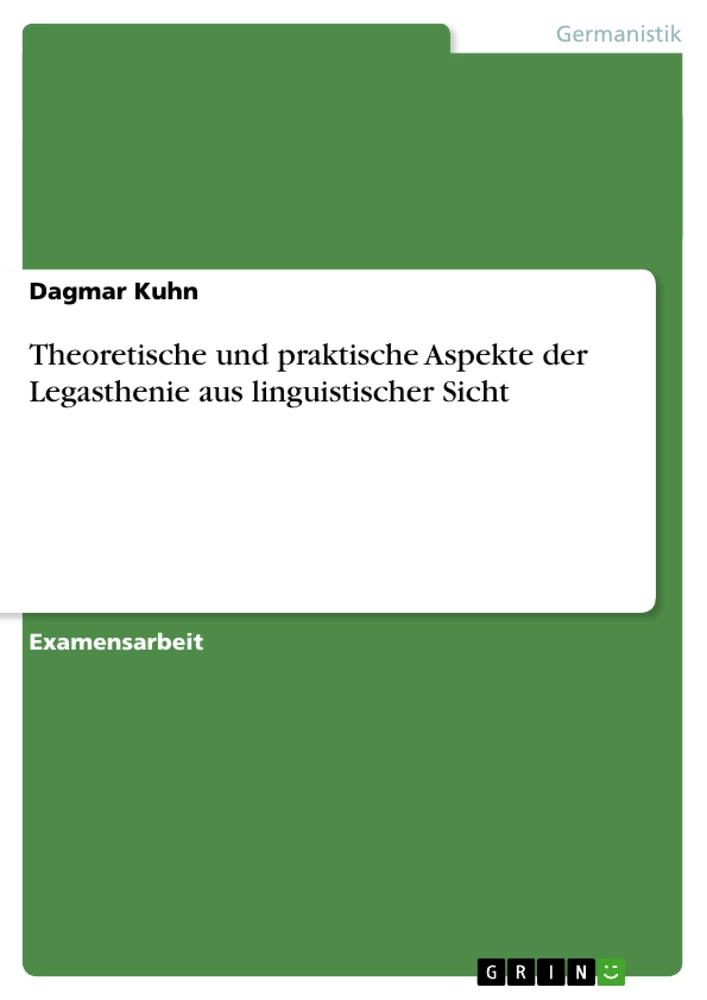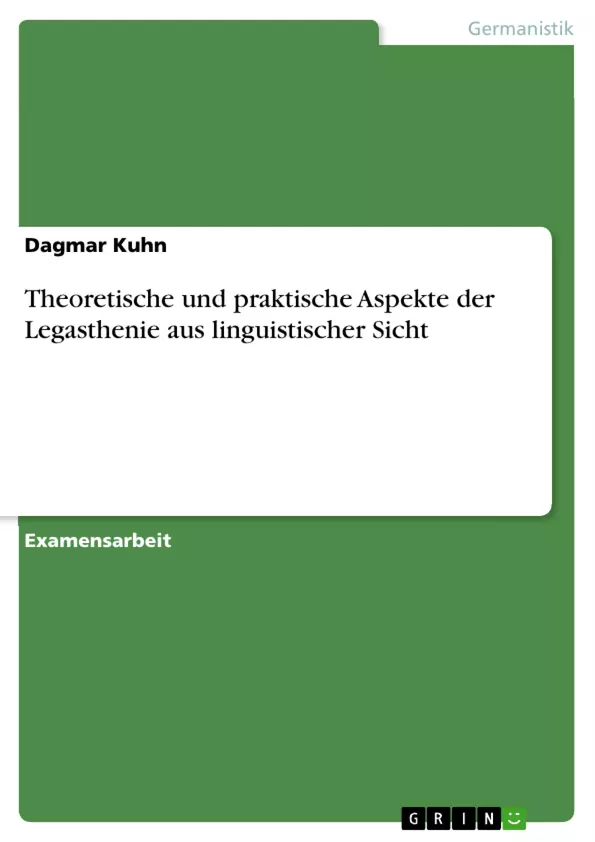Seit Ende des 19. Jahrhunderts betrachtet man das Thema „Legasthenie“ aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. In dieser Arbeit erfolgt die Analyse schwerpunktmäßig aus linguistischer Sicht.
Linguistik ist ein synonymer Begriff für Sprachwissenschaft, eine „wissenschaftliche Disziplin, deren Ziel es ist, Sprache und Sprechen unter allen theoretisch und praktisch relevanten Aspekten und in allen Beziehungen zu angrenzenden Disziplinen 1 zu beschreiben“ . Bei der Untersuchung der menschlichen Sprache wird zwischen verschiedenen Aspekten differenziert: Bewegt man sich auf der Ebene der Zeichen und ihrer Systematik, so ergeben sich die Teildisziplinen der
- Phonologie (Lehre von den Sprachlauten),
- Morphologie (Formenlehre),
- Wortbildung,
- Syntax (Lehre vom Satzbau),
- Semantik (Lehre von den Bedeutungen),
- Pragmatik (Sprachverhalten) und
- Textlinguistik,
die man sowohl synchronisch, d.h. als Sprachzustand als auch diachronisch, d.h. bezüglich ihrer historischen Entwicklung betrachten kann. Die Sprachproduktion und -wahrnehmung des Menschen, in deren Bezug der Spracherwerb und auch die Sprachstörungen stehen, sind Aufgabenfeld der Psycho- und Neurolinguisten. Daneben beschäftigen sich die Sozio- und Ethnolinguistik mit den soziologischen Bedingungen, die mit der Sprache verknüpft sind, wozu auch der Einfluss der Dialekte zählt. Das Themenfeld wird schließlich noch durch Fragen der angewandten Sprach- 2 wissenschaft ergänzt, die sich z.B. mit der Fremdsprachendidaktik auseinandersetzt. Diese Arbeit setzt sich aus einer Kombination der Themenbereiche „Phonologie“ sowie „Sprachproduktion und -wahrnehmung“ zusammen, wobei insbesondere Störungen der Lautwahrnehmung eine zentrale Rolle spielen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung - Ziel der Arbeit
- 2 Legasthenie - Was ist das eigentlich?
- 2.1 Historischer Überblick über Forschung und Begriffsverständnis
- 2.1.1 Somatisch-medizinischer Ansatz
- 2.1.2 Spezifisch-psychologischer Ansatz
- 2.1.3 Empirisch-pädagogischer Ansatz
- 2.1.4 Bildungspolitisch-administrativer Ansatz
- 2.1.5 Interaktional-systemischer Ansatz
- 2.1.6 Neurobiologisch-integrativer Ansatz
- 2.1.7 Linguistisch-orientierter Ansatz
- 2.1.8 Resümee und aktueller Stand
- 2.2 Ursachen der Legasthenie
- 2.2.1 Befunde zur Genetik
- 2.2.2 Befunde zur auditiven Wahrnehmung
- 2.2.3 Befunde zur visuellen Wahrnehmung
- 2.2.4 Resümee
- 2.3 Symptomatik der Legasthenie
- 2.3.1 Kategorielle Symptome der Legasthenie
- 2.3.1.1 Lesen
- 2.3.1.2 Rechtschreibung
- 2.3.1.3 Gesprochene Sprache
- 2.3.1.4 Merkfähigkeit
- 2.3.1.5 Motorik
- 2.3.1.6 Verhaltensauffälligkeiten
- 2.3.2 Beispielhafte Erscheinungsbilder von Legasthenikern
- 2.3.2.1 Fallbeispiel Peter (1. Klasse)
- 2.3.2.2 Fallbeispiel Tim (1. Klasse)
- 2.3.2.3 Fallbeispiel Felix (2. Klasse)
- 2.3.3 Resümee
- 2.3.1 Kategorielle Symptome der Legasthenie
- 2.1 Historischer Überblick über Forschung und Begriffsverständnis
- 3 Der Schriftspracherwerb und die damit verbundenen Schwierigkeiten
- 3.1 Was geschieht beim Lesen und Schreiben?
- 3.1.1 Zwei-Wege-Modell des Lesens von COLTHEART
- 3.1.2 Rechtschreibmodell von SIMON & SIMON
- 3.1.3 Resümee
- 3.2 Modelle des Lesen- und Schreibenlernens
- 3.2.1 Das 5-phasige Entwicklungsmodell von GÜNTHER
- 3.2.2 Modell für die Lese- und Schreibentwicklung von VALTIN
- 3.2.3 Erwerb des orthographischen Monitors nach MAAS
- 3.2.4 Resümee
- 3.3 Alphabetisches Prinzip als Hürde zum Erfolg
- 3.3.1 Entwicklung des alphabetischen Schriftsystems
- 3.3.2 Warum verursacht das alphabetische Prinzip Schwierigkeiten?
- 3.3.2.1 Phon/Phonem und Graph/Graphem
- 3.3.2.2 Phonem-Graphem-Korrespondenz
- 3.3.3 Resümee
- 3.4 Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb
- 3.4.1 Allgemeine kognitive Fertigkeiten
- 3.4.2 Spezielle visuelle Fertigkeiten
- 3.4.3 Gedächtnisfertigkeiten
- 3.4.4 Sprachliche Fertigkeiten
- 3.4.4.1 Allgemeine sprachliche Fertigkeiten
- 3.4.4.2 Phonologische Informationsverarbeitung
- 3.4.4.2.1 Phonologische Bewusstheit
- 3.4.4.2.2 Phonologische Rekodierung beim Zugriff auf das semantische Lexikon
- 3.4.4.2.3 Phonetische Rekodierung im Arbeitsgedächtnis
- 3.4.5 Abhängigkeitsverhältnisse und Auswirkungen der Voraussetzungen
- 3.4.5.1 Leseverständnis als Kriterium
- 3.4.5.2 Rechtschreiben als Kriterium
- 3.4.6 Resümee
- 3.1 Was geschieht beim Lesen und Schreiben?
- 4 Überprüfung der phonologischen Bewusstheit
- 4.1 Notwendigkeit, Schwierigkeiten und Grenzen einer frühen Identifikation von Risikokindern
- 4.2 Bielefelder Screening-Verfahren (BISC) zur Identifikation von LRS-Risikokindern
- 4.2.1 Testbereiche und ihre Aufgaben
- 4.2.2 Durchführung und Auswertung
- 4.2.3 Zuverlässigkeit und Gültigkeit
- 4.3 Spezielle Aufgaben zur Überprüfung der phonologischen Bewusstheit
- 4.4 Resümee
- 5 Förderung phonologischer Bewusstheit im Vorschul- und Grundschulalter
- 5.1 Erkenntnisse der skandinavischen Forschergruppe um LUNDBERG
- 5.2 Trainingsprogramme von SCHNEIDER et al.
- 5.2.1 Die Trainingsprogramme und ihr Einsatz
- 5.2.2 Würzburger Trainingsprogramm (WüT)
- 5.2.2.1 Grundprinzip der Fördermaßnahmen
- 5.2.2.2 Sprachprogramm zur Buchstaben-Laut-Verknüpfung
- 5.2.2.3 Kombiniertes Training der phonologischen Bewusstheit und der Buchstaben-Laut-Verknüpfung
- 5.2.3 Wissenschaftliche Überprüfung der Wirksamkeit
- 5.2.3.1 Erste Trainingsstudie zur phonologischen Bewusstheit
- 5.2.3.2 Zweite Trainingsstudie zur phonologischen Bewusstheit
- 5.2.3.3 Trainingsstudie zur phonologischen Verknüpfungshypothese
- 5.3 Förderphon: Förderkonzept in Schleswig-Holstein
- 5.4 Resümee
- 6 Abschließendes Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht theoretische und praktische Aspekte der Legasthenie aus linguistischer Perspektive. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Legasthenie zu entwickeln, indem verschiedene Forschungsansätze beleuchtet und deren Bedeutung für Diagnose und Förderung erörtert werden.
- Historische Entwicklung des Legasthenie-Begriffs und verschiedener Forschungsansätze
- Ursachen und Symptome der Legasthenie
- Prozesse des Schriftspracherwerbs und Schwierigkeiten beim Lesen und Schreibenlernen
- Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für den Schriftspracherwerb
- Förderung phonologischer Bewusstheit im Vorschul- und Grundschulalter
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung - Ziel der Arbeit: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, die theoretischen und praktischen Aspekte der Legasthenie aus linguistischer Sicht zu untersuchen. Es wird die Bedeutung des Themas für die Pädagogik hervorgehoben und der Aufbau der Arbeit skizziert. Die Einleitung legt den Fokus auf die linguistische Perspektive, um ein differenziertes Verständnis der Legasthenie zu ermöglichen. Diese Perspektive bietet eine Grundlage für die Analyse der Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb und die Entwicklung effektiver Fördermaßnahmen.
2 Legasthenie - Was ist das eigentlich?: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den Begriff der Legasthenie. Es werden verschiedene historische Ansätze zur Erklärung und zum Verständnis von Legasthenie vorgestellt, angefangen von somatisch-medizinischen bis hin zu linguistisch-orientierten Ansätzen. Der historische Abriss zeigt die Entwicklung des Verständnisses von Legasthenie auf und verdeutlicht die Komplexität der Thematik. Die Darstellung verschiedener Erklärungsmodelle ermöglicht ein differenziertes Bild und unterstreicht die Notwendigkeit einer multiperspektivischen Betrachtungsweise. Schließlich werden die Ursachen und Symptome von Legasthenie umfassend beleuchtet, wobei die Kapitel 2.2 und 2.3 detailliert auf die Befunde zu den verschiedenen Ursachen und die jeweilige Symptomatik eingehen und diese mit Fallbeispielen illustrieren.
3 Der Schriftspracherwerb und die damit verbundenen Schwierigkeiten: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Prozess des Schriftspracherwerbs und den Schwierigkeiten, die bei Legasthenikern auftreten. Es werden verschiedene Modelle des Lesen- und Schreibenlernens vorgestellt und analysiert, darunter das Zwei-Wege-Modell des Lesens von Coltheart und das Rechtschreibmodell von Simon & Simon. Der Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung des alphabetischen Prinzips und den damit verbundenen Herausforderungen. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen kognitiven, visuellen und sprachlichen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb und untersucht die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen diesen Voraussetzungen. Die detaillierte Analyse der Modelle und die Berücksichtigung der verschiedenen Voraussetzungen ermöglichen ein tiefes Verständnis der Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb bei Kindern mit Legasthenie.
4 Überprüfung der phonologischen Bewusstheit: Das Kapitel thematisiert die frühzeitige Identifizierung von Risikokindern und die Notwendigkeit, Schwierigkeiten und Grenzen dieser frühen Identifikation. Es wird das Bielefelder Screening-Verfahren (BISC) detailliert beschrieben, einschließlich seiner Testbereiche, Durchführung, Auswertung, sowie Zuverlässigkeit und Gültigkeit. Zusätzlich werden spezielle Aufgaben zur Überprüfung der phonologischen Bewusstheit vorgestellt. Die detaillierte Darstellung des BISC und der weiteren Aufgaben bietet eine praktische Grundlage für die frühzeitige Erkennung von Legasthenie-Risiken.
5 Förderung phonologischer Bewusstheit im Vorschul- und Grundschulalter: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Förderung der phonologischen Bewusstheit im Vorschul- und Grundschulalter. Es werden die Erkenntnisse skandinavischer Forschergruppen um Lundberg sowie die Trainingsprogramme von Schneider et al. vorgestellt und erläutert. Die verschiedenen Trainingsprogramme, einschließlich des Würzburger Trainingsprogramms (WüT), werden detailliert beschrieben, inklusive ihrer Prinzipien und Anwendung. Der Fokus liegt auf der wissenschaftlichen Überprüfung der Wirksamkeit dieser Programme. Durch die detaillierte Darstellung verschiedener Förderansätze wird ein umfassender Überblick über Möglichkeiten der frühzeitigen Intervention und gezielten Förderung gegeben.
Schlüsselwörter
Legasthenie, Schriftspracherwerb, Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS), phonologische Bewusstheit, phonologische Informationsverarbeitung, Diagnostik, Förderung, linguistiche Perspektive, Modell des Lesenlernens, Modell des Schreibenlernens, frühe Intervention, Risikokinder.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Legasthenie - Ein linguistischer Ansatz
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Legasthenie aus linguistischer Perspektive. Sie beleuchtet theoretische und praktische Aspekte, fokussiert auf Diagnose und Förderung, und betrachtet verschiedene Forschungsansätze.
Welche Aspekte der Legasthenie werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Legasthenie-Begriffs, verschiedene Erklärungsmodelle (somatisch-medizinisch, psychologisch, pädagogisch, etc.), Ursachen (Genetik, auditive und visuelle Wahrnehmung), Symptome (Lesen, Schreiben, Sprache, etc.), Prozesse des Schriftspracherwerbs, Schwierigkeiten beim Lesen und Schreibenlernen, die Bedeutung phonologischer Bewusstheit, und Fördermöglichkeiten im Vorschul- und Grundschulalter.
Welche Modelle des Lesen- und Schreibenlernens werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt das Zwei-Wege-Modell des Lesens von Coltheart, das Rechtschreibmodell von Simon & Simon, das 5-phasige Entwicklungsmodell von Günther, das Modell von Valtin zur Lese- und Schreibentwicklung und den Erwerb des orthographischen Monitors nach Maas.
Welche Rolle spielt die phonologische Bewusstheit?
Die phonologische Bewusstheit wird als zentrale Voraussetzung für den erfolgreichen Schriftspracherwerb betrachtet. Die Arbeit untersucht ihre Bedeutung und beschreibt Methoden zu ihrer Überprüfung und Förderung.
Welche diagnostischen Verfahren werden erläutert?
Das Bielefelder Screening-Verfahren (BISC) zur Identifikation von LRS-Risikokindern wird detailliert beschrieben, inklusive Durchführung, Auswertung, Zuverlässigkeit und Gültigkeit. Zusätzlich werden weitere spezifische Aufgaben zur Überprüfung der phonologischen Bewusstheit vorgestellt.
Welche Förderprogramme werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert die Erkenntnisse der skandinavischen Forschergruppe um Lundberg und die Trainingsprogramme von Schneider et al., insbesondere das Würzburger Trainingsprogramm (WüT). Die Wirksamkeit dieser Programme wird anhand wissenschaftlicher Studien untersucht. Das Förderkonzept "Förderphon" aus Schleswig-Holstein wird ebenfalls erwähnt.
Welche Forschungsansätze zur Legasthenie werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht verschiedene historische Forschungsansätze zur Legasthenie: somatisch-medizinisch, spezifisch-psychologisch, empirisch-pädagogisch, bildungspolitisch-administrativ, interaktional-systemisch, neurobiologisch-integrativ und linguistisch-orientiert.
Gibt es Fallbeispiele?
Ja, die Arbeit enthält Fallbeispiele von Legasthenikern (Peter, Tim und Felix), die die beschriebenen Symptome illustrieren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Definition und Verständnis von Legasthenie, Schriftspracherwerb und Schwierigkeiten, Überprüfung der phonologischen Bewusstheit, Förderung der phonologischen Bewusstheit und abschließendes Resümee. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist enthalten.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich umfassend mit der Legasthenie auseinandersetzen möchten, insbesondere Pädagoginnen und Pädagogen, Logopädinnen und Logopäden, sowie Studierende der Sprachwissenschaften und der Pädagogik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Legasthenie, Schriftspracherwerb, Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS), phonologische Bewusstheit, phonologische Informationsverarbeitung, Diagnostik, Förderung, linguistische Perspektive, Modell des Lesenlernens, Modell des Schreibenlernens, frühe Intervention, Risikokinder.
- Citar trabajo
- Dagmar Kuhn (Autor), 2003, Theoretische und praktische Aspekte der Legasthenie aus linguistischer Sicht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23011