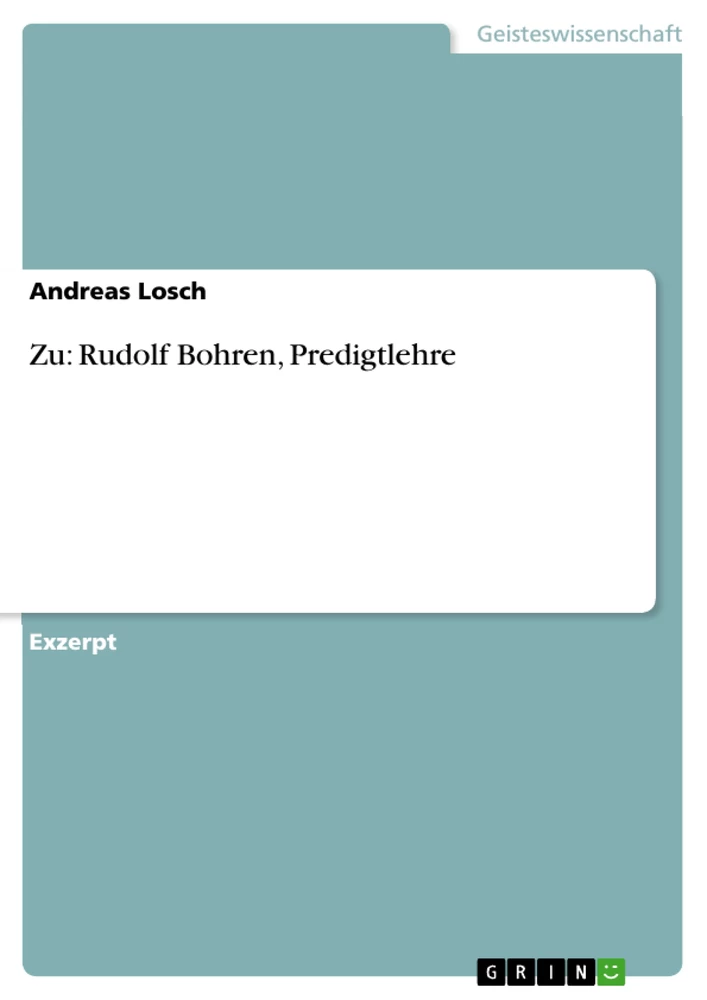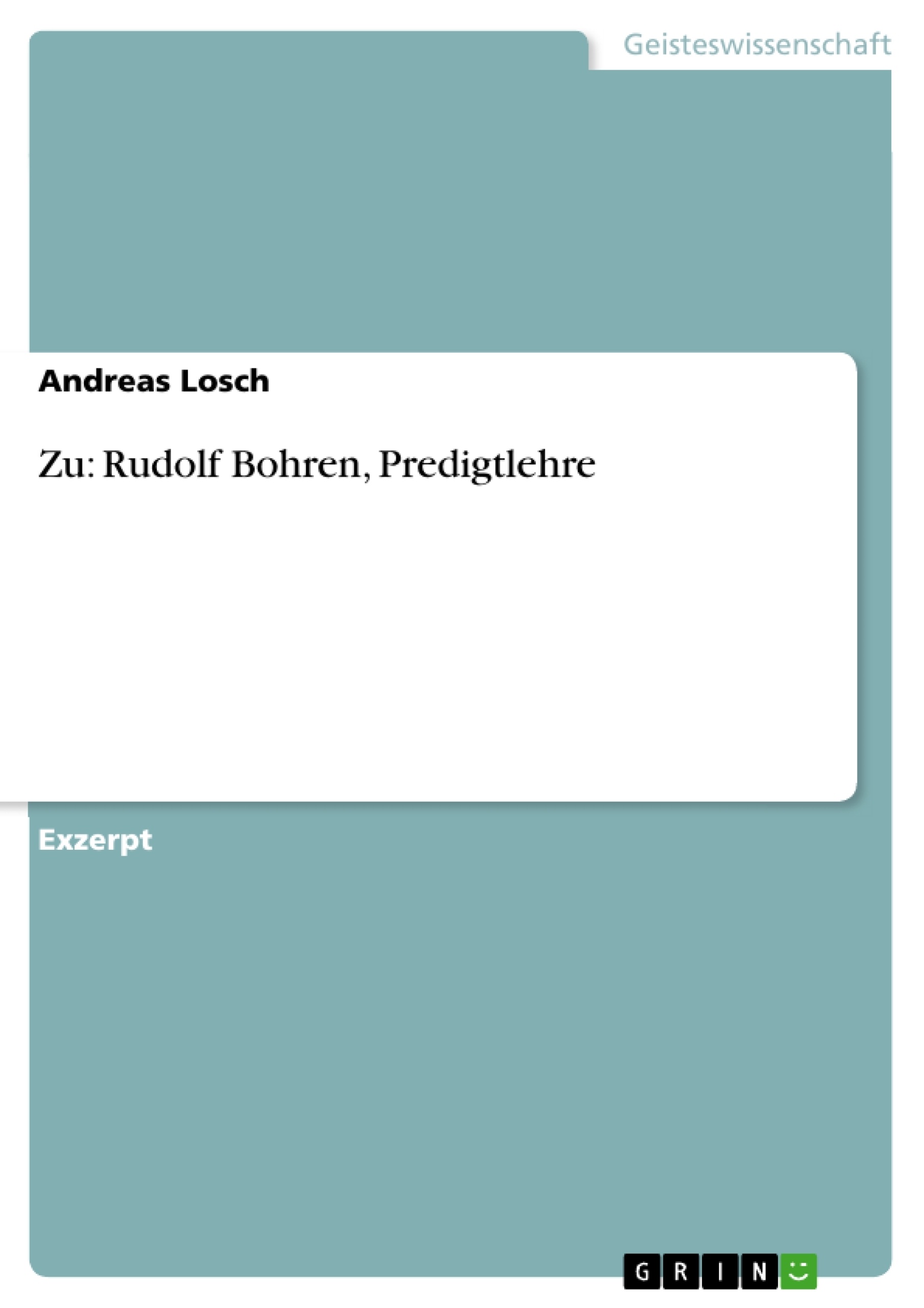Predigtlehre ist Lehre zur Freude
Der Prediger ist homo ludens (Prov. 8,30): Spiel
Er kann nicht „machen“, was die Predigt leisten soll.
Wagnis um Leben und Tod: Brandstifter zu sein, zu sagen „Gott“. In diesem Nichtkönnen wagen und im Wagen „können“.
Leiden(-schaft), Passion: Aus dem Predigtzwang (1.Kor 9,16) ergibt sich die Notwendigkeit der Predigtlehre
Predigthörer haben es auch schwer, zuhören ist schwerer als reden
Wunder ist und Wunder wird indem sich einer selbst wagt
Darauf warten die Gemeinden, auf eine Predigt in neuen Zungen.
Wir predigen den Kommenden, deswegen keine Passion ohne Freude!
[...]
Inhaltsverzeichnis
- ERSTER TEIL: ANLÄUFE
- §1 PREDIGEN ALS LEIDENSCHAFT
- §2 VIER VERLEGENHEITEN
- I Die Schwierigkeit mit Gott
- Il Von Gott reden in einer sprachlosen Welt
- III Sprachlose Kirche
- IV Die Schwierigkeit mit sich selbst
- §3 VORFRAGEN
- I Zur Definition der Predigt
- II Zur Methode der Predigtlehre
- III Aufgabe, Anlage und Aufbau der vorliegenden Homiletik
- ZWEITER TEIL: DAS WOHER DER PREDIGT
- §4 DER HEILIGE GEIST
- I Begründung der Homiletik
- Il Die Bedeutung der Pneumatologie für die Homiletik
- III Der Heilige Geist als Geber und Gabe des Wortes
- §5 DER NAME
- | Legitimation der Predigt im Namen
- Il Der Name als hermeneutisches Problem
- III Der Dienst an der Identität
- IV Hinweis auf KOHLBRÜGGE
- V Keine Teufelspredigt
- §6 DIE SCHRIFT
- I Die Schrift als Ur-Kunde des Namens
- Il Die Schrift als Dokument des schenkenden Geistes
- III Das Schriftganze
- IV Text und Textwahl
- V Alttestamentliche Predigt
- VI Kleines Lob der Homilie
- §7 WORT UND GEIST
- I Einheit als Ereignis
- II Hermeneutik als Erweiterung der Sprache
- III Folgerungen für den Predigt-Stil
- IV Zeitformen
- §8 PREDIGT ZWISCHEN EXEGESE UND KOMMUNIKATIONSFORSCHUNG
- I Vorüberlegung
- II Exegese
- III Kommunikationsforschung
- DRITTER TEIL: DIE ZEITFORMEN DES WORTES ERINNERUNG - VERHEISSUNG GEGENWART
- §9 DIE BEGRÜNDUNG DER PREDIGT IN GOTTES ERINNERUNG
- | Biblisch-Theologische Meditation über die Erinnerung
- Il Erinnerung - historische Kritik - Sprache
- III Der Dienst der Erinnerung
- IV Abendmahl und predigendes Erzählen
- §10 PREDIGT ALS ERZÄHLUNG
- I Predigendes Erzählen
- Il Passions erzählung
- III Kalendergeschichten
- IV Legendarisches Erzählen
- V Lehr-Erzählung
- VI Interpretation der Existenz
- VII Gefahren
- §11 PREDIGT UND ZITAT
- I Vorbesinnung
- Il Weisen des Zitierens
- III Exkurs: Vom Gebrauch fremder Predigten
- IV Die Collage
- V Schriftbeweis und Montage
- §12 ERINNERUNG AN DIE SÜNDE
- I Menschlich von der Sünde reden!
- Die Suche nach der Quelle und dem Wesen des Wortes Gottes in der Predigt
- Die Rolle des Heiligen Geistes als Inspirationsquelle und das Verhältnis von Göttlichem und Menschlichem im Sprachgeschehen
- Die Bedeutung des Namens Jesu Christi und seiner Verankerung in der Heiligen Schrift
- Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Zeitformen und ihrer Vermittlung in der Predigt: Vergangenheit (Erinnerung), Gegenwart und Zukunft (Verheißung)
- Die Integration von Exegese und Kommunikationsforschung in der Predigtpraxis
- §1: Der Autor plädiert für das Predigen aus Leidenschaft, da eine „Müdigkeit auf der Kanzel“ herrscht. Er stellt sich selbst als leidenschaftlichen Prediger vor und betont die Freude und das Wagnis des Predigens.
- §2: Der Autor analysiert die Verlegenheit des Predigers, die aus der Sprachlosigkeit gegenüber Gott, der Welt, der Kirche und dem eigenen Selbst resultiert.
- §3: Das Grundproblem der Homiletik wird als Frage nach dem Verhältnis von Predigt und Wort Gottes aufgeworfen. Die Notwendigkeit einer Sprachlehre des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung wird hervorgehoben.
- §4: Die Überwindung der Sprachlosigkeit wird mit dem Kommen des Heiligen Geistes begründet. Das Verhältnis von Göttlichem und Menschlichem im Sprachgeschehen und die Bedeutung der Pneumatologie für die Homiletik werden beleuchtet.
- §5: Die Predigt erhält ihre Legitimation durch den Namen Jesu Christi. Der Name als hermeneutisches Problem und der Dienst an der Identität werden diskutiert.
- §6: Die Heilige Schrift als Ur-Kunde und Dokument des Heiligen Geistes bildet die Grundlage für die Predigt. Die Bedeutung der Textwahl und der alttestamentlichen Predigt werden betont.
- §7: Das Verhältnis von Wort und Geist als Ausgangspunkt und Ziel des Predigens wird untersucht. Ein sprachphilosophischer und ein hermeneutischer Exkurs verdeutlichen das Problem der Spracherweiterung durch die Bibel.
- §8: Der Autor befasst sich mit der Bedeutung von Exegese und Kommunikationsforschung für die Predigt. Exegese hilft, den Text zu verstehen, Kommunikationsforschung betrachtet die Wirkung der Predigt.
- §9: Der Autor analysiert die Zeitform der Erinnerung in der Predigt. Die Vergangenheit wird in der Erinnerung vergegenwärtigt und schöpferisch werden lassen.
- §10: Das Erzählen wird als wesentlicher Bestandteil der Predigt dargestellt. Die Passion als Ur-Geschichte und das predigendes Erzählen in verschiedenen Formen werden diskutiert.
- §11: Zitieren wird als Kunst betrachtet. Die Funktion des Zitats in der modernen Literatur und verschiedene Weisen des Zitierens werden vorgestellt.
- §12: Die Sünde als Thema der Predigt wird diskutiert. Die Sünde der Väter und die Notwendigkeit, menschlich von der Sünde zu reden, werden betont.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Predigtlehre befasst sich mit der Frage, wie in der heutigen Zeit die Predigt als Wort Gottes relevant und wirkungsvoll bleiben kann. Sie analysiert die Herausforderungen und Verlegenheiten des Predigens, die durch Sprachlosigkeit, Zweifel an der Machbarkeit und den Verlust des Sinns von Traditionen entstehen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Predigtlehre von Rudolf Bohren beschäftigt sich mit zentralen Themen der Predigt im Kontext des 20. Jahrhunderts. Sie konzentriert sich auf die Frage nach der Legitimation des Wortes Gottes in der Predigt, der Rolle des Heiligen Geistes, der Bedeutung des Namens Jesu Christi und der Vermittlung von biblischem Wissen in der heutigen Zeit. Zu den zentralen Schlüsselbegriffen gehören: Pneumatologie, Hermeneutik, Sprachlosigkeit, Name, Schrift, Exegese, Kommunikationsforschung, Zeitformen, Erinnerung, Erzählen und Zitat.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Anliegen von Rudolf Bohrens Predigtlehre?
Bohren sucht nach Wegen, wie die Predigt in einer "sprachlosen Welt" wieder als leidenschaftliches Wort Gottes relevant werden kann.
Welche Rolle spielt der Heilige Geist (Pneumatologie)?
Der Heilige Geist wird als Geber und Gabe des Wortes betrachtet; er ist die Kraft, die die menschliche Sprachlosigkeit überwindet.
Was versteht Bohren unter "predigendem Erzählen"?
Er sieht im Erzählen (z. B. von Passionsgeschichten oder Legenden) eine wesentliche Form, um biblische Wahrheiten lebendig zu vermitteln.
Wie wird das Zitieren in der Predigt bewertet?
Zitieren wird als Kunstform (Montage/Collage) verstanden, die hilft, die Schrift auszulegen und Bezüge zur Gegenwart herzustellen.
Was meint Bohren mit der "Schwierigkeit mit Gott"?
Es beschreibt die Verlegenheit des Predigers, in einer säkularen Welt angemessen von Gott zu sprechen, ohne in hohle Phrasen zu verfallen.
- Citation du texte
- Andreas Losch (Auteur), 2001, Zu: Rudolf Bohren, Predigtlehre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2301