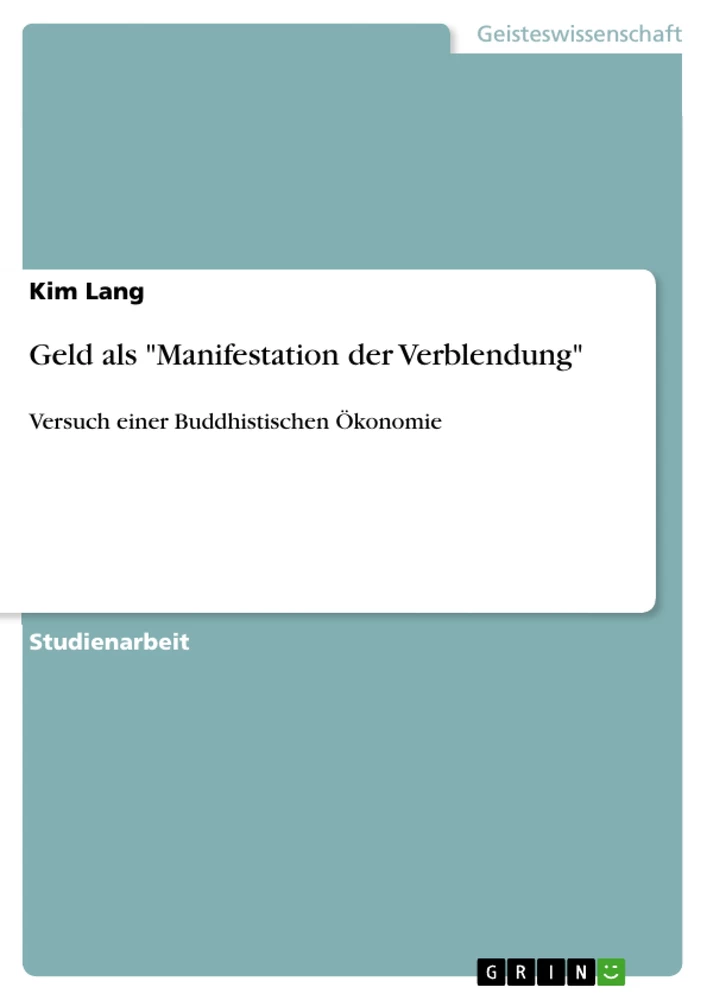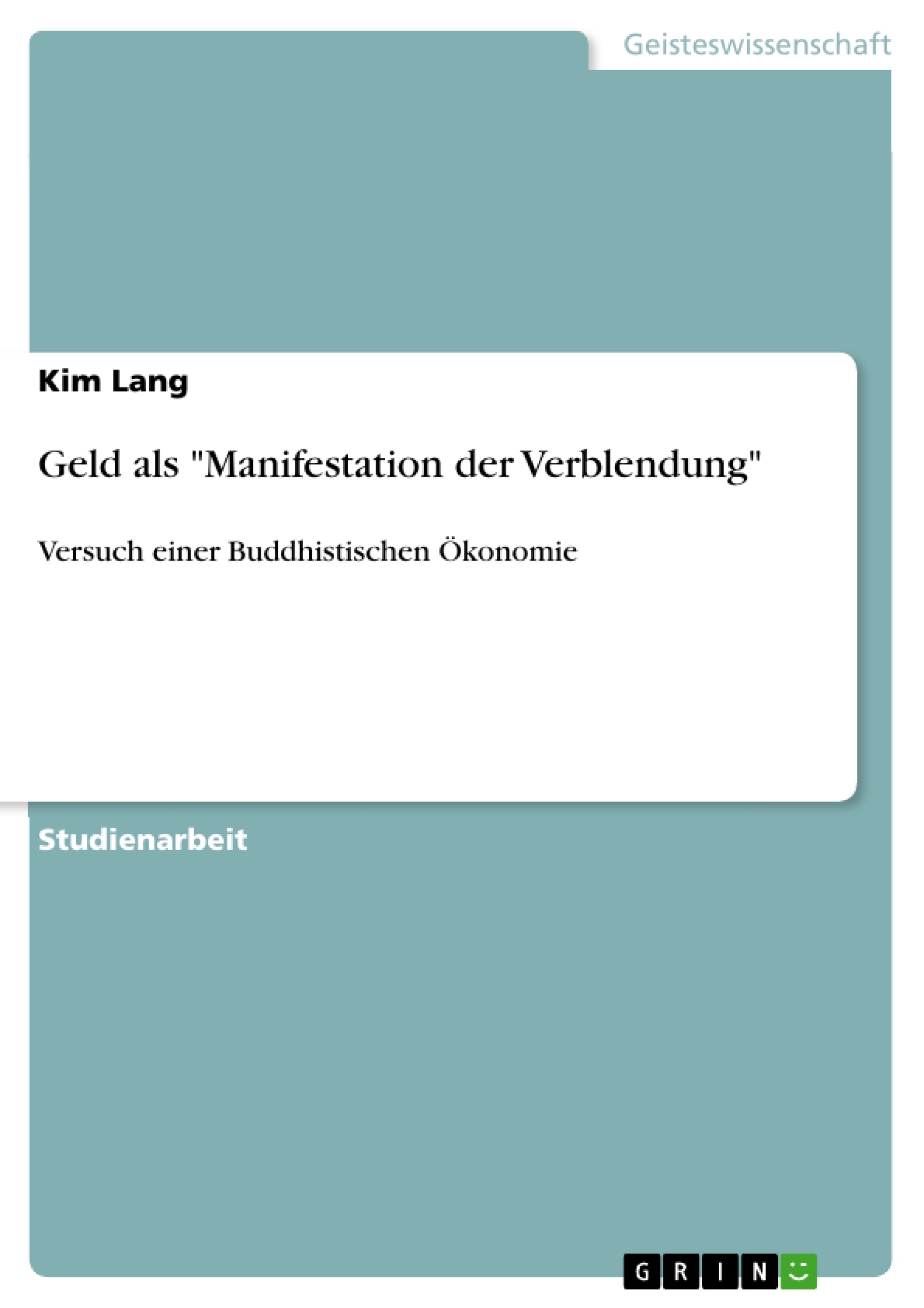Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Theorien einer „Buddhistische[n] Wirtschaftslehre“1, die unter diesem Namen erstmals von E.F. Schumacher in seinem Werk »Small is beautiful« als mögliche Alternative zur vorherrschenden liberal geprägten Ökonomie in Betracht gezogen wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Philosophische Grundlagen einer Buddhistischen Ökonomie
- 2.1 Ontologie
- 2.2 Anthropologie: zum Begriff des Ego
- 2.3 Ethik
- 2.4 Methode
- 3 Prämissen der modernen (liberalen) Ökonomie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeit einer „Buddhistischen Wirtschaftslehre“ als Alternative zum liberalen Wirtschaftsmodell. Sie entwickelt eine Wirtschaftsethik basierend auf buddhistischen Lehren und kritisiert die Grundannahmen der gegenwärtigen Ökonomie. Die Arbeit fokussiert auf die Vereinbarkeit buddhistischer Prinzipien mit ökonomischen Realitäten.
- Buddhistische Philosophie als Grundlage einer Wirtschaftsethik
- Kritik an den Grundannahmen der modernen (liberalen) Ökonomie
- Das Konzept von Interdependenz und dessen Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft
- Die Rolle von Gier, Hass und Verblendung im wirtschaftlichen Handeln
- Der achtfache Pfad als ethisches Rahmenwerk für wirtschaftliches Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der „Buddhistischen Wirtschaftslehre“ ein und stellt die Arbeit von E.F. Schumacher als Ausgangspunkt dar. Sie begründet die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanzsystem und untersucht die buddhistische Ökonomie als mögliche Alternative. Die Einleitung skizziert den Ansatz der Arbeit, eine Wirtschaftsethik basierend auf buddhistischen Lehren zu entwickeln, und kündigt die nachfolgenden Kapitel an, in denen die philosophischen Grundlagen und die Kritik an der modernen Ökonomie detailliert behandelt werden.
2 Philosophische Grundlagen einer Buddhistischen Ökonomie: Dieses Kapitel legt die philosophischen Grundlagen einer buddhistischen Ökonomie dar, wobei der Fokus auf dem Mahāyāna-Buddhismus liegt. Es behandelt die ontologische Grundlage der universellen Interdependenz (dhamma), die die Unmöglichkeit eines eigenständigen Ego postuliert. Die anthropologische Perspektive betont die Illusion des Ego und die daraus resultierenden Probleme wie Gier, Hass und Verblendung, die zu Leiden (dukkha) führen. Das Kapitel erklärt die buddhistische Kharma-Lehre und deren Verbindung von ethischem Handeln und objektiver Realität. Es beschreibt die Unterscheidung zwischen taṇhā (Begierde, Streben) und chanda (reflektiertes Handeln), die die Grundlage der buddhistischen Ethik bildet, und stellt den achtfachen Pfad als Weg zur Überwindung des Leidens vor. Schließlich wird die buddhistische Methode einer kritischen Untersuchung von Denkmustern zur Veränderung der Realität erläutert.
3 Prämissen der modernen (liberalen) Ökonomie: Dieses Kapitel (lediglich im Inhaltsverzeichnis erwähnt, jedoch ohne ausführlichen Text im bereitgestellten Dokument) würde vermutlich die Grundannahmen der modernen, liberalen Ökonomie darstellen und diese im Kontext der zuvor dargestellten buddhistischen Perspektive kritisch beleuchten. Es würde einen Vergleich zwischen den beiden Systemen aufzeigen und die Diskrepanzen herausarbeiten, um die Notwendigkeit einer buddhistischen Alternative zu begründen.
Schlüsselwörter
Buddhistische Wirtschaftslehre, Wirtschaftsethik, Mahāyāna-Buddhismus, Interdependenz (dhamma), Ego, Gier, Hass, Verblendung (dukkha), Kharma, taṇhā, chanda, achtfacher Pfad, moderne Ökonomie, kritische Analyse.
Häufig gestellte Fragen zu: Buddhistische Wirtschaftslehre - Eine kritische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeit einer „Buddhistischen Wirtschaftslehre“ als Alternative zum liberalen Wirtschaftsmodell. Sie entwickelt eine Wirtschaftsethik basierend auf buddhistischen Lehren und kritisiert die Grundannahmen der gegenwärtigen Ökonomie. Der Fokus liegt auf der Vereinbarkeit buddhistischer Prinzipien mit ökonomischen Realitäten.
Welche philosophischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit basiert auf dem Mahāyāna-Buddhismus und behandelt dessen ontologische Grundlage der universellen Interdependenz (dhamma), die Anthropologie mit dem Begriff des Ego und dessen Illusion, die buddhistische Ethik (inklusive Kharma-Lehre, taṇhā und chanda), und den achtfachen Pfad als Weg zur Überwindung von Leiden (dukkha). Die buddhistische Methode der kritischen Untersuchung von Denkmustern zur Veränderung der Realität wird ebenfalls erläutert.
Welche Kritik an der modernen Ökonomie wird geübt?
Die Arbeit übt Kritik an den Grundannahmen der modernen, liberalen Ökonomie, indem sie diese im Kontext der buddhistischen Perspektive beleuchtet. Ein detaillierter Vergleich der beiden Systeme und deren Diskrepanzen soll die Notwendigkeit einer buddhistischen Alternative begründen. (Dieses Kapitel ist im bereitgestellten Auszug nur im Inhaltsverzeichnis enthalten.)
Welche Schlüsselkonzepte werden untersucht?
Schlüsselkonzepte sind: Buddhistische Wirtschaftslehre, Wirtschaftsethik, Mahāyāna-Buddhismus, Interdependenz (dhamma), Ego, Gier, Hass, Verblendung (dukkha), Kharma, taṇhā, chanda, achtfacher Pfad, moderne Ökonomie und deren kritische Analyse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, die die Thematik einführt und den Ansatz der Arbeit erläutert. Ein Kapitel widmet sich den philosophischen Grundlagen einer buddhistischen Ökonomie. Ein weiteres Kapitel (nur im Inhaltsverzeichnis erwähnt) behandelt die Prämissen der modernen (liberalen) Ökonomie. Die Arbeit beinhaltet außerdem eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Rolle spielt der achtfache Pfad?
Der achtfache Pfad wird als ethisches Rahmenwerk für wirtschaftliches Handeln präsentiert und als Weg zur Überwindung von Leiden betrachtet, die durch Gier, Hass und Verblendung entstehen.
Welche Bedeutung hat das Konzept der Interdependenz?
Das Konzept der Interdependenz (dhamma) bildet die ontologische Grundlage und betont die Unmöglichkeit eines eigenständigen Ego. Es zeigt die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft auf.
Welche Rolle spielen Gier, Hass und Verblendung?
Gier, Hass und Verblendung (dukkha) werden als die Ursachen von Leiden dargestellt und im Kontext des wirtschaftlichen Handelns kritisch beleuchtet.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Zielgruppe umfasst Personen, die sich für die Schnittmenge von Buddhismus und Wirtschaftswissenschaften interessieren, insbesondere für eine ethische und nachhaltige Wirtschaftsgestaltung.
- Quote paper
- Kim Lang (Author), 2013, Geld als "Manifestation der Verblendung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230209