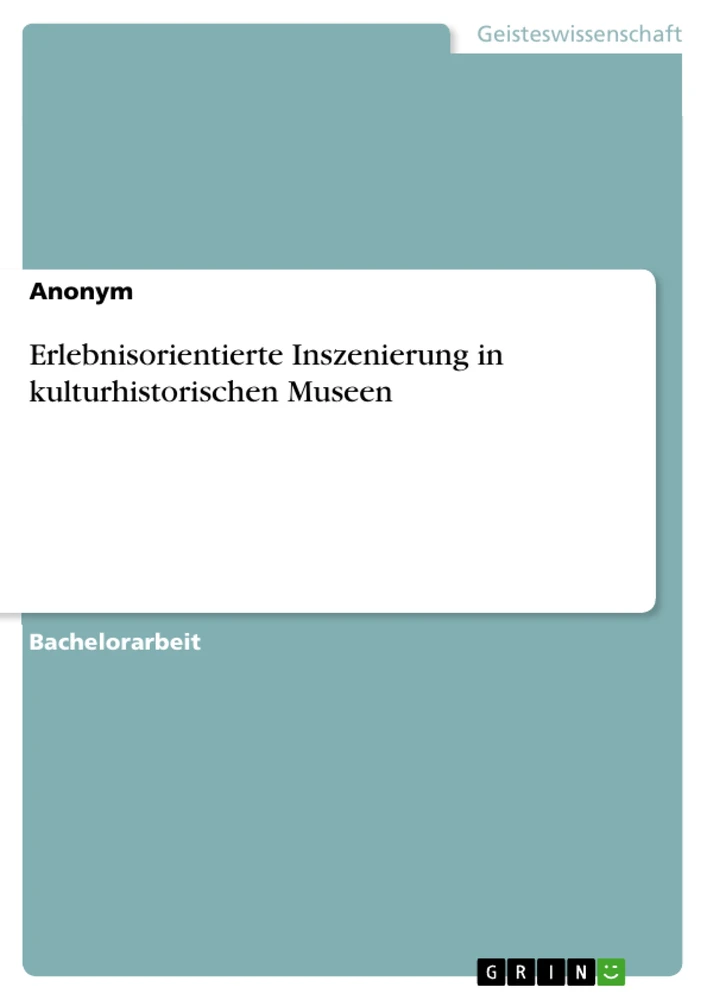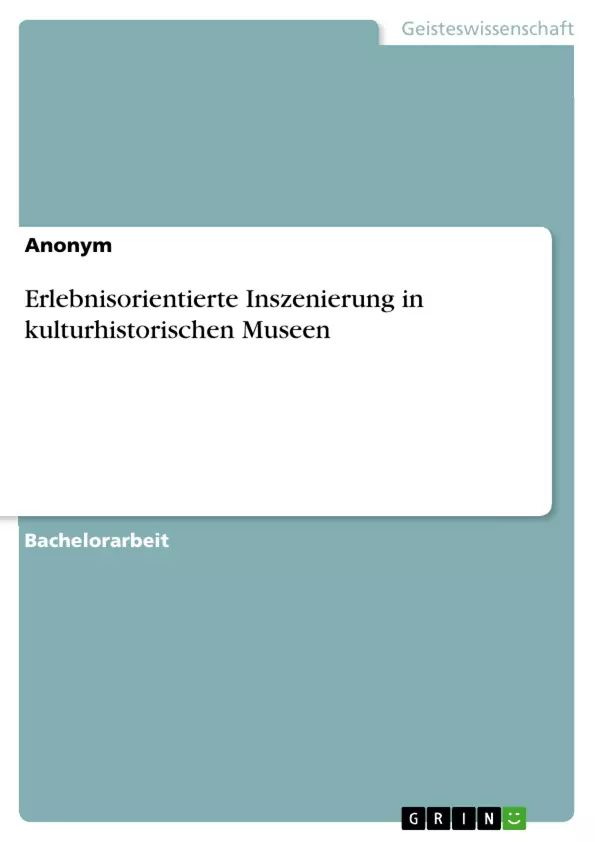Erlebnis- und Zielgruppenorientierung nehmen in Freizeiteinrichtungen immer mehr zu. Nur klassischen Bildungseinrichtungen der Freizeit, wie beispielsweise Museen, scheint diese Neuorientierung Schwierigkeiten zu bereiten. Die vorliegende Bachelorarbeit arbeitet heraus, welche Merkmale familien- und erlebnisorientierter Einrichtungen Museen übernehmen können, um ihre Vermittlungsarbeit und Besucherausrichtung zu verbessern. Neben den Kennzeichen und Erfolgsfaktoren werden auch konkrete Handlungsempfehlungen aufgezeigt, welche Veränderungen inhaltlich, räumlich und vor allem didaktisch notwendig sein können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit
- Literaturanalyse
- Experteninterviews
- Begriffsklärung
- Erlebnis
- Inszenierung
- Kulturhistorische Museen
- Erlebnisorientierte Museen
- Zielgruppe
- Besucherorientierung im Museum
- Familie
- Weitere Begriffe
- Erlebnisorientierung in der Freizeit
- Merkmale von Erlebniswelten
- Erfolgsfaktoren von Erlebniswelten
- Übertragbarkeit auf kulturhistorische Museen
- Inhalt und Struktur
- Raum und Ästhetik
- Didaktik
- Grenzen und Möglichkeiten
- Wirkung und Bedeutung
- Beispiele
- Familienorientierung in der Freizeit
- Ansprüche an familienorientierter Kultureinrichtungen
- Merkmale und Erfolgsfaktoren von Kindermuseen
- Übertragbarkeit auf kulturhistorische Museen
- Inhalt und Struktur
- Raum und Ästhetik
- Didaktik
- Grenzen und Möglichkeiten
- Wirkung und Bedeutung
- Beispiele
- Handlungsempfehlungen
- Für das konkrete Beispiel
- Langfristig
- Mittelfristig
- Für kulturhistorische Museen
- Für das konkrete Beispiel
- Fazit
- Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie kulturhistorische Museen ihre Vermittlungsarbeit und Besucherausrichtung verbessern können, indem sie Merkmale familien- und erlebnisorientierter Einrichtungen übernehmen. Neben den Kennzeichen und Erfolgsfaktoren werden konkrete Handlungsempfehlungen aufgezeigt, welche Veränderungen notwendig sind, um Museen zu unterhaltsamen Freizeitorten zu machen und den Lerneffekt zu intensivieren.
- Erlebnisorientierung in der Freizeit
- Merkmale und Erfolgsfaktoren von Erlebniswelten
- Übertragbarkeit von Erlebniswelten auf kulturhistorische Museen
- Familienorientierung in der Freizeit
- Übertragung von Merkmalen von Kindermuseen auf kulturhistorische Museen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Im Anschluss werden wichtige Begriffe wie Erlebnis, Inszenierung und Kulturhistorische Museen definiert und erläutert. In Kapitel 3 werden Merkmale von Erlebniswelten im Kontext der Freizeitgestaltung vorgestellt und ihre Übertragbarkeit auf kulturhistorische Museen untersucht. Kapitel 4 befasst sich mit der Zielgruppe Familie, wobei Kindermuseen als Beispiel für familienorientierte Einrichtungen dienen. Abschließend werden in Kapitel 5 konkrete Handlungsempfehlungen für eine bessere Erlebnis- und Zielgruppenorientierung in kulturhistorischen Museen gegeben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Konzepte der Arbeit sind Erlebnisorientierung, Besucherorientierung, Familienorientierung, Vermittlung, Inszenierung, Kulturhistorische Museen, Kindermuseen, Bildung, Unterhaltung und Lernen.
Häufig gestellte Fragen
Wie können kulturhistorische Museen ihre Besucherorientierung verbessern?
Indem sie Merkmale von erfolgreichen Erlebniswelten und familienorientierten Freizeiteinrichtungen übernehmen, um die Vermittlungsarbeit didaktisch und räumlich ansprechender zu gestalten.
Welche Rolle spielen Kindermuseen in dieser Bachelorarbeit?
Kindermuseen dienen als Best-Practice-Beispiele für Familienorientierung. Es wird untersucht, welche ihrer Erfolgsfaktoren auf klassische kulturhistorische Museen übertragbar sind.
Was sind die zentralen Merkmale von Erlebniswelten im Museumskontext?
Dazu gehören eine erlebnisorientierte Inszenierung, die Einbeziehung der Sinne, eine ansprechende Ästhetik des Raumes und eine Didaktik, die Unterhaltung mit Lernen verknüpft.
Welche methodischen Ansätze wurden für die Arbeit genutzt?
Die Arbeit basiert auf einer umfassenden Literaturanalyse sowie auf Experteninterviews, um theoretische Konzepte mit der Museumspraxis zu vergleichen.
Gibt es konkrete Handlungsempfehlungen für Museen?
Ja, die Arbeit zeigt mittel- und langfristige Veränderungen in den Bereichen Inhalt, Struktur, Raumgestaltung und Didaktik auf, um Museen zu attraktiven Freizeitorten zu machen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, Erlebnisorientierte Inszenierung in kulturhistorischen Museen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230239