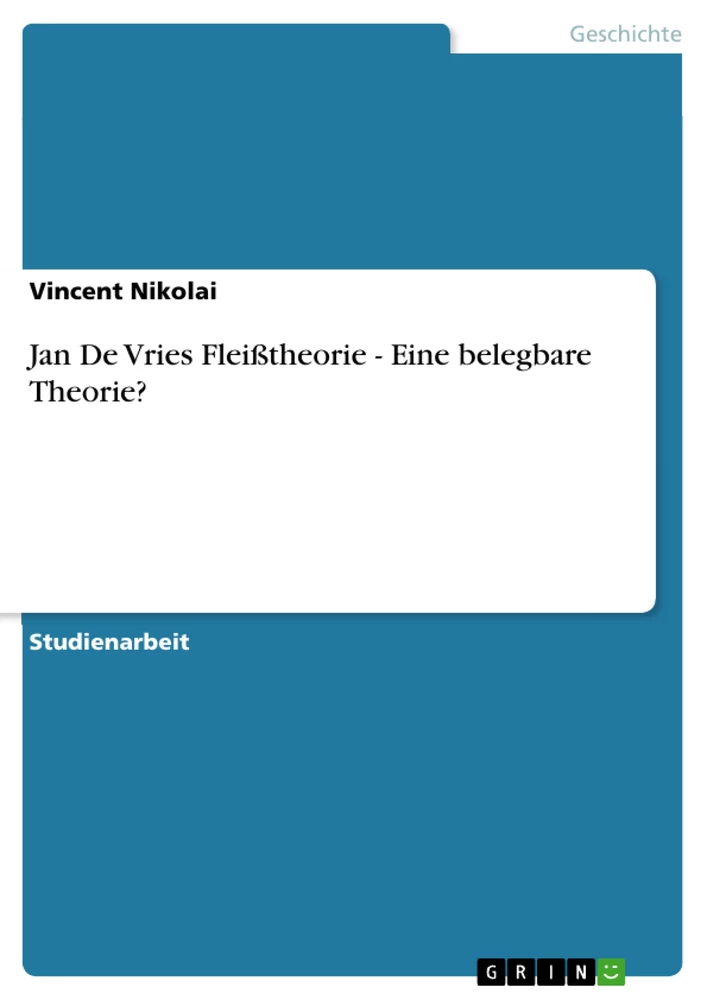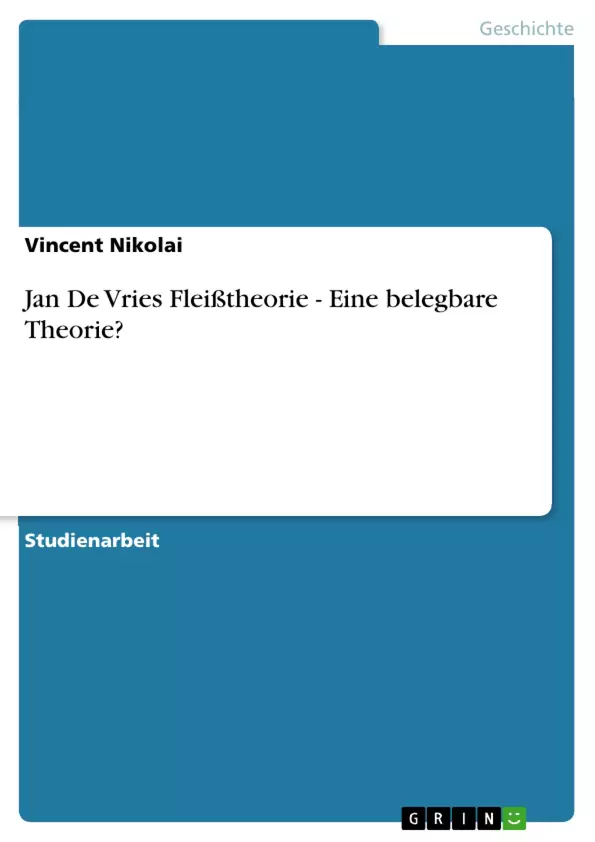Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich kritisch mit der Fleißtheorie von Jan De Vries. Dabei wird die Theorie auf der einen Seite ausgiebig erklärt und um die Forschungen von Becker, Voth und Ogilvie eränzt bzw. kritisch hinterfragt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung des Arbeitseinsatzes im Verhältnis zur Entwicklung des Reallohnes zwischen 1750 und 1800
- Methode und Quellenlage
- Ergebnisse der Zeugenaussagen des Old Bailey
- The Industrious Revolution als Erklärung der „Mehrarbeit“?
- Definition von „Industrious Revolution“ und Verortung in der Forschung
- Definition und Verhalten des Haushaltes nach De Vries während der Fleißrevolution
- Veränderungen des Konsummusters und des Marktes
- Veränderung des Arbeitsangebotes
- „Ergebnisse“ der Fleißrevolution
- Ein kritischer Blick auf das Konzept der Fleißrevolution von De Vries
- Kritik am Beispiel der Übertragung des Konzeptes auf Deutschland
- Allgemeine Kritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Arbeitseinsatzes ab 1600 anhand von Voths Untersuchung und die Theorie der Fleißrevolution nach Jan de Vries. Sie analysiert das Verhältnis von Arbeitseinsatz und Reallohnentwicklung und versucht, mithilfe der Fleißrevolutionstheorie eine Erklärung für die ambivalente Entwicklung zu liefern. Die Argumentationsstruktur von De Vries wird untersucht, und die Übertragbarkeit des Konzepts auf Deutschland wird kritisch hinterfragt. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung des Konzepts der Fleißtheorie in der Forschung.
- Entwicklung des Verhältnisses von Arbeitseinsatz und Reallohn im 18. Jahrhundert
- Analyse der "Industrious Revolution" nach Jan de Vries
- Kritische Auseinandersetzung mit der Übertragbarkeit des Konzepts der Fleißrevolution auf Deutschland
- Bewertung der Fleißrevolutionstheorie in der Forschung
- Methodische Herausforderungen bei der Analyse historischer Arbeitszeitdaten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Arbeitseinsatzes und des Reallohns, beleuchtet die Fleißrevolutionstheorie von Jan de Vries und deren Übertragbarkeit auf Deutschland, und bewertet kritisch die Fleißtheorie in der Forschung. Die zentrale Fragestellung ist die Bewertung des Konzepts der Fleißtheorie.
Die Entwicklung des Arbeitseinsatzes im Verhältnis zur Entwicklung des Reallohnes zwischen 1750 und 1800: Dieses Kapitel analysiert die Beziehung zwischen Arbeitszeit und Reallohnentwicklung im 18. Jahrhundert in London anhand von Voths Untersuchung der Gerichtsakten des Old Bailey. Voth kritisiert die Quellenlage bestehender Studien und verwendet die Zeugenaussagen des Old Bailey, um den Tagesablauf und die Arbeitszeiten zu rekonstruieren. Die Daten zeigen, dass sich die Arbeitszeit und -verteilung veränderten, insbesondere der Montag als Ruhetag verschwand. Die Zunahme der Arbeitszeit wird nicht allein auf mehr Nahrungsverfügbarkeit zurückgeführt, sondern auch auf die veränderte Arbeitszeitverteilung. Die methodischen Herausforderungen der Quelleninterpretation werden hervorgehoben, besonders die potenziell idealisierten Darstellungen der Zeugenaussagen.
The Industrious Revolution als Erklärung der „Mehrarbeit“?: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der "Industrious Revolution" nach Jan de Vries. Es definiert den Begriff, ordnet ihn in den Forschungsstand ein und erläutert De Vries' These einer Neuverteilung hauswirtschaftlicher Ressourcen, die das Angebot an Lohnarbeit und die Nachfrage nach Marktgütern erhöhte. Die "Industrious Revolution" wird als wichtiger Vorläufer der industriellen Revolution dargestellt, der durch veränderte Einstellungen zur Lohnarbeit deren Vollzug ermöglichte. De Vries betont den evolutionären Charakter der Industrialisierung und die Notwendigkeit, die Vorgeschichte genauer zu untersuchen.
Ein kritischer Blick auf das Konzept der Fleißrevolution von De Vries: Dieses Kapitel widmet sich einer kritischen Auseinandersetzung mit De Vries' Konzept der Fleißrevolution. Es untersucht die Übertragbarkeit des Konzepts auf den deutschen Kontext und beleuchtet allgemeine Kritikpunkte an der Theorie. Die Kapitel untersuchen die Grenzen und Schwächen der Theorie und bieten einen differenzierten Blick auf ihre Anwendbarkeit und Reichweite.
Schlüsselwörter
Arbeitseinsatz, Reallohn, Fleißrevolution (Industrious Revolution), Jan de Vries, Joachim Voth, Old Bailey, Arbeitszeit, Lohnarbeit, Konsumverhalten, Haushaltsökonomie, industrielle Revolution, Methodologie, historische Quellenkritik, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung des Arbeitseinsatzes im Verhältnis zur Entwicklung des Reallohnes zwischen 1750 und 1800
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Arbeitseinsatzes und des Reallohns im 18. Jahrhundert, insbesondere im Kontext der "Fleißrevolution" (Industrious Revolution) nach Jan de Vries. Sie analysiert das Verhältnis von Arbeitseinsatz und Reallohnentwicklung und versucht, mithilfe der Fleißrevolutionstheorie eine Erklärung für die ambivalente Entwicklung zu liefern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kritischen Bewertung der Übertragbarkeit dieses Konzepts auf den deutschen Kontext.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich unter anderem auf die Untersuchung von Joachim Voth zu den Gerichtsakten des Old Bailey in London. Voth rekonstruiert anhand von Zeugenaussagen den Tagesablauf und die Arbeitszeiten der Bevölkerung. Die Arbeit diskutiert die methodischen Herausforderungen und die potentielle Voreingenommenheit dieser Quelle.
Was ist die "Fleißrevolution" (Industrious Revolution)?
Die "Fleißrevolution", ein Konzept von Jan de Vries, beschreibt eine Veränderung des Konsumverhaltens und der Haushaltsökonomie im vorindustriellen Europa. Haushalte konzentrierten sich vermehrt auf die Produktion von Marktgütern, um mehr Einkommen zu erzielen und einen höheren Konsum zu finanzieren. Dies führte zu einem erhöhten Arbeitsangebot und einer veränderten Arbeitszeitverteilung.
Wie wird die "Fleißrevolution" in dieser Arbeit bewertet?
Die Arbeit analysiert die Argumentationsstruktur von De Vries und untersucht kritisch die Übertragbarkeit des Konzepts auf Deutschland. Es werden sowohl die Stärken als auch die Schwächen und Grenzen der Theorie diskutiert, und die Arbeit bietet eine differenzierte Bewertung der Fleißrevolutionstheorie im Kontext der bestehenden Forschung.
Welche Zeitperiode wird untersucht?
Der Fokus liegt hauptsächlich auf dem 18. Jahrhundert, mit besonderem Augenmerk auf die Periode zwischen 1750 und 1800. Die Einleitung der Arbeit erwähnt jedoch auch die Entwicklung des Arbeitseinsatzes ab 1600.
Welche methodischen Herausforderungen werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die methodischen Herausforderungen der Analyse historischer Arbeitszeitdaten. Besonders die Interpretation der Quellen aus dem Old Bailey wird kritisch beleuchtet, wobei die potenziell idealisierten Darstellungen der Zeugenaussagen berücksichtigt werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Arbeitseinsatz, Reallohn, Fleißrevolution (Industrious Revolution), Jan de Vries, Joachim Voth, Old Bailey, Arbeitszeit, Lohnarbeit, Konsumverhalten, Haushaltsökonomie, industrielle Revolution, Methodologie, historische Quellenkritik, Deutschland.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entwicklung des Arbeitseinsatzes im Verhältnis zum Reallohn (mit Unterkapiteln zu Methode und Quellenlage sowie den Ergebnissen der Zeugenaussagen des Old Bailey), ein Kapitel zur "Fleißrevolution" als Erklärung für "Mehrarbeit", ein Kapitel mit einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Konzept der Fleißrevolution von De Vries und abschließend ein Fazit.
- Citation du texte
- Vincent Nikolai (Auteur), 2013, Jan De Vries Fleißtheorie - Eine belegbare Theorie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230250