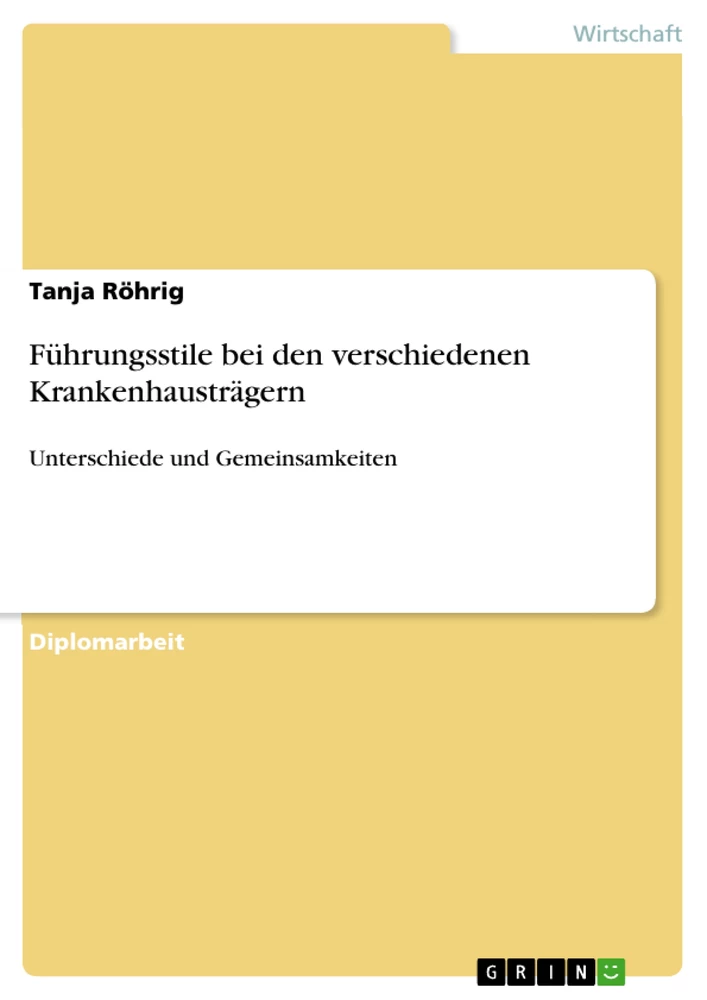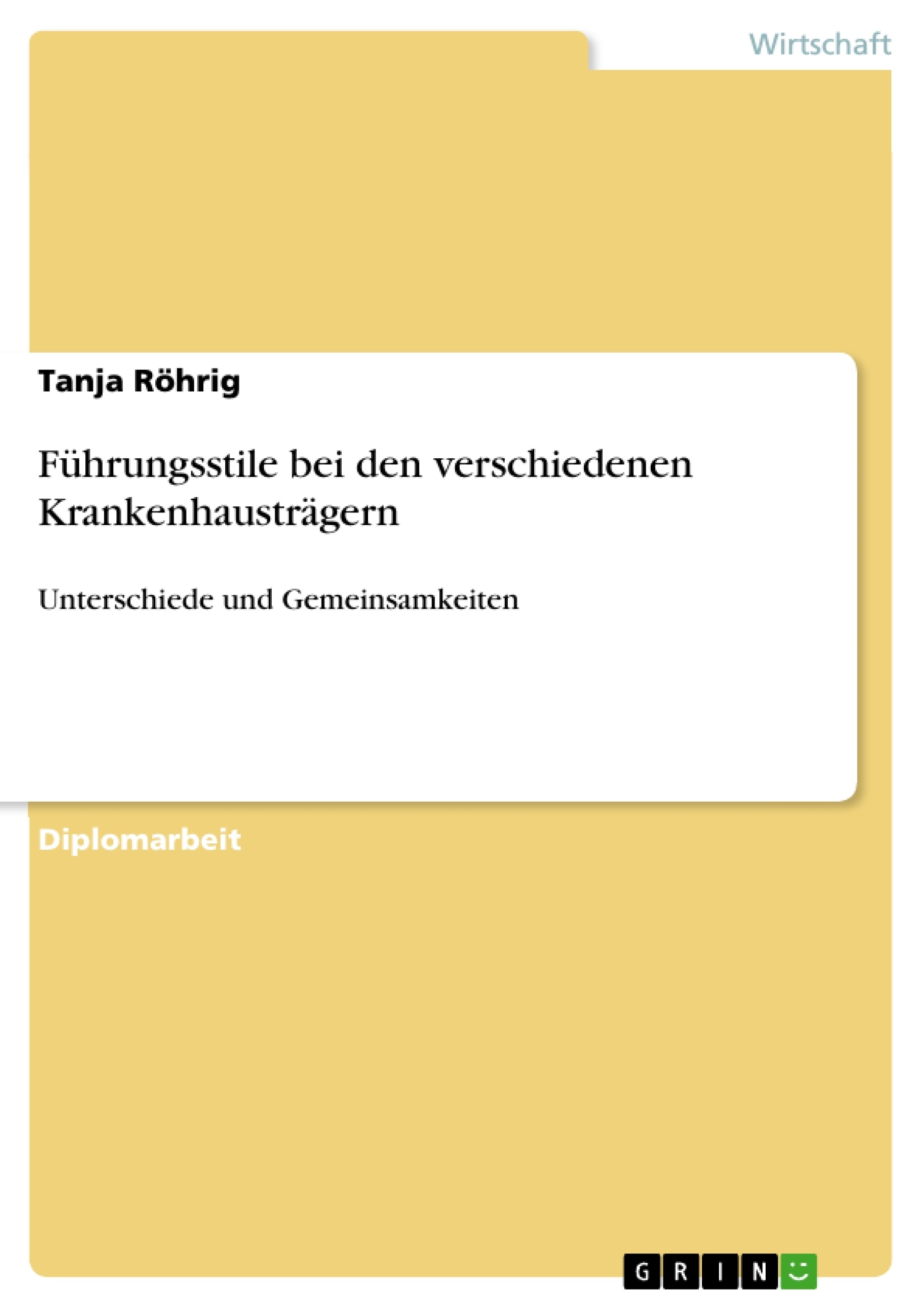Mit Blick auf die beschäftigungspolitische Relevanz scheint es verwunderlich, dass gezielte
Fragestellungen der Personalführung aus Sicht der Krankenhausbetriebslehre kaum wissenschaftlich
erforscht sind. In der Folge steht die konsequente Behandlung des Themas Führungsstile
bei den verschiedenen Krankenhausträgern – Unterschiede und Gemeinsamkeiten
bislang aus. Die spezielle Zuspitzung der Themenstellung auf die Trägerschaft ist nach jetzigem
Kenntnisstand weder theoretisch noch empirisch untersucht. In diesem Rahmen soll der
Versuch unternommen werden, den Führungsstil betreffend Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei den verschiedenen Krankenhausträgern herauszuarbeiten. Diese Ausarbeitung soll
dazu beitragen, erste theoretische Aspekte einer umfassenden Problemstellung darzulegen und
mögliche Impulse für eine empirische Folgeerhebung aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Ausgangssituation
1.2 Zielsetzung
1.3 Aufbau
2 Krankenhausbetriebliche Grundlagen
2.1 Krankenhaus
2.2 System der deutschen Krankenhausversorgung
2.3 Krankenhausleistungen
2.4 Statistische Zahlen
2.5 Krankenhausträger
2.5.1 Öffentliche Krankenhäuser
2.5.2 Freigemeinnützige Krankenhäuser
2.5.3 Private Krankenhäuser
2.6 Betriebsführungsstruktur
2.7 Krankenhauspersonal
2.7.1 Ärztlicher Dienst
2.7.2 Pflegedienst
2.7.3 Wirtschafts- und Verwaltungsdienst
3 Mitarbeiterführung im Krankenhaus
3.1 Führung
3.2 Menschenbild
3.3 Verhaltenstheorie der Mitarbeiterführung
3.3.1 Eindimensionaler Führungsstil
3.3.2 Zweidimensionaler Führungsstil
3.3.3 Dreidimensionaler Führungsstil
4 Führungsstile bei Krankenhausträgern
4.1 Trägerspezifische Annahmen
4.2 Trägerunspezifische Annahmen
5 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: System der Krankenhausversorgung
Abb. 2: Leistungserstellung im Krankenhausbetrieb
Abb. 3: Krankenhausleistungen
Abb. 4: Anteil der Krankenhäuser nach Trägerschaft
Abb. 5: Organisationsstruktur eines Krankenhauses
Abb. 6: Kontinuum des Führungsverhaltens
Abb. 7: Verhaltensgitter
Abb. 8: 3-D-Konzept
Abb. 9: Verhaltenstheorie und Krankenhausträger
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Berufsbilder im Krankenhaus
Tab. 2: Menschenbild
Tab. 3: Ein- und mehrdimensionale Führungsstilkonzepte
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
So wie es weder einen öffentlichen, freigemeinnützigen oder privaten Blinddarm gibt,
so gibt es auch keine öffentliche, freigemeinnützige oder private Operationstechnik.
Sollte es einen öffentlichen, freigemeinnützigen oder privaten Führungsstil geben?
1 Einleitung
1.1 Ausgangssituation
Bei schlechtem Gesundheitszustand ist die Teilhabe am Leben nur beschränkt möglich. Gesundheit ist in der subjektiven und öffentlichen Wahrnehmung das höchste menschliche Gut. Dem gesellschaftlichen Teilsystem, das sich mit der Erhaltung und Wiederherstellung von Gesundheit, dem Erkennen, Heilen oder Lindern von Krankheit und Leiden beschäftigt, gilt darum eine große gemeinschaftliche Aufmerksamkeit.[1] Das Gesundheitswesen stellt aufgrund seiner Betriebs- und Beschäftigtenzahl einen der größten Sektoren der Wirtschaft und den größten Bereich des Dienstleistungssektors in Deutschland dar. Dies spiegelt sich auch im Hinblick auf die Verwendung des Volkseinkommens wider. Der Gesundheitssektor erwirtschaftet bereits heute 11,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes mit steigender Tendenz. Im Jahr 2010 betragen die Aufwendungen für Gesundheitsleistungen 287,3 Milliarden Euro; die Ausgaben je Einwohner liegen bei rund 3.510 Euro.[2] Zum Ende des Jahres sind rund 4,8 Millionen Menschen und damit etwa jeder neunte Erwerbstätige im Gesundheitswesen beschäftigt. Das entspricht einem Beschäftigungswachstum von 1,8 Prozent.[3] Dabei nimmt der Krankenhaussektor, als größter Arbeitgeber im Gesundheitswesen mit 1,1 Millionen Erwerbstätigen, eine besonders große beschäftigungspolitische und wirtschaftliche Stellung ein. Dies wird durch den Umstand verdeutlicht, dass schon heute 83,4 Milliarden Euro, d. h. ein Drittel der Gesundheitsausgaben, für den Dienst am kranken Menschen in Krankenhäusern aufgewendet werden.[4]
In den vergangen Jahren hat das Krankenhauswesen als Forschungsgegenstand betrieblicher Fragestellungen immer mehr an Bedeutung gewonnen. Nur wenige Bereiche der Betriebswirtschaftslehre haben in den letzten Jahren eine so rasante Entwicklung genommen wie die Krankenhausbetriebslehre. Vor zwei Jahrzehnten ist diese spezielle Branchenlehre in Deutschland praktisch nicht existent gewesen, da die Krankenhausfinanzierung nach dem Selbstkostendeckungsprinzip erfolgte. Dies hat sowohl das Desinteresse der Krankenhauspraxis an den Methoden der Betriebswirtschaftslehre als auch die Vernachlässigung dieser Branche durch die ökonomische Wissenschaft hervorgerufen. Mit der Einführung des Gesundheitsstrukturgesetzes im Jahre 1993 und durch die Implementierung pauschalierter Entgelte auf Basis der Diagnosis Related Groups[5] hat sich diese Situation grundlegend gewandelt.[6] Krankenhäuser befinden sich in einem herausfordernden Transitionsprozess zu modernen Wirtschaftsbetrieben, der – so Fleßa – „nicht nur zu einem überwiegenden Austausch der Führungsspitze, sondern vor allem zur Anwendung moderner Methoden aus der Betriebswirtschaftslehre geführt hat.“[7] Vor diesem Hintergrund sind in jüngster Zeit Lehrstühle, Studiengänge oder Studienschwerpunkte für Gesundheits- und Krankenhausmanagement eingerichtet und praktische Projekte initiiert worden. Die noch junge wissenschaftliche Disziplin hat es sich u. a. zur Aufgabe gemacht, konsistente Modelle und branchenspezifische Konzepte zu entwickeln, mit deren Hilfe das Führen von und in Medizinbetrieben beschrieben, erklärt und gestaltet werden kann.[8] Trotzdem ist es noch nicht gelungen, eine konsequente, alle Teilaspekte der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre umfassende Krankenhausbetriebslehre zu entwickeln. Erfolgreich sind seither Problemstellungen in Controlling und Marketing behandelt worden.[9]
1.2 Zielsetzung
Mit Blick auf die beschäftigungspolitische Relevanz scheint es verwunderlich, dass gezielte Fragestellungen der Personalführung aus Sicht der Krankenhausbetriebslehre kaum wissenschaftlich erforscht sind. In der Folge steht die konsequente Behandlung des Themas Führungsstile bei den verschiedenen Krankenhausträgern – Unterschiede und Gemeinsamkeiten bislang aus. Die spezielle Zuspitzung der Themenstellung auf die Trägerschaft ist nach jetzigem Kenntnisstand weder theoretisch noch empirisch untersucht. In diesem Rahmen soll der Versuch unternommen werden, den Führungsstil betreffend Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei den verschiedenen Krankenhausträgern herauszuarbeiten. Diese Ausarbeitung soll dazu beitragen, erste theoretische Aspekte einer umfassenden Problemstellung darzulegen und mögliche Impulse für eine empirische Folgeerhebung aufzuzeigen.
1.3 Aufbau
Nach einer Einführung in die Problemstellung und Vorgehensweise dieser Ausarbeitung in Kapitel 1 sollen zum allgemeinen Verständnis krankenhausbetriebliche Grundlagen in Kapitel 2 geschaffen werden. In einem ersten Schritt wird die stationäre Gesundheitseinrichtung definiert und das System der deutschen Krankenhausversorgung erklärt. Auf der Basis aktueller Zahlen und Fakten[10] werden die Besonderheiten in der medizinischen Leistungserstellung statistisch untermauert bzw. herausgestellt. In einem zweiten Schritt werden die Krankenhausträger in öffentliche, freigemeinnützige und private Trägerformen unterschieden. In Abgrenzung zur Trägerschaft wird die Krankenhausleitung und deren Funktionsbereich vorgestellt. Hieran folgend werden die Betriebsführungsstrukturen am trialen Organisationsmodell dargestellt. Danach werden die drei größten Berufsgruppen, die einen Beitrag zur Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung der Gesundheit von Patienten leisten, im Hinblick auf ihre Stellung im Krankenhaus betrachtet: Ärzteschaft, Pflegepersonal und Verwaltungsmitarbeiter. Ausgehend von allgemeinen Aspekten der Führung und einer Vorstellung von Menschenbildern nach McGregor wird in Kapitel 3 der verhaltenstheoretische Ansatz von Mitarbeiterführung ausgeführt. Dabei wird die Führungsbeziehung zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern an ausgewählten Führungsstilkonzepten erläutert. Bei der Einführung ein- und mehrdimensionaler Führungsstilkonzepte wird der Versuch unternommen, erdachte Situationen aus dem alltäglichen Krankenhausbetrieb auf das Führungsstilkontinuum nach Tannenbaum und Schmidt, das Verhaltensgitter von Blake und Mouton sowie das 3-D-Programm nach Reddin zu übertragen. Werden die vorherigen Kapitel als theoretischer Zugang zur Problemstellung verstanden, sollen in Kapitel 4 mögliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der personellen Führung bei den verschiedenen Krankenhausträgern herausgearbeitet werden. Aufgrund mangelnder Forschungsliteratur werden trägerspezifische und trägerunspezifische Annahmen getroffen, die sich u. a. auf Leitbilder zurückführen lassen. Illustrierend seien hier angeführt:
- das Städtische Klinikum Braunschweig,
- das Marienkrankenhaus St. Wendel, welches zur MARIENHAUS GmbH [11], deren Gesellschafterin die Ordensgemeinschaft der Franziskanerinnen von Waldbreitbach ist und heute zu den großen christlichen Trägern in Deutschland gehört, und
- die Paracelsus-Kliniken Deutschland, einer der großen privaten Klinikträger.
In der Schlussbetrachtung werden die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst, die in eine abschließende Stellungnahme münden.
2 Krankenhausbetriebliche Grundlagen
2.1 Krankenhaus
Der Begriff Krankenhaus impliziert bereits, dass es sich um eine besondere Einrichtung zur Pflege von Kranken handelt. Aufschlussreicher ist die synonyme Wortbedeutung des Ausdruckes Spital, der in Teilen Süddeutschlands und in Österreich gebräuchlich ist. Das Spital leitet sich vom lateinischen Hospitium ab, ein Zimmer in der römischen Villa, in dem Gäste empfangen wurden. Im Mittelalter ist das Hospiz zunächst ein Gasthaus, ein Ort der Ruhe für Pilger und eine Einrichtung zur Erholung von Kranken auf der Pilgerschaft. Im zeitlichen Verlauf wandelt sich die Bedeutung hin zum Spital, welches als Siechenhaus für Armutsgruppen genutzt wird. Die Reichen lassen sich zu Hause pflegen und dort von Ärzten behandeln. Sie suchen keine Spitäler auf, lediglich für die Armen sind eigene Bewahranstalten und Häuser der Barmherzigkeit erforderlich. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts sind Krankenhäuser keine Heilanstalten für die Gesamtbevölkerung, sondern Orte für leidende und kranke Mittellose. Heute sind Krankenhäuser moderne integrierte Gesundheitszentren für eine breite Bevölkerung.[12]
Welche Organisationen in Deutschland als Krankenhäuser gelten, ist gesetzlich definiert. Es gibt verschiedene Definitionen im deutschen Krankenhausrecht. Im Sinne des Krankenhausfinanzierungsgesetzes sind Krankenhäuser
„Einrichtungen, in denen durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festgestellt, geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und in denen die zu versorgenden Personen untergebracht und verpflegt werden können.“[13]
Über diese Charakteristika hinausgehend werden Krankenhäuser im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 107 Abs. 1 SGB V als Einrichtungen bezeichnet, „die
1. der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
2. fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungs- auftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaft- lich anerkannten Methoden arbeiten,
3. mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem, Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Perso- nal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten, und in denen
4. die Patienten untergebracht und verpflegt werden können.“[14]
Davon zu unterscheiden sind Vorsorge- und Rehabilitationsreinrichtungen nach § 107 Abs. 2 SGB V. Sie dienen der Krankheitsvorsorge oder rehabilitativen Versorgung, um den Erfolg der Krankenhausbehandlung zu sichern.[15]
Seit 1991 werden Krankenhäuser in zwei große Gruppen eingeteilt: die Allgemeinen und die Sonstigen Krankenhäuser. Erstere bezeichnet alle Krankenhäuser, die nicht ausschließlich psychiatrische und/oder neurologische Betten vorhalten. Als sonstige Krankenhäuser gelten alle Einrichtungen mit ausschließlich psychiatrischen und/oder neurologischen Betten sowie reine Tages- und Nachtkliniken, in denen Patienten teilstationär versorgt werden.[16] Im Rahmen dieses Beitrags werden nur Allgemeine Krankenhäuser betrachtet, auf Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen wird im Weiteren nicht eingegangen. Ebenso werden Krankenhäuser, deren Leistungsspektrum nur auf Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin ausgerichtet ist, nicht berücksichtigt.
Krankenhäuser lassen sich kategorisieren nach der
- Art der ärztlich-pflegerischen Zielsetzung, also nach ihrer betrieblichen Funktion (Allgemein-, Fach-, Sonderkrankenhaus),
- Art der ärztlichen Besetzung (Anstalts-, Belegkrankenhäuser),
- Intensität von Behandlung und Pflege (Akut-, Langzeitkrankenhäuser, Krankenhäuser für Chronischkranke),
- Art der Leistungserbringung (voll-, teilstationär),
- Versorgungsstufe (Grund-, Regel-, Zentral-, Maximalversorgung),
- Trägerschaft (öffentlich, freigemeinnützig, privat),
- Rechtsform (staatlich öffentlich-rechtlich, kirchlich öffentlich-rechtlich, privat-rechtlich betriebene Krankenhäuser) und der
- Art der Regulierung (Universitäts-, Plan-, Vertrags- und freie Krankenhäuser).[17]
2.2 System der deutschen Krankenhausversorgung
Das Krankenhaus ist ein Medizinbetrieb, ein „Wirtschaftssubjekt, das Gesundheitsleistungen erbringt.“[18] Die Leistungsbeziehungen und Steuerungsmechanismen zwischen den an der Krankenhausfinanzierung, -planung und -preisgestaltung beteiligten Einheiten sollen in Abbildung 1 dargestellt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: System der Krankenhausversorgung
Quelle: Berger/Stock (2008), S. 30
Das System der Krankenhausversorgung unterscheidet Angebots- und Nachfrageseite sowie koordinierende Einheiten: Die Angebotsseite bilden öffentliche, freigemeinnützige und private Krankenhausträger. Diese erbringen medizinische Leistungen an Patienten gegen ein Entgelt, welche durch Beiträge und Steuern von Versicherten aufgebracht und den gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen, in Ausnahmefällen auch dem Staat, über das Vergütungssystem an die Krankenhäuser als Leistungserbringer weitergegeben werden. In diesem Modell nimmt das Vergütungssystem sowohl eine finanzierende als auch eine steuernde Funktion ein. Die Finanzierungsfunktion gleicht den Ressourcenverbrauch der Leistungserstellung durch Ressourcenzufuhr aus; die Steuerungsfunktion übernimmt die Zuteilung der knappen Mittel zum Ort ihrer besten Verwendung. Das deutsche Gesundheitssystem ist zweigeteilt: Die Krankenversicherungen übernehmen hierin primär die Vergütung (Finanzierungsfunktion), während der Staat respektive die Bundesländer die Investitionsförderung und die Steuerungsfunktion verantworten.[19] Seit Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetztes (1972) unterliegen Krankenhäuser der staatlichen Krankenhausplanung der Länder und einer entsprechenden staatlichen Förderung der Investitionskosten. Demnach stellen die Bundesländer Krankenhauspläne und Investitionsprogramme auf und schreiben diese regelmäßig fort. Diese Verpflichtung ist aus dem Sicherstellungsauftrag der Länder abgeleitet, der wiederum aus dem Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes resultiert (Art. 20 und 28 GG). Die Aufnahme in den Krankenhausplan ist Voraussetzung für die öffentliche Investitionsförderung. Der Versorgungsauftrag ergibt sich nach den Bestimmungen des Krankenhausplans in Verbindung mit den Bescheiden zu seiner Durchführung.[20] Somit reguliert der Staat die bedarfsnotwendige Versorgungskapazität in Richtung und Umfang. Die in diesem Rahmen erbrachten Leistungen respektive die laufenden Betriebskosten müssen von den Leistungsempfängern und deren Sozialleistungsträgern finanziert werden.[21]
2.3 Krankenhausleistungen
Die originäre Funktion von Krankenhäusern besteht in der Produktion von Gesundheit.[22] Ausgehend vom Status des aufgenommenen Patienten zielt das Leistungsgeschehen im Krankenhaus auf die Veränderungen der Beschaffenheitsmerkmale und Eigenschaften von Personen, die als Patienten die Krankenhausleistungen in Anspruch nehmen, ab. Die Statusveränderung wird ausgelöst durch die Sekundärleistungen, die ihrerseits das Ergebnis des betrieblichen Leistungserstellungsprozesses sind, der wiederum als das Zusammenwirken der Produktionsfaktoren durch die Krankenhausbetriebsleitung sowie die zuständigen Organe des Krankenhausträgers als dem dispositiven Faktor definiert wird. In der Abbildung 2 werden die Produktivfaktoren als Sekundär-Input bezeichnet; die Einzelleistungen Diagnose, Therapie, Pflege und Versorgung als Sekundärleistung, Sekundär-Output oder Pirmär-Input.[23]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Leistungserstellung im Krankenhausbetrieb
Quelle: Haubrock/Schär (2002), S. 115
Neben diesem beschriebenen zweistufigen Leistungsprozess lassen sich weitere spezifische Aspekte der Leistungserstellung herausstellen:
- Die Leistungserstellung wird fast ausschließlich durch die Nachfrage nach Leistungen ausgelöst. Krankenhausleistungen sind Dienst- und Vertrauensgüter von überwiegend existenzieller Natur, für die es selten Substitutionsgüter gibt.
- Die Nachfrage nach medizinischen Leistungen ist im Einzelfall nicht vorhersehbar. Die Krankenhausleistungen sind in der Konsequenz nicht lagerbar.
- Mit Bezug zur Art der Leistungserstellung gibt es wenige homogene Arbeitsplätze, was an die Qualifikation der Mitarbeiter hohe Anforderungen stellt.
- Der leistungsempfangende Patient ist normalerweise nicht fähig, Art und Umfang der Leistung zu bestimmen. Er beschließt nur, ob er einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsucht.
- Über die in Anspruch zu nehmenden Leistungen entscheidet das behandelnde Personal.
- Charakteristisch ist, dass die Leistung auf der Grundlage eines direkten Verhältnisses zwischen Patienten als Leistungsempfänger und dem Krankenhaus und seinen Mitarbeitern als Leistungsträger erbracht wird. Leistungserstellung und -verwertung fallen in Einheit von Ort, Zeit und Handlung zusammen. Sie erfordern die Präsenz und Teilnahme des Patienten am Produktionsprozess. Gesundheitsdienstleistungen sind persönlich-interaktive (auch: kundenpräsenzbedingende) Dienstleistungen.
- Krankenhausleistungen sind standortgebundene Einzelfertigungen.[24]
Im Krankenhausplan wird die Aufgabenstellung des Krankenhauses bestimmt. Dieser verweist gewöhnlich auf die Versorgungsstufe, die Bettenzahl und die Fachrichtungen.[25] Die betrieblichen Funktionen im Krankenhauswesen umfassen die bedarfsadäquate voll-, teil-, vor- und nachstationäre Krankenhausversorgung, die stationären Leistungen im Rahmen einer integrierten Versorgung sowie das ambulante Operieren und die ambulante Erbringung hoch spezialisierter Leistungen inklusive der Behandlung seltener Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen.[26]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Krankenhausleistungen
Das daraus abgeleitete Leistungsspektrum beinhaltet die ärztliche Behandlung, die pflegerische Versorgung, die soziale Fürsorge, die seelsorgerische Hilfe und die Hotelversorgung. In Abhängigkeit von Zielsetzung und Aufgabenstellung können die Krankenhausleistungen durch Lehre und Forschung erweitert werden.[27]
Zusammenfassend sind Krankenhäuser Dienstleistungsunternehmen, deren Ziel es sein sollte, Produktionsfaktoren effizient einzusetzen, um Krankenbehandlungen durchzuführen, die dazu beitragen, eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihrer Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Im Mittelpunkt steht die Produktion von Dienstleistungen an Personen, insbesondere von Behandlungs- und Pflegeleistungen an Kranken sowie von Untersuchungs- und Beratungsleistungen an Gesunden und Kranken.[28]
2.4 Statistische Zahlen
Im Jahr 2011 gibt es in Deutschland insgesamt 2.045 Krankenhäuser mit 502.000 Betten. Die Zahl der Häuser sinkt um weniger als 1 Prozent. Für die stationäre Versorgung von 100.000 Einwohnern stehen durchschnittlich 614 Betten zur Verfügung. Ein Krankenhausaufenthalt dauert im Durchschnitt 7,7 Tage, die Bettenauslastung beträgt 77,3 Prozent – ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte. Seit der Einführung der bundeseinheitlichen Krankenhausstatistik im Jahre 1991 steigt der Anteil der Krankenhäuser in privater Trägerschaft, ausgehend von 14,8 Prozent, kontinuierlich an. 2011 ist jedes dritte Krankenhaus in privater Trägerschaft (33,2 Prozent), im gleichen Zeitraum sinkt der Anteil öffentlicher Krankenhäuser von 46 Prozent auf 30,4 Prozent. Der Anteil freigemeinnütziger Versorgungseinrichtungen hat sich demgegenüber nur marginal von 39,1 Prozent auf 36,5 Prozent verändert.[29] Schaubild 4 zeigt die Verteilung der Marktanteile nach Trägerschaft für das Jahr 2011. Die voranschreitende Privatisierung – materiell wie formell – dokumentiert sich auch in der seit 2002 für die öffentlichen Krankenhäuser erfassten Rechtsform. Im Jahr 2011 werden 58,6 Prozent der öffentlichen Krankenhäuser in privatrechtlicher Form betrieben; im Vergleich sind es in 2002 nur 28,3 Prozent. Dagegen liegt der Anteil öffentlicher Krankenhäuser, die als rechtlich unselbstständige Einrichtungen geführt werden, 2011 bei 18,4 %; im Basisjahr hat ihr Anteil an allen öffentlichen Krankenhäusern noch 56,9 % betragen.[30]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Anteil der Krankenhäuser nach Trägerschaft 2011
Quelle: Statistisches Bundesamt (2012), S. 9
Die Verteilung der Krankenhausbetten nach Trägerschaften setzt sich im Betrachtungsjahr wie folgt zusammen: Jedes zweite Bett (48,4 Prozent) steht in einem öffentlichen Krankenhaus, ein Drittel der Krankenhausbetten (34,3 Prozent) in einem freigemeinnützigen Krankenhaus und ein knappes Sechstel (17,3 Prozent) in einem privaten Krankenhaus. Dies ergibt sich aufgrund der Tatsache, dass private Einrichtungen mit durchschnittlich 128 Betten zu den kleinen Krankenhäusern zählen, öffentliche Krankenhäuser mit durchschnittlich 391 Betten die dreifache Größe aufweisen.[31]
Mit rund 1,1 Millionen Beschäftigen stellen Krankenhäuser den wichtigsten Beschäftigungsbereich im Gesundheitswesen dar. Im ärztlichen Dienst steigt
die Zahl der Beschäftigten gegenüber 2010 auf 5.500 Personen (3,7 Prozent), im nichtärztlichen Dienst auf 10.600 (1,1 Prozent). Im Verhältnis betrachtet, entfallen 13,7 Prozent aller Beschäftigten auf den ärztlichen Dienst. Die Vergleichsgröße Vollkräfte im Jahresdurchschnitt steigt um rund 9.400 (1,2 Prozent) auf 825.700 Vollkräfte. Der Anteil der Teilzeit- und geringfügig beschäftigten hauptamtlichen Ärzte liegt bei 18 Prozent (2010: -0,9 Prozent); im nichtärztlichen Dienst standen 45,6 Prozent der Beschäftigten in einem Teilzeit- oder geringfügigen Beschäftigungsverhältnis (im Vorjahr 44,8 Prozent). Ebenfalls zugenommen hat die Zahl der Vollkräfte im nichtärztlichen Dienst um 5.300; dem entsprechen 687.000 Vollkräfte, ein Anstieg von knapp einem Prozentpunkt. Der Anteil des nichtärztlichen Personals an allen Vollkräften liegt bei 83,2 Prozent. Ergänzend zu den Vollkräften mit direktem Beschäftigungsverhältnis werden 2011 knapp 19.500 Vollkräfte ohne direktes Beschäftigungsverhältnis erfasst, die z. B. im Personal-Leasing-Verfahren eingesetzt werden. 3.100 dieser Vollkräfte finden im ärztlichen Dienst und 16.100 im nichtärztlichen Dienst eine Beschäftigung.[32]
Die Zahl der vollstationär behandelten Patienten steigt um 1,7 Prozent auf 18,3 Millionen an. Die durchschnittliche Verweildauer beträt 7,7 Tage und variiert in den verschiedenen Fachabteilungen unterschiedlich lang.[33]
Die Gesamtkosten der Krankenhäuser belaufen sich im Jahr 2011 auf 83,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für das Krankenhauswesen machen rund 30 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben aus. Umgerechnet auf die Zahl der Patienten, die 2011 vollstationär im Krankenhaus behandelt werden, betragen die stationären Krankenhauskosten je Fall im Bundesdurchschnitt 3.960 Euro. In diesem Zusammenhang sei auf unterschiedliche Versorgungsangebote sowie die Art und Schwere der behandelten Erkrankungen hingewiesen. Die Krankenhauskosten ergeben sich im Wesentlichen aus den Personalkosten von 49,5 Milliarden Euro (+ 4,3 Prozent gegenüber 2010), den Sachkosten von 31,7 Milliarden Euro (+ 4,4 Prozent) sowie den Aufwendungen für den Ausbildungsfonds von 1,1 Milliarden Euro (+ 2,7 Prozent). Weitere 1,2 Milliarden Euro entfallen auf Steuern, Zinsen und ähnliche Aufwendungen und auf Kosten der Ausbildungsstätten. Abzüglich der nichtstationären Leistungen liegen die Kosten der rein stationären Krankenhausversorgung bei rund 72,6 Milliarden Euro.[34] Dies impliziert, dass Krankenhausarbeit eine besonders personalintensive Arbeit ist: 68 Prozent der Kosten in Krankenhäusern sind Personalkosten, davon entfallen 61 Prozent auf die Beschäftigen im Pflegebereich und im ärztlichen Dienst.
Im abschließenden Überblick ist festzuhalten, dass das durchschnittliche allgemeine Krankenhaus in Deutschland 200 bis 300 Betten vorhält, über vier medizinische Fachabteilungen, darunter in der Regel eine Abteilung für Innere Medizin, eine chirurgische Abteilung sowie eine Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, verfügt, ein Budget in Höhe von ca. 25 Millionen Euro erhält, ca. 500 Mitarbeiter, darunter rund 50 Ärzte und 200 Pflegekräfte, beschäftigt und ca. 8.000 vollstationäre Fälle im Jahr versorgt.[35]
2.5 Krankenhausträger
Grundsätzlich ist zwischen dem Krankenhausträger als der die Einrichtung führenden Rechtsperson und dem Krankenhaus als tatsächliche Einrichtung zu unterscheiden. Als Krankenhausträger wird der Eigentümer und Betreiber eines Krankenhausbetriebs bezeichnet. Die Rechtspflichten betreffen den Krankenhausträger, da nur dieser Träger von Rechten und Pflichten ist.[36] Träger von Medizinbetrieben sind juristische (öffentlich-rechtliche Anstalten, Stiftungen des öffentlichen Rechts, Kapitalgesellschaften) oder natürliche Personen (Personengesellschaften).[37]
Das Krankenhauswesen in Deutschland zeichnet sich durch eine pluralistische Eigentümerstruktur aus. Nach der Eigentumsträgerschaft, die festlegt, wer eine qualifizierte Kapital- oder Stimmenmehrheit an einem Unternehmen hält, werden Krankenhäuser in drei Gruppen unterteilt: öffentliche, freigemeinnützige und private Trägerformen.[38] Einfachgesetzlich wird der Grundsatz der Trägerschaftspluralität in § 1 II Satz 1 KHG normiert, kodifizierte Definitionen der jeweiligen Trägerschaft gibt es nicht.[39] Grundsätzlich sind alle Trägermodelle legitim und gleichwertig.
Bleibt das eigentliche Management des Krankenhausbetriebes der Krankenhausleitung überlassen, obliegen dem Krankenhausträger folgende Funktionen:
- „Grundsatzentscheidungen über die ärztlich-pflegerische Zielsetzung (Krankenversorgung, Lehre und Forschung),
- Grundsatzentscheidungen über die betrieblich-bauliche Planung und Weiterentwicklung,
- Grundsatzentscheidungen über die Betriebsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation im Bereich von Diagnostik, Therapie, Pflege, Versorgung, Informations- und Rechnungswesen, allgemeine Verwaltung),
- Grundsatzentscheidungen im Personalwesen, vor allem im Bereich der mittel- und langfristigen Personalplanung – Entscheidungen über die personelle Besetzung der Krankenhausleitung, ggf. auch einiger wichtiger Abteilungsleitungen (z.B. leitende Fachärzte) – Feststellung der kurzfristigen Personalplanung (Genehmigung des Stellenplanes),
- Grundsatzentscheidungen im Rahmen der kurz-, mittel- und langfristigen Sachkapitalplanung (Anlage- und Vermögenswirtschaft),
- Grundsatzentscheidungen im Finanzwesen, vor allem im Bereich der mittel- und langfristigen Finanzplanung – Feststellung der kurzfristigen Finanzplanung (Genehmigung des Wirtschafts-/Haushaltsplanes),
- Führungsbezogene Kontrolle der Krankenhausleitung in Form von Dienstaufsicht und Erfolgskontrolle – Kontrolle des laufenden Krankenhausbetriebes im Hinblick auf die Einhaltung aller Grundsatzentscheidungen – Kontrolle des laufenden Krankenhausbetriebes im Hinblick auf die Einhaltung aller Grundsatzentscheidungen – Kontrolle des laufenden Krankenhausbetriebes im Hinblick auf die Einhaltung der kurzfristigen Personal-, Sachkapital- und Finanzplanung (hier vor allem Genehmigung der Jahresrechnung).
- Bei Krankenhausträgern, die mehrere Krankenhäuser vorhalten, bietet sich im Hinblick auf die Rationalisierung der Krankenhausarbeit an, bestimmte Dienstleistungen für alle Krankenhäuser zu zentralisieren: Leistungen im Bereich von Diagnostik, Therapie, Versorgung und Verwaltung (z.B. Laboratoriumsmedizin, Wäscherei, EDV-Rechenzentrum), Leistungen im Bereich der Betriebsorganisation (z.B. Organisationsabteilung, Revisionsabteilung, Informations- und Rechnungswesen). In allen diesen Fällen übernimmt der Krankenhausträger für die Krankenhäuser primär die Funktion eines Dienstleistungsbetriebes.“[40]
Je nach Trägerschaft können die in die Verantwortlichkeit des Eigentümers fallenden Entscheidungs- und Aufsichtsaufgaben auf das oberste Organ und das obere Organ des Krankenhausträgers übertragen werden.[41]
Die regionale Verteilung respektive Ansiedlung von Krankenhäusern einer spezifischen Trägerschaft ist meistens historisch gewachsen. 36 Prozent aller Krankenhäuser, die in freigemeinnütziger Trägerschaft geführt werden, stehen in Nordrhein-Westfalen, während 29 Prozent aller öffentlich getragener Einrichtungen in Bayern verortet sind. Im Saarland erfüllt kein privater Träger den Versorgungsauftrag.[42]
2.5.1 Öffentliche Krankenhäuser
Krankenhäuser, die in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft stehen, werden von Gebietskörperschaften, von Zusammenschlüssen solcher Körperschaften oder von sonstigen öffentlich-rechtlichen Vereinigungen betrieben oder unterhalten. Krankenhäuser, die sich im Eigentum einer öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft befinden, können nach der föderalen Ebene als Krankenhäuser des Bundes, eines Landes oder einer/mehrerer Kommunen unterschieden werden. Der Bund unterhält die Bundeswehrkrankenhäuser. Auf Landesebene finden sich Universitätskliniken, Polizei- und Justizvollzugskrankenhäuser. Auf kommunaler Ebene stehen die städtischen Kliniken oder Zweckverbandskrankenhäuser. Als Beispiele für Einrichtungen in der Trägerschaft einer sonstigen öffentlich-rechtlichen Vereinigung lassen sich Krankenhäuser im Eigentum der Sozialversicherungsträger anführen, etwa Knappschaftskrankenhäuser.[43]
Für die Gebietskörperschaften ist das Erbringen von Krankenhausleistungen eine öffentliche Aufgabe im Kontext der Daseinsvorsorge und dient dem Gemeinwohl.[44] Gemäß den Krankenhausgesetzen der Länder fällt die Aufgabe der Krankenhausversorgung in den Pflichtbereich der kommunalen Gebietskörperschaften. In der Konsequenz werden öffentliche Krankenhäuser in großer Zahl von den Kommunen errichtet und unterhalten und unterstehen dabei der nach Art. 28 GG geschützten Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden. Das Subsidiaritätsprinzip verpflichtet die Gebietskörperschaften, nur dann ein Krankenhaus zu betreiben, wenn das Angebot der freigemeinnützigen oder privaten Krankenhäuser nicht ausreicht, eine flächendeckende und ausreichende Krankenversorgung zu gewährleisten.[45]
Öffentliche Krankenhäuser können in privatrechtlicher Rechtsform und in besonderen öffentlich-rechtlichen Rechtsformen geführt werden. Die Trägerschaft hat das Wahlrecht, das Krankenhaus als Regiebetrieb oder als Eigenbetrieb zu führen.[46] Wie in Schaubild 4 dargestellt, werden die meisten Krankenhäuser in privatrechtlicher Rechtsform geführt.
Trotz sinkender Bettenzahlen und des Verkaufs insbesondere kommunaler Kliniken leisten die öffentlichen Krankenhäuser gegenwärtig immer noch den Hauptteil der stationären Krankenhausversorgung. Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft sind in allen Versorgungsstufen tätig, ihre Bedeutung liegt in der Sicherstellung des Versorgungsangebotes höherer Versorgungsstufen, etwa durch Universitätsklinken.[47]
Aus historischer Sicht geht ein Teil der Krankenhäuser im Eigentum einer öffentlichen Gebietskörperschaft auf kommunale Armenhospitäler des Mittelalters zurück, wo bis zur Reformation fast ausschließlich Ordensleute tätig sind. Das Gebäude und die Ausstattung stellen die Kommunen zur Verfügung. Mit dem Prozess der Kommunalisierung des Hospitals treten die Städte als neue tragende Institutionen des Hospitals in Erscheinung. Während die Krankenhäuser der Sozialversicherungsträger zum Teil auf genossenschaftliche Krankenhäuser zu Beginn der Neuzeit zurückgehen, entstehen Mitte des 19. Jahrhunderts in den Großstädten die ersten modernen Großkliniken bzw. bürgerliche Krankenanstalten.[48] Einen wichtigen Schritt leistet hierbei die Berliner Charité.
2.5.2 Freigemeinnützige Krankenhäuser
Krankenhäuser in freigemeinnütziger Trägerschaft sind Einrichtungen, die nicht in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft stehen und im Sinne der Gemeinnützigkeitsregeln der Abgabeordnung ohne Absicht der Gewinnerzielung betrieben werden.[49] Neben dem Ziel der Bedarfsdeckung verfolgen sie religiöse, humanitäre oder soziale Zwecke. Eigentumseigner sind die Träger der freien Wohlfahrtspflege, private Genossenschaften, Kirchengemeinden, Ordensgemeinschaften und private Stiftungen.[50] Im Verband der freien Wohlfahrtspflege sind der Deutsche Caritasverband, das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz sowie der Paritätische Wohlfahrtsverband zusammengeschlossen.[51] Den größten Anteil gemeinnütziger Krankenhäuser stellen die beiden Kirchen mit ihren Wohlfahrtsorganisationen Diakonie und Caritas.[52]
Von der Tradition her reichen die kirchlichen Krankenhäuser bis ins 9. Jahrhundert zurück, der Gründung der ersten kirchlichen Armenhospitäler. Die Spitalpflege ist lange ein Monopol der Klöster. Erst im Hochmittelalter nehmen sich vor allem Ritterorden und die Reformorden der Krankenpflege an. Durch die Auflösung der Klöster und kirchlichen Stiftungen gehen auch deren Einrichtungen zur Krankenpflege in weltlichen Besitz über. Nach der Säkularisierung kommt es zur Neugründung vieler evangelischer und katholischer Vereinigungen, die sich der Krankenpflege widmen und kirchliche Krankenhäuser gründen.[53]
Als frei werden die Eigentumsträger bezeichnet, weil es ihnen im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichen Trägern frei steht, einen Medizinbetrieb – neben dem Ziel der Bedarfdeckung – zur Verfolgung bestimmter ideeller Zwecke zu betreiben.[54] Bei freigemeinnützigen Krankenhäusern ist das Streben nach Gewinn per Definition ausgeschlossen. Primär geht es um die Bedarfsversorgung unter der Nebenbedingung des effizienten Mitteleinsatzes. Die Idee der Nächstenliebe und Menschlichkeit dominiert die vorwiegend in der Grund-, Regel- und Schwerpunktversorgung tätige Trägerform.[55] Nach § 51 AO ist der freigemeinnützige Träger bei der Wahl der Rechtsform beschränkt auf die Körperschaften im Sinne des Körperschaft- steuergesetz.[56] Freigemeinnützige Versorgungseinrichtungen sind tendenziell weniger in Konzernstrukturen und Klinikketten eingebunden.
Zwei Drittel der deutschen Krankenhäuser sind als gemeinwirtschaftliche Anstalten im Interesse der Öffentlichkeit tätig. Dabei ist das Angebotsverhalten öffentlicher wie freigemeinnütziger Krankenhäuser bedarfswirtschaftlich ausgerichtet.
[...]
[1] Vgl. Simon (2010), S. 9.
[2] Vgl. Statistisches Bundesamt (2013): Gesundheitsausgaben, (2012), URL: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Gesundheitsausgaben/Gesundheitsausgaben.html, (18.01.2013, 22 MEZ).
[3] Vgl. Statistisches Bundesamt (2013): Gesundheitspersonal, (2012), URL: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Gesundheitspersonal/Aktuell.html, (18.01.2013, 22 MEZ).
[4] Vgl. Greiling/Jücker (2003), S. 13.
[5] „DRG: Patientenklassifikationssystem, das anhand von Diagnosen, Prozeduren, Alter etc. eine Aufteilung der Behandlungsfälle mit vergleichbarem Behandlungskostenaufwand vornimmt. Die Vergütung in Form eines Pauschalentgelts erfolgt anhand der zuvor ermittelten DRG-Fallgruppe“, zitiert nach Hellmann (2012), S. 18f.
[6] Vgl. Fleßa (2007), S. IX.
[7] Ebenda.
[8] Vgl. Seelos (2012), S. V.
[9] Vgl. Fleßa (2007), S. IX.
[10] Das öffentlich zur Verfügung stehende Datenmaterial basiert auf den Jahren 2010 und 2011.
[11] Vgl. MARIENHAUS GmbH (2013): http://stwendel.dgserver53.de/Leitbild-und-Traeger.2589.0.html, (24.02.2013, 8:05 MEZ).
[12] Vgl. Fleßa (2007), S. 23.
[13] § 2 KHG.
[14] §107 Abs. 1 SGB V.
[15] Vgl. Simon (2010), S. 256.
[16] Vgl. ebenda.
[17] Vgl. Seelos (2012), S. 21f.; Berger/Stock (2008), S. 29f. Mit Ausnahme der Trägerschaft sollen in diesem Beitrag die einzelnen Kriterien zur Differenzierung von Krankenhäusern nicht näher erläutert werden.
[18] Seelos (2010), S. 178.
[19] Vgl. Berger/Stock (2008), S. 31; auch Simon (2010), S. 260ff.
[20] Vgl. Simon (2007), S. 284-294; Oswald (2008), S. 55; Busse/Schreyögg/Tieman (2010), S. 53.
[21] Vgl. Berger/Stock (2008), S. 31 und Simon (2010), S. 260ff.
[22] Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit als einen Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens (zitiert nach Haubrock/Schär (2007), S. 33). Nach dem Bundessozialgericht ist Krankheit „ein regelwidriger Körper- und Geisteszustand, dessen Eintritt entweder die Notwendigkeit einer Heilbehandlung – allein oder in Verbindung mit Arbeitsunfähigkeit – oder Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat“ (zitiert nach Haubrock/Schär (2007), S. 25).
[23] Vgl. Haubrock/Schär (2007), S. 33; siehe auch Eichhorn (2008), S. 81f.
[24] Vgl. Haubrock/Schär (2007), S. 115.
[25] Vgl. Simon (2007), S. 284-294; vgl. Oswald (2008), S. 55; Busse/Schreyögg/Tieman (2010), S. 53.
[26] Vgl. Seelos (2012); S. 22; Oswald (2008), S. 56 in Verbindung mit §§ 39 SGB V, 115a SGB V, 115b SGB V, 116b SGB V und 140a ff. SGB V.
[27] Vgl. Seelos (2012), S. 22; Busse/Schreyögg/Tieman (2010), S. 48.
[28] Vgl. Oettle (1983), S. 5.
[29] Vgl. Statistisches Bundesamt (2012), S. 8-11.
[30] Vgl. ebenda, S. 8-14.
[31] Vgl. ebenda, S. 8-15.
[32] Vgl. ebenda, S. 8 und S. 56.
[33] Vgl. ebenda, S. 8 und S. 20-26. Siehe Fachserie 12.6.1.1 in 2011 für weitere Details.
[34] Nichtstationäre Leistungen beinhalten unter anderem Kosten für die Ambulanz sowie für wissenschaftliche Forschung und Lehre. Vgl. Statistisches Bundesamt (2013): Krankenhäuser (2012), URL: https:// www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Krankenhaeuser/Aktuell.html, (18.01.2013, 22 MEZ).
[35] Vgl. Simon (2007), S. 256.
[36] Vgl. Lang (2010), S. 50.
[37] Vgl. Seelos (2012), S. 32.
[38] Vgl. Greibling (2000), S. 88.
[39] Vgl. Lang (2010), S. 51.
[40] Eichhorn (1983), S. 64f.
[41] Als oberes Verwaltungsorgan sind u. a. anzusehen: Gemeinderat und Kreistag, Krankenhausausschuss, Gemeindekirchenrat, Kirchenvorstand, Ordensleitung, Mitglieder der Gesellschafterversammlung, oberstes Stiftungsorgan. Zum obersten Verwaltungsorgan zählen u. a. Hauptgemeindebeamte, Landrat, Kuratorium, Stiftungsvorstand. Nähere Angaben siehe Eichhorn (1983), S. 65.
[42] Vgl. Statistisches Bundesamt (2012), S. 17.
[43] Vgl. Greibling (2000), S. 88f.
[44] Ebenda, S. 91.
[45] Vgl. Lang (2010), S. 52.
[46] Vgl. ebenda, S. 53.
[47] Vgl. Simon (2007), S. 257.
[48] Vgl. Greibling (2000), S. 89; auch Wörz (2008), S. 146.
[49] Vgl. Lang (2010), S. 53.
[50] Vgl. Simon (2007), S. 258.
[51] Vgl. Fleßa (2007), S. 64f.
[52] Vgl. Simon (2007), S. 258.
[53] Vgl. Greibling (2000), S. 89.
[54] Vgl. Seelos (2012), S. 34.
[55] Vgl. Simon (2007), S. 258.
[56] Vgl. Lang (2010), S. 54.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es Unterschiede im Führungsstil je nach Krankenhausträger?
Die Arbeit untersucht, ob öffentliche, freigemeinnützige und private Krankenhäuser unterschiedliche Führungsstile pflegen, wobei sie oft auf trägerspezifische Leitbilder zurückgreifen.
Was ist das "triale Organisationsmodell" im Krankenhaus?
Es beschreibt die Zusammenarbeit zwischen dem ärztlichen Dienst, dem Pflegedienst und dem Wirtschafts-/Verwaltungsdienst in der Krankenhausleitung.
Welche Führungsstiltheorien werden in der Arbeit behandelt?
Behandelt werden unter anderem das Kontinuum von Tannenbaum/Schmidt, das Verhaltensgitter von Blake/Mouton und das 3-D-Programm von Reddin.
Welchen Einfluss hat die Einführung der DRGs auf das Management?
Die pauschalierten Entgelte (Diagnosis Related Groups) führten dazu, dass Krankenhäuser sich zu modernen Wirtschaftsbetrieben entwickelten und betriebswirtschaftliche Methoden an Bedeutung gewannen.
Wie wird das Menschenbild nach McGregor im Krankenhauskontext genutzt?
McGregors Theorie X und Y dient als Basis, um die grundsätzlichen Einstellungen von Führungskräften gegenüber ihren Mitarbeitern (z.B. Ärzte oder Pflegepersonal) zu analysieren.
- Quote paper
- Dipl.-Hdl., Dipl.-Betrw. Tanja Röhrig (Author), 2013, Führungsstile bei den verschiedenen Krankenhausträgern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230421