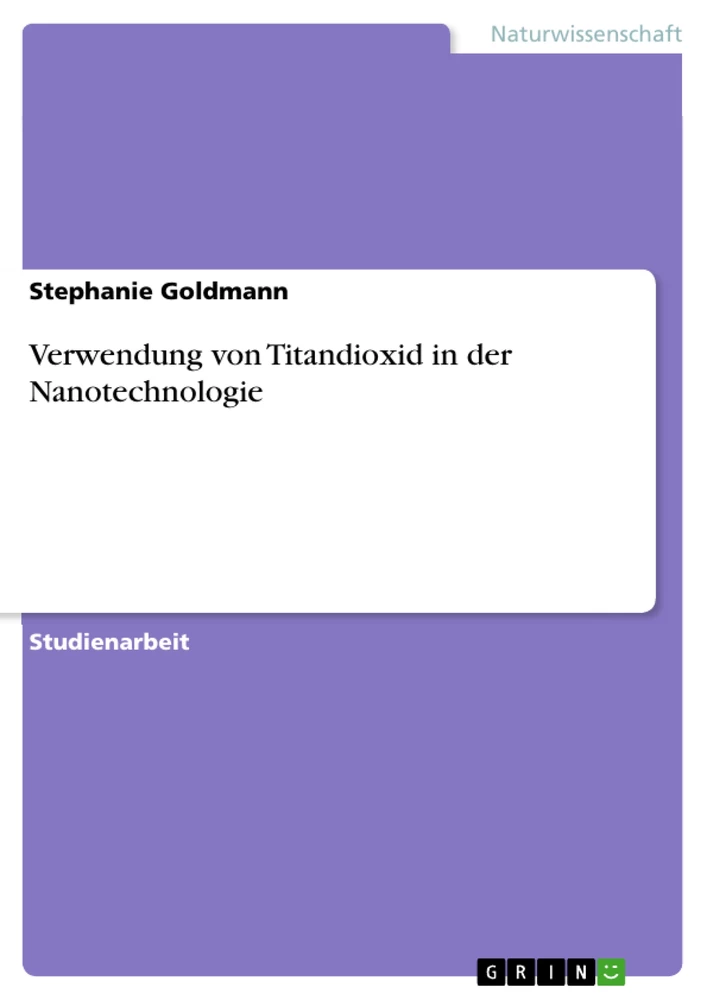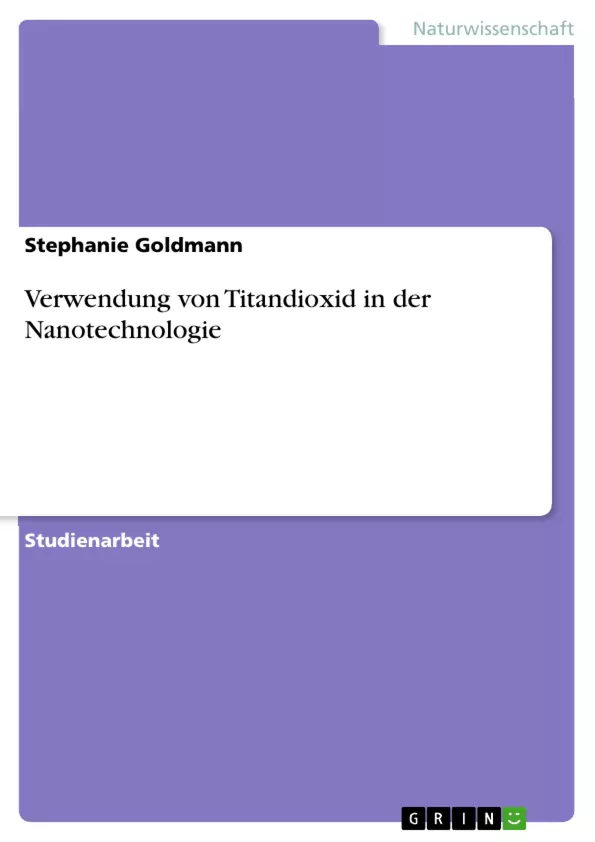Bei kostengünstiger Herstellung hat Titandioxid zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, brillantes Weiß, eine gute Deckkraft und schwächt ultraviolettes Licht ab. Rutil–Titandioxid wird in der Papierproduktion als optischer Aufheller verwendet. Ein weiterer Einsatz von Titandioxid liegt in der Beschichtung von Oberflächen, in Form von flüssigen Farbzubereitungen und als Pulverbeschichtungen. Titandioxid wird, wegen seiner UV–blockierenden Eigenschaft, auch in Plastikwerkstoffen zugesetzt aus denen unterschiedliche Gegenstände hergestellt werden. Eine wichtige Anwendung von Titandioxid liegt in der Kosmetik – und Lebensmittelindustrie. In der Kosmetikindustrie wird es als Weißpigment und als UV–Schutz eingesetzt. In der Lebensmittelindustrie wird Titandioxid zur Verbesserung der Textur verwendet und ist als E 171 als Lebensmittelzusatzstoff bekannt1
[...]
1 http://epub.oeaw.ac.at/ita/nanotrust-dossiers/dossier033.pdf
Inhaltsverzeichnis
I . Abbildungsverzeichnis
II. Tabellenverzeichnis
1. Titandioxid
1.1. Eigenschaften von Titandioxid
1.2. Herstellung von Titandioxid
1.3. Herstellung von Titandioxid–Nanopartikeln
1.3.1 Sol Gel Verfahren
2. Anwendungsbereiche von Titandioxid und Nano-Titandioxid
2.1 Titandioxid in der Lebensmittelindustrie
2.1.1 Titandioxid in Lebensmitteln
2.1.2. Verwendung von Nano – Titandioxid in Verpackungen
2.2. Verwendung von Titandioxid in Kosmetik
2.3. Oberflächenbeschichtungen mit Titandioxid
2.3.1. Der Lotus-Effekt
2.3.2 Easy-to-Clean-Oberflächen
2.3.3 Photokatalytische Effekte des Titandioxid
3. Risiken für die Gesundheit
3.1. In Vivo Studien
4. Gefahren für die Umwelt
5. Quellen
Häufig gestellte Fragen
Welche vorteilhaften Eigenschaften besitzt Titandioxid?
Titandioxid ist korrosionsbeständig, bietet ein brillantes Weiß mit guter Deckkraft und besitzt die Fähigkeit, ultraviolettes Licht abzuschwächen.
Wo wird Titandioxid in der Lebensmittelindustrie eingesetzt?
Es wird zur Verbesserung der Textur verwendet und ist als Lebensmittelzusatzstoff E 171 bekannt. Zudem wird Nano-Titandioxid in Verpackungsmaterialien eingesetzt.
Welche Rolle spielt Titandioxid in der Kosmetik?
In der Kosmetikindustrie dient es primär als Weißpigment und als effektiver UV-Schutz in verschiedenen Produkten.
Was versteht man unter dem photokatalytischen Effekt von Titandioxid?
Durch Bestrahlung mit Licht kann Titandioxid chemische Reaktionen an Oberflächen auslösen, was unter anderem für selbstreinigende "Easy-to-Clean"-Oberflächen genutzt wird.
Gibt es gesundheitliche Risiken bei der Verwendung von Titandioxid?
Die Arbeit untersucht potenzielle Risiken für die Gesundheit und die Umwelt, wobei insbesondere In-Vivo-Studien zur Bewertung der Gefahren herangezogen werden.
Wie werden Titandioxid-Nanopartikel hergestellt?
Ein gängiges Verfahren zur Herstellung von Nanopartikeln ist das Sol-Gel-Verfahren, das in der Arbeit detailliert beschrieben wird.
- Citation du texte
- Stephanie Goldmann (Auteur), 2012, Verwendung von Titandioxid in der Nanotechnologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230436