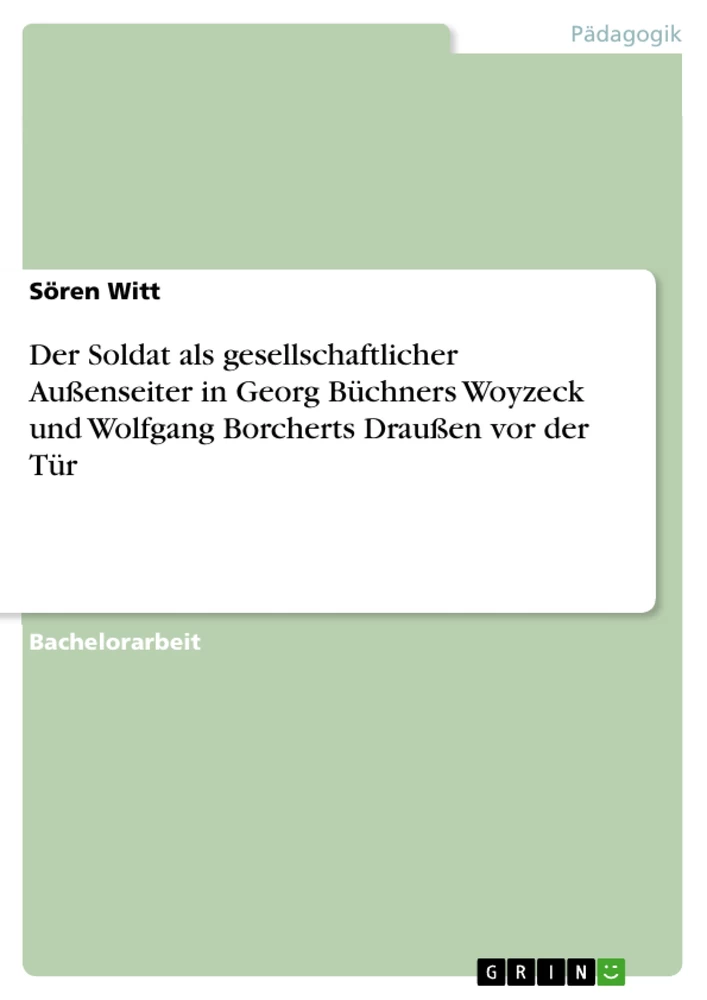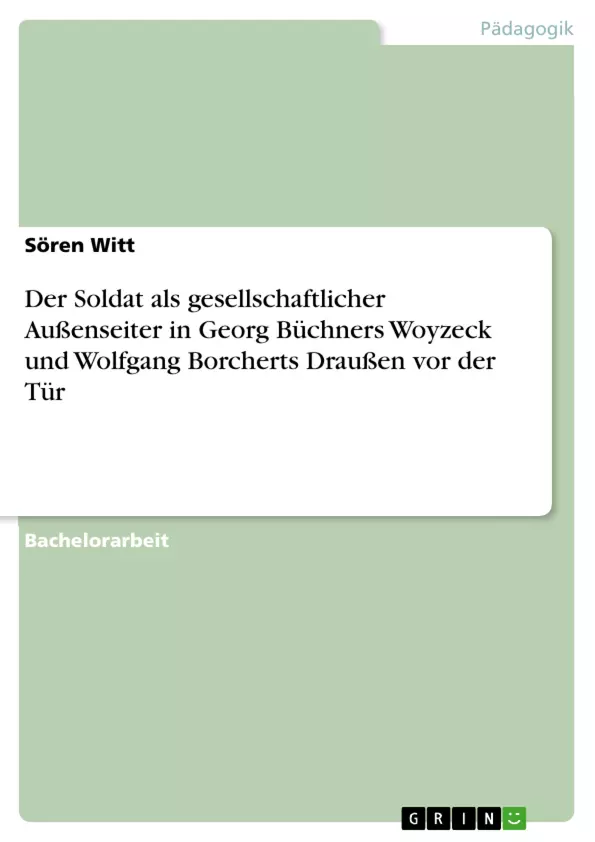Mit der Figur des Woyzeck entwirft Georg Büchner Anfang des 19. Jahrhunderts einen radikal neuen Protagonisten. Als einfacher Soldat entstammt er der untersten Schicht gesellschaftlicher Rangordnung. Andere überlegene Mitmenschen nutzen ihn gnadenlos aus und behandeln ihn menschenunwürdig. Woyzeck kann sich diesem Verhalten nicht widersetzen und sein Leben ist gekennzeichnet durch seine Handlungsunfähigkeit. Determiniert durch diese sozialen Umstände kann er sich nicht wehren und wird zum Mörder der Mutter seines einzigen Kindes.
Georg Büchner hinterlässt mit seinem Fragment eine innovative Art von Literatur, die sich den strengen Vorschriften des klassischen Dramas widersetzt. Weder die literarische Gestaltung noch die Handlungsweise der Protagonisten orientieren sich am antiken Ideal. Es steht nicht mehr die moralische Überlegenheit eines Helden im Vordergrund, sondern das Alltagsleben der verarmten Unterschicht und die großen sozialen Unterschiede seiner Zeit. Der dort beschriebene Prototyp Woyzeck, der abseits der Gesellschaft lebt, weil er weder seine Lebensumstände beeinflussen noch sein eigenes Leben frei bestimmen kann, findet seither oft Einzug in die Literatur verschiedenster Epochen. Ein äußert prägnantes Beispiels sind die Außenseiterfiguren der Nachkriegsliteratur. Gerade in dieser literarischen wie historischen Epoche des Neuanfangs nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches tritt diese elende Außenseiterfigur wiederholt auf. Das Scheitern der vergangenen, nationalsozialistischen Ideologie, welche die Figur des (deutschen) Helden maßlos überhöhte, ruft literarische Gestalten hervor, die sich auffallend konträr zu diesem Ideal verhalten und keineswegs heroisch oder vorbildlich handeln. Exemplarisch soll hier die Figur des Beckmann in Borcherts Drama Draußen vor der Tür betrachtet werden: Der Kriegsheimkehrer, der seinen alten Platz in der Gesellschaft sucht, aber nicht mehr einnehmen kann, weil der unmenschliche Krieg zwischen ihn und die Gesellschaft gerückt ist.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Büchner: Woyzeck
1.1 Vorbemerkung zur Textgrundlage
1.2 Der gesellschaftliche Außenseiter Woyzeck
1.3 Der historische Entstehungskontext
1.4 Das Militär und die Figur des Woyzeck
2 Fazit und Überleitung
3 Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür
3.1 Die Figur des Beckmann
3.2 Der historische Entstehungskontext
4 Vergleich der Figuren
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis
6.1 Primärliteratur
6.2 Sekundärliteratur
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Woyzeck als gesellschaftlicher Außenseiter betrachtet?
Woyzeck gehört der untersten sozialen Schicht an, wird von Vorgesetzten menschenunwürdig behandelt und ist aufgrund seiner Armut und sozialen Determination handlungsunfähig.
Welche Parallelen gibt es zwischen Woyzeck und Beckmann?
Beide sind Soldatenfiguren, die am Rande der Gesellschaft stehen. Während Woyzeck durch Armut determiniert ist, ist Beckmann durch die Traumata des Krieges von der Gesellschaft entfremdet.
Wie unterscheidet sich Büchners Drama vom klassischen Drama?
Büchner bricht mit dem antiken Ideal des moralisch überlegenen Helden und stellt stattdessen das Elend der Unterschicht und soziale Ungerechtigkeit in den Fokus.
Was symbolisiert Beckmann in "Draussen vor der Tür"?
Er verkörpert den Kriegsheimkehrer der Nachkriegsliteratur, der nach dem Zusammenbruch nationalsozialistischer Ideale keinen Platz mehr in der Zivilgesellschaft findet.
Welche Rolle spielt das Militär in beiden Werken?
Das Militär wird als entmenschlichender Apparat dargestellt, der das Individuum bricht und es zum Außenseiter macht, der weder über sein Leben noch über seine Moral frei bestimmen kann.
- Arbeit zitieren
- Sören Witt (Autor:in), 2013, Der Soldat als gesellschaftlicher Außenseiter in Georg Büchners Woyzeck und Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230524