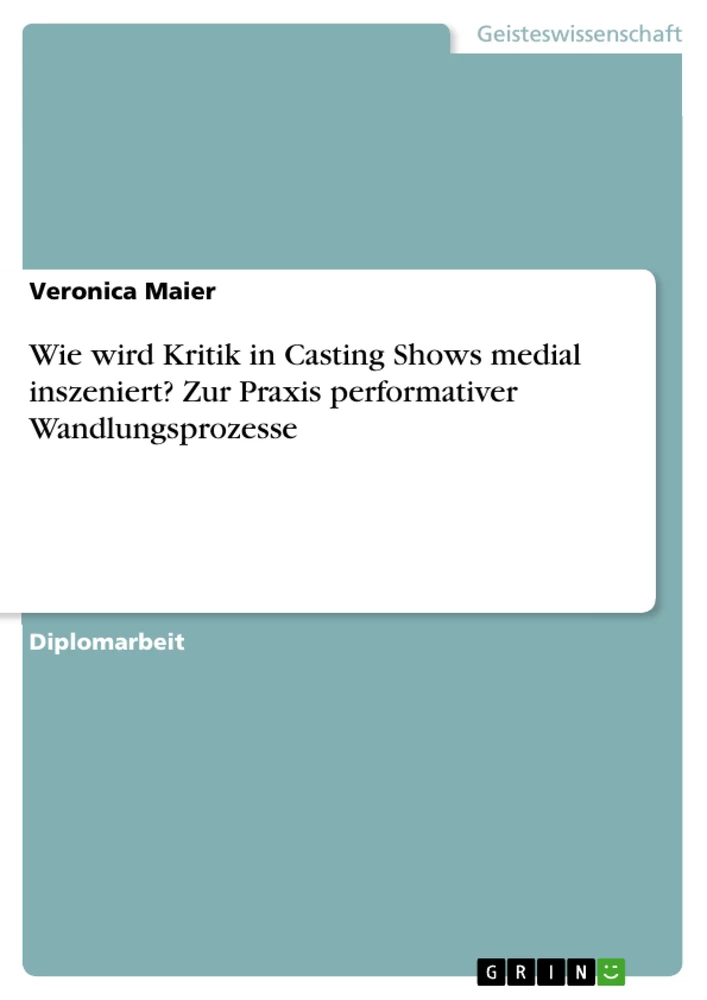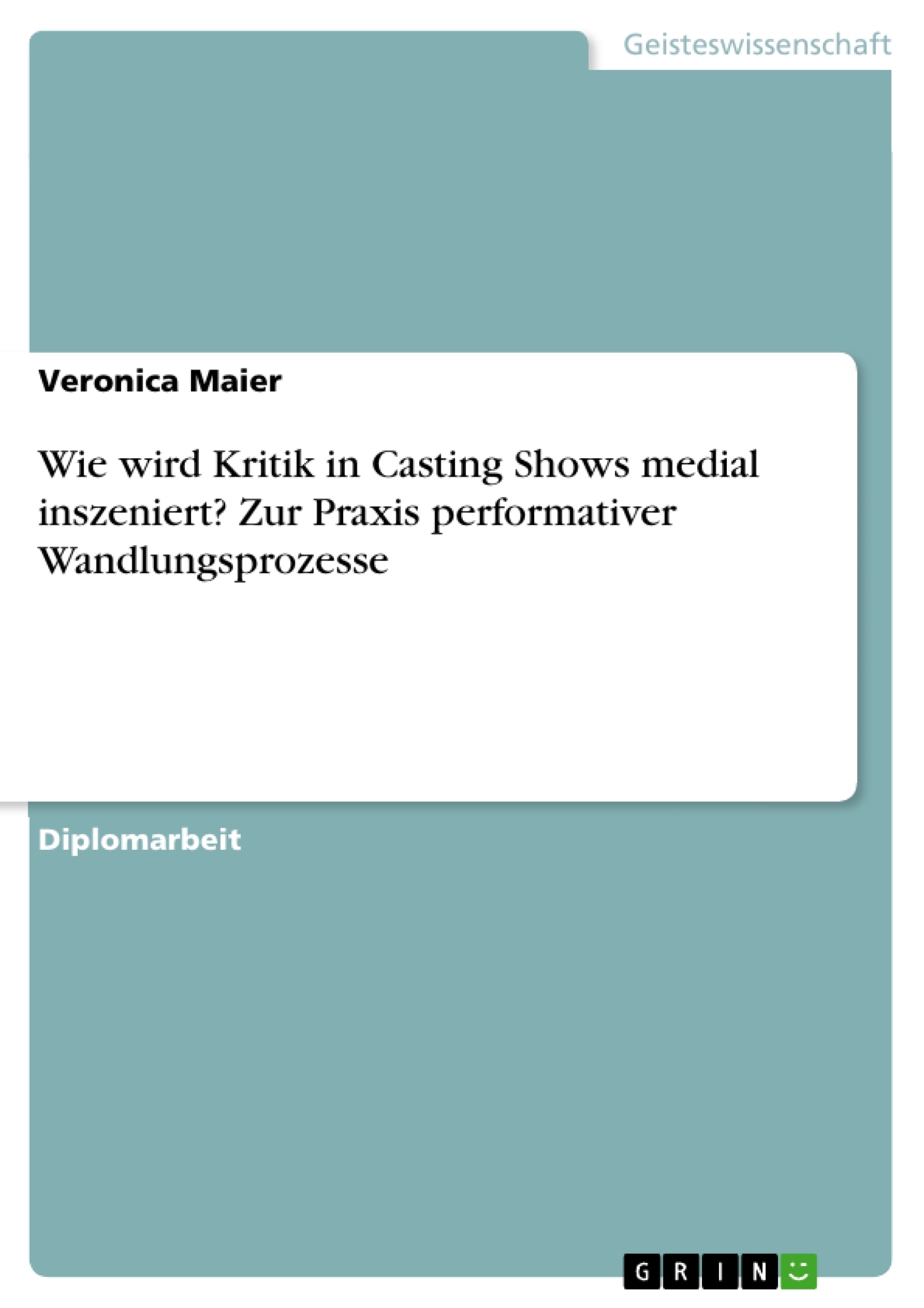Seit im Jahr 2000 die erste Staffel ”Popstars“ im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde, haben die ”Casting Shows“ ihren Siegeszug durch das Privatfernsehen, aber auch in den öffentlich rechtlichen Programmen angetreten. Neben ”Popstars“ (ProSieben) entstanden hierzulande noch Casting-Formate wie ”Deutschland sucht den Superstar“ (RTL), ”Musical Showstar 2008“ (ZDF), ”Starsearch“ (Sat1), und viele mehr. Die Kritiker dieses Fernsehformates sehen diesen Erfolg auf dem Voyeurismus der Rezipienten begründet, so schreibt die Zeit Online: ”Das Rezept ist einfach: Das Publikum darf seinen Voyeurismus vor dem Fernsehgerät ausleben, und die Kandidaten lockt das Versprechen von der schillernden Musikkarriere.“
Doch ist die Annahme in dieser Einfachheit haltbar? Ein weiterer häufig geäußerter Kritikpunkt an Formaten wie dem der ”Casting Show“ ist der, dass sie die Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatheit auflösen (vgl. Reichertz/Fromm 2002, S. 78). Emotionen und Intimität erscheinen nun vor einem Millionenpublikum, gehörten sie doch im bisherigen Verständnis in die Privatsphäre.
Gegen kritische Stimmen solcher Art muss folgende Perspektive gesetzt werden: Die Lebenswelt des Einzelnen gestaltet sich immer unübersichtlicher. Dies zwingt den Akteur dazu, sich neuen kulturellen Ressourcen zuzuwenden, die ihm Handlungsorientierungen für seinen Alltag liefern. Hierzu zählt ebenfalls das Fernsehen mit der ihm eigenen Kultur und den kulturellen Praktiken, die es vermittelt (vgl. Iványi/Reichertz 2002, S. 9). Aus dieser Perspektive heraus gilt es sich, anzusehen, welche Handlungsressourcen durch Formate, wie
dem der ”Casting Show“, zur Verfügung gestellt werden. Eben dies macht sich die hier vorliegende Arbeit zur Aufgabe, zu zeigen, welches prägende Element innerhalb der Casting-Formate sichtbar und somit als Handlungsorientierung für den Alltag der Rezipienten nutzbar wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 „Reality TV“ in einer liberalen Gesellschaft
- 2.1 Die Begrifflichkeiten eines „jungen“ Fernsehgenres
- 2.1.1 Richtungsweisende Gedanken zur Funktion und Bedeutung des „Reality TV“
- 2.2 Die Entgrenzung von Öffentlichkeit und Privatheit durch das „Reality TV“
- 2.3 Das tragende Thema der „Talk Shows“
- 2.3.1 „Daily Talk“ als moralischer Diskurs
- 2.3.2 „Suffering“ und „Change“ als grundlegende Thematik der „Talk Shows“
- 2.4 Beziehungsshows und die öffentliche Darstellung von „Liebe“
- 2.4.1 Die mediale Darstellung von „Glück“
- 2.5 „Big Brother“ und die Darstellung von Alltäglichkeit
- 2.1 Die Begrifflichkeiten eines „jungen“ Fernsehgenres
- 3 Der wissenschaftliche Diskurs der „Casting Shows“
- 3.1 Forschungsrelevante Anmerkungen zu den „Casting Shows“
- 3.2 „Casting Shows“ als Spiegel der Leistungsgesellschaft
- 3.3 Identifikationsangebote der „Casting Shows“ für die Rezipienten
- 3.4 Weitere Aspekte der „Casting Shows“
- 4 Forschungsdesign und Methode der Datenerhebung
- 4.1 Forschungsinteresse und Forschungsfrage
- 4.2 Qualitativer Forschungsansatz: Grounded Theory
- 4.2.1 Der methodische Ansatz
- 4.2.2 Die Adäquatheit der Grounded Theory für den Forschungsgegenstand
- 4.3 Die methodische Forschungsarbeit
- 4.3.1 Die Kernkategorien der Bewertungsszenen der „Casting Shows“
- 5 Die mediale Darstellung von Kritik innerhalb der „Casting Shows“
- 5.1 Differenzierte Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes „Casting Show“
- 5.2 Die Ausübung von Kritik als asymmetrische Interaktionsordnung
- 5.2.1 Die Disziplinierung der Körper zur Aufnahme der Kritik
- 5.2.2 Musik anstelle sprachlicher Reaktionen auf Kritik
- 5.2.3 Die Ausformung eines asymmetrischen Beziehungsgeflechts
- 5.3 Die Charakterisierung der sprachlichen Form der Kritik
- 5.4 Die performative Konstruktion von Person und Persönlichkeit
- 6 Diskussion: Kritik als Instrument eines Wandlungsprozesses
- 6.1 Wandlungsprozess ohne Steuerungsmöglichkeit durch das Selbst
- 6.2 Die Kritik ist der Wandel
- 6.3 Die Akzeptanz der Asymmetrie
- 6.4 Der Lerneffekt für das kommunikative Handeln in Kritiksituationen
- 7 Fazit: Unproblematische Form der Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Handlungsressourcen, die durch das Fernsehformat „Casting Show“ vermittelt werden. Im Fokus steht die Analyse der medial dargestellten Kritik und deren Relevanz für das kommunikative Handeln der Zuschauer im Alltag. Die Studie untersucht, wie Kritik innerhalb des Formats konstruiert und präsentiert wird und welche Auswirkungen dies auf die Rezipienten hat.
- Mediale Darstellung von Kritik in „Casting Shows“
- Handlungsorientierungen und kulturelle Ressourcen im Kontext von Reality-TV
- Asymmetrische Interaktionsordnungen und Machtverhältnisse in „Casting Shows“
- Beziehung zwischen „Reality TV“ und der liberalen Gesellschaft
- Wirkung von „Casting Shows“ auf das kommunikative Handeln der Zuschauer
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der „Casting Shows“ ein, beleuchtet deren Popularität und die bestehenden kritischen Auseinandersetzungen, insbesondere hinsichtlich des Voyeurismus und der Auflösung der Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. Sie skizziert den Forschungsansatz, der sich auf die Identifizierung von Handlungsressourcen konzentriert, die durch „Casting Shows“ bereitgestellt werden, und kündigt den Aufbau der Arbeit an.
2 „Reality TV“ in einer liberalen Gesellschaft: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Formate des „Reality TV“, wie „Talk Shows“, Beziehungsshows und „Big Brother“, um die bisherigen Forschungsansätze und die darin identifizierten Handlungsorientierungen zu beleuchten. Es wird der Zusammenhang zwischen diesen Formaten und einer liberalen Gesellschaft untersucht. Die Analyse der verschiedenen Genres dient als Grundlage für das Verständnis der „Casting Show“ als spezifisches Genre innerhalb des „Reality TV“-Bereichs.
3 Der wissenschaftliche Diskurs der „Casting Shows“: Dieses Kapitel beleuchtet den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs rund um „Casting Shows“. Es untersucht die kulturelle Rahmung dieser Formate, verschiedene Forschungsperspektiven und deren jeweiligen Schwerpunktsetzungen. Die Zusammenfassung des wissenschaftlichen Diskurses liefert den notwendigen Hintergrund für die eigene empirische Untersuchung.
4 Forschungsdesign und Methode der Datenerhebung: Hier wird die Methodik der Datenerhebung detailliert beschrieben, inklusive des gewählten qualitativen Forschungsansatzes (Grounded Theory). Die Beschreibung der Methode dient dazu, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Studie zu gewährleisten und den Leser für die Interpretation der empirischen Ergebnisse zu sensibilisieren. Es wird die Auswahl der Grounded Theory begründet und der methodische Ablauf der Forschungsarbeit erläutert.
5 Die mediale Darstellung von Kritik innerhalb der „Casting Shows“: Dieses Kapitel präsentiert die empirischen Ergebnisse. Es analysiert die mediale Darstellung von Kritik innerhalb der „Casting Shows“, indem es die sprachliche Form der Kritik, die asymmetrischen Interaktionsordnungen und die performative Konstruktion von Person und Persönlichkeit untersucht. Die Analyse fokussiert darauf, wie Kritik als Instrument eines Wandlungsprozesses innerhalb des Formats wirkt.
6 Diskussion: Kritik als Instrument eines Wandlungsprozesses: Die Diskussion dieses Kapitels beleuchtet die strukturellen Besonderheiten der medial dargestellten Kritik in „Casting Shows“. Es werden die verschiedenen Facetten der Kritik im Detail erörtert und deren Relevanz für das kommunikative Handeln der Zuschauer im Alltag untersucht. Es wird analysiert wie der Prozess der Kritik abläuft und welche Rolle die Asymmetrie zwischen den Akteuren spielt. Die Diskussion verbindet die Ergebnisse mit den theoretischen Überlegungen aus den vorherigen Kapiteln.
Schlüsselwörter
Casting Shows, Reality TV, Kritik, mediale Darstellung, Handlungsressourcen, Grounded Theory, asymmetrische Interaktion, Kommunikation, Leistungsgesellschaft, Identifikation, öffentliche und private Sphäre.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der medialen Darstellung von Kritik in Castingshows
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die mediale Darstellung von Kritik in Castingshows und untersucht, welche Handlungsressourcen dieses Fernsehformat vermittelt. Im Fokus steht die Relevanz der dargestellten Kritik für das kommunikative Handeln der Zuschauer im Alltag.
Welche Arten von Reality-TV-Formaten werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht verschiedene Reality-TV-Formate, darunter Talkshows, Beziehungsshows, Big Brother und insbesondere Castingshows. Diese werden im Kontext einer liberalen Gesellschaft analysiert.
Welche Forschungsmethodik wurde angewendet?
Es wurde ein qualitativer Forschungsansatz mit Grounded Theory verwendet. Die Methodik wird detailliert beschrieben, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Die Auswahl der Grounded Theory wird begründet und der methodische Ablauf der Forschungsarbeit erläutert.
Welche Aspekte der Kritik in Castingshows werden analysiert?
Die Analyse umfasst die sprachliche Form der Kritik, asymmetrische Interaktionsordnungen (z.B. die Machtverhältnisse zwischen Jury und Kandidaten), die performative Konstruktion von Person und Persönlichkeit, und die Kritik als Instrument eines Wandlungsprozesses.
Welche zentralen Ergebnisse werden präsentiert?
Die empirischen Ergebnisse analysieren, wie Kritik in Castingshows medial konstruiert und präsentiert wird und welche Auswirkungen dies auf die Rezipienten hat. Es wird untersucht, wie der Prozess der Kritik abläuft und welche Rolle die Asymmetrie zwischen den Akteuren spielt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Reality TV in einer liberalen Gesellschaft, wissenschaftlicher Diskurs zu Castingshows, Forschungsdesign und Methode, mediale Darstellung von Kritik in Castingshows, Diskussion: Kritik als Instrument eines Wandlungsprozesses und Fazit. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, sowie eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel und ein Schlüsselwortverzeichnis.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Castingshows, Reality TV, Kritik, mediale Darstellung, Handlungsressourcen, Grounded Theory, asymmetrische Interaktion, Kommunikation, Leistungsgesellschaft, Identifikation, öffentliche und private Sphäre.
Welchen Zusammenhang besteht zwischen Castingshows und der liberalen Gesellschaft?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen verschiedenen Reality-TV-Formaten, inklusive Castingshows, und den Werten und Strukturen einer liberalen Gesellschaft. Dies umfasst die Betrachtung von Themen wie die Entgrenzung von Öffentlichkeit und Privatheit und die Darstellung von "Liebe", "Glück" und "Alltäglichkeit".
Welche Rolle spielt die Asymmetrie in den Interaktionen?
Die Asymmetrie der Interaktionen zwischen Jury und Kandidaten wird als zentrales Merkmal der Castingshow-Kritik analysiert. Es wird untersucht, wie diese Asymmetrie die Ausübung und Wahrnehmung von Kritik beeinflusst und welche Folgen dies für die beteiligten Personen hat.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet die Bedeutung der Analyse der medialen Darstellung von Kritik in Castingshows für das Verständnis von Kommunikationsprozessen und der Wirkung von Medien auf die Rezipienten.
- Arbeit zitieren
- Veronica Maier (Autor:in), 2008, Wie wird Kritik in Casting Shows medial inszeniert? Zur Praxis performativer Wandlungsprozesse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230571