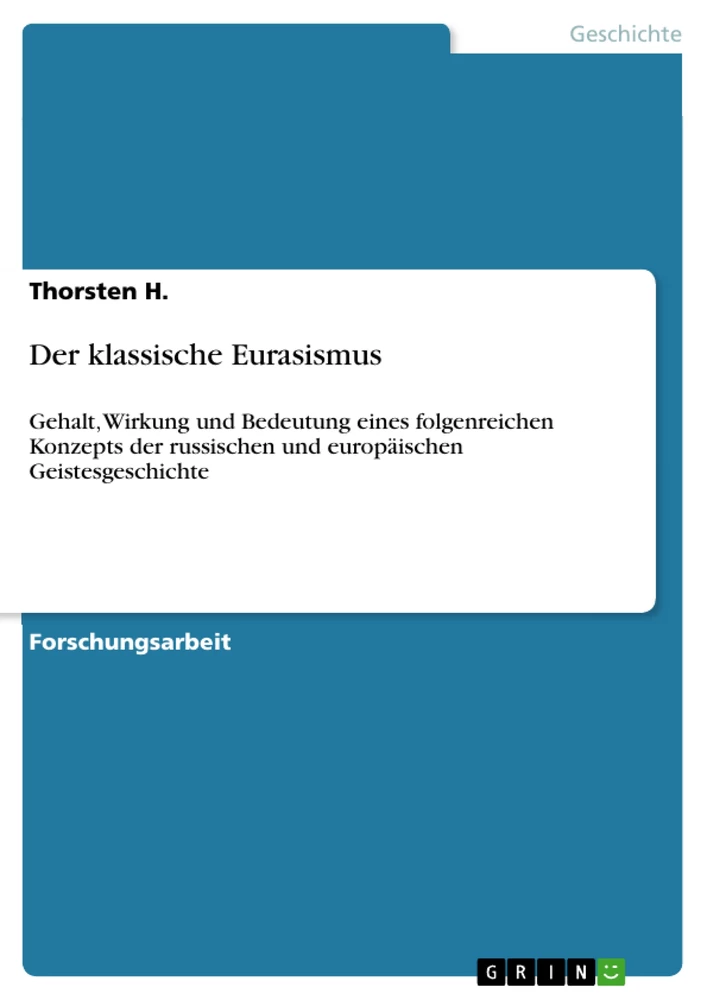Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, über eine kohärente, deskriptive Darstellung der eurasischen Idee deutlich zu machen, warum der klassiche Eurasismus als „imperiale Legitimationsideologie“ zu charakterisieren ist. Zum anderen soll mit der bisher noch nicht erprobten Anwendung des Konzepts der »politischen Religion« analytisch auf den totalitären Gehalt des Eurasismus aufmerksam gemacht werden, um ihn anschließend in den größeren Zusammenhang der europäischen Geistesgeschichte einordnen zu können. Dies soll Klarheit darüber schaffen, wie der klassische Eurasismus aus heutiger Perspektive zu beurteilen ist und damit deutlich machen, welchen Ursprung bzw. welche politische Bedeutung die aktuellen Varianten dieses Konzepts haben. Diesem Anliegen folgend wird eine Analyse des klassischen Eurasismus vorgenommen, und zwar weitestgehend ohne Berücksichtigung der post-sowjetischen Eurasismen, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Vor der eigentlichen Analyse sollen zunächst die historischen Rahmenbedingungen rekonstuiert und die Trägergruppe der eurasischen Bewegung der Zwischenkriegszeit beschrieben werden. Im Anschluss daran erfolgt die eigentliche Analyse, welche deutlich machen soll, dass der Eurasismus als agitatorisches Instrument einer subversiven politischen Gruppierung dazu diente, fest umrissene Zielgruppen in Gestalt der russischen Emigrantengemeinde sowie der nicht-russischen Völker zu mobilisieren. Anhand des zu Grunde liegenden argumentativen Dreischritts von Identitätsbildung, Feindbildkonstruktion und Konstitution einer politischen Gemeinschaft, erfolgt die Analyse in drei Schritten, die sich nacheinander mit der kulturell-geographischen Einheit Eurasisens, der kulturellen Abgrenzung zum Westen sowie der politischen Konzeption des Eurasismus beschäftigen. Im vierten Teil wird schließlich das Konzept der »politischen Religion« erprobt, bevor im Schlussteil die Ergebnisse thesenartig zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Kontext
- Gesellschaftlicher Wandel im Krieg (1914-1922)
- Die potenzielle Sprengkraft nationaler Unabhängigkeitsbestrebungen
- Krise der russischen Identität
- Die Eurasier als konspirative gegenrevolutionäre Bewegung
- Der klassische Eurasismus als imperiale Legitimationsideologie
- Eurasien als einzigartiger geographischer Raum
- Von ethnisch-kultureller Vielfalt zu staatlicher Einheit
- Die historische Bedeutung des russischen Volkes und die Rolle der Orthodoxie
- Kulturrelativismus und die Zurückweisung des europäischen Kosmopolitismus
- Die politische Konzeption der Eurasier
- Das Scheitern des klassischen Eurasismus
- Das Modell der »politischen Religion«
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, den klassischen Eurasismus der Zwischenkriegszeit als „imperiale Legitimationsideologie“ zu charakterisieren und dessen totalitären Gehalt mithilfe des Konzepts der „politischen Religion“ zu analysieren. Sie soll den Eurasismus in die europäische Geistesgeschichte einordnen und seine Bedeutung für aktuelle eurasische Konzepte beleuchten. Die Analyse konzentriert sich dabei auf den klassischen Eurasismus, ohne die post-sowjetischen Entwicklungen zu berücksichtigen.
- Der klassische Eurasismus als ideologische Konstruktion
- Die Rolle des Eurasismus in krisenhaften gesellschaftlichen Zuständen
- Die kulturelle und geographische Definition Eurasiens
- Der Eurasismus als Instrument der Mobilisierung
- Der totalitäre Gehalt des Eurasismus im Kontext der „politischen Religion“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den klassischen Eurasismus als ein viel diskutiertes politisches Konzept im post-sowjetischen Russland, das unterschiedlichen Interpretationen und politischen Kontexten ausgesetzt ist. Die Arbeit untersucht die Vielschichtigkeit des Konzepts und seine Konjunktur in krisenhaften gesellschaftlichen Zuständen, die einen Bedarf nach sinnstiftenden Ideen hervorrufen. Das Ziel ist eine kohärente Darstellung des Eurasismus als „imperiale Legitimationsideologie“ und die Analyse seines totalitären Gehalts mithilfe des Konzepts der „politischen Religion“, um seine Bedeutung in der europäischen Geistesgeschichte und seine Relevanz für aktuelle eurasische Varianten zu klären.
Historischer Kontext: Dieses Kapitel rekonstruiert die Rahmenbedingungen des Entstehens und der Verbreitung des klassischen Eurasismus in der Zwischenkriegszeit, einer Epoche politischer Krisen und sozialer Spannungen. Es beschreibt den Übergang vom „langen 19. Jahrhundert“ zum „Zeitalter der Extreme“ und die daraus resultierende Orientierungslosigkeit. Die Suche nach neuen politischen Herrschaftsmodellen und das angespannte geistige Klima der Zeit begünstigten die Entstehung und Verbreitung politischer Ideen mit einem erheblichen agitatorischen Potenzial, darunter der Eurasismus.
Gesellschaftlicher Wandel im Krieg (1914-1922): Dieses Unterkapitel analysiert den gesellschaftlichen Wandel während des Ersten Weltkriegs und die Folgen für Russland. Es wird das Memorandum von Pyotr Durnovo an Zar Nikolaus II. zitiert, das vor den negativen Folgen des Krieges und der Gefahr einer sozialistischen Revolution warnt. Die Analyse verdeutlicht die ökonomische Schwäche und die gesellschaftliche Unterentwicklung Russlands, die zu schwerwiegenden militärischen Rückschlägen und sozialen Unruhen führten, die schließlich in den Revolutionen von 1917 mündeten. Diese Ereignisse markieren einen entscheidenden Wendepunkt in der russischen Geschichte.
Schlüsselwörter
Eurasismus, Zwischenkriegszeit, Russland, imperiale Legitimationsideologie, politische Religion, Identität, geographische Einheit Eurasiens, kulturelle Abgrenzung, Mobilisierung, totalitärer Gehalt, europäische Geistesgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zum klassischen Eurasismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den klassischen Eurasismus der Zwischenkriegszeit als „imperiale Legitimationsideologie“ und analysiert seinen totalitären Gehalt anhand des Konzepts der „politischen Religion“. Sie betrachtet den Eurasismus im Kontext der europäischen Geistesgeschichte und beleuchtet seine Bedeutung für heutige eurasische Konzepte, wobei der Fokus auf dem klassischen Eurasismus liegt und post-sowjetische Entwicklungen außen vor gelassen werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den klassischen Eurasismus als ideologische Konstruktion, seine Rolle in krisenhaften gesellschaftlichen Zuständen, die kulturelle und geographische Definition Eurasiens, den Eurasismus als Instrument der Mobilisierung und seinen totalitären Gehalt im Kontext der „politischen Religion“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum historischen Kontext (inkl. Unterkapitel zum gesellschaftlichen Wandel im Krieg 1914-1922), ein Kapitel zum Eurasismus als gegenrevolutionäre Bewegung, ein Kapitel zum klassischen Eurasismus als imperiale Legitimationsideologie, ein Kapitel zum Modell der „politischen Religion“ und eine Zusammenfassung. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Was wird unter „klassischem Eurasismus“ verstanden?
Der „klassische Eurasismus“ bezieht sich auf die eurasische Ideologie der Zwischenkriegszeit, die in dieser Arbeit als „imperiale Legitimationsideologie“ charakterisiert wird. Es handelt sich um ein vielschichtiges Konzept, das unterschiedlichen Interpretationen und politischen Kontexten ausgesetzt ist.
Welchen historischen Kontext beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext des Entstehens und der Verbreitung des klassischen Eurasismus in der Zwischenkriegszeit, geprägt von politischen Krisen und sozialen Spannungen. Der Übergang vom „langen 19. Jahrhundert“ zum „Zeitalter der Extreme“ und die daraus resultierende Orientierungslosigkeit werden beschrieben. Das angespannte geistige Klima der Zeit begünstigte die Entstehung und Verbreitung von Ideen mit agitatorischem Potenzial, darunter der Eurasismus.
Welche Rolle spielt der Erste Weltkrieg?
Der Erste Weltkrieg und seine Folgen für Russland werden als entscheidender Faktor für den gesellschaftlichen Wandel und das Entstehen des Eurasismus analysiert. Der gesellschaftliche Wandel, die ökonomische Schwäche und die gesellschaftliche Unterentwicklung Russlands, die zu militärischen Rückschlägen und sozialen Unruhen führten, werden im Detail dargestellt.
Welche Schlüsselkonzepte werden verwendet?
Schlüsselkonzepte der Arbeit sind Eurasismus, imperiale Legitimationsideologie, politische Religion, Identität, geographische Einheit Eurasiens, kulturelle Abgrenzung, Mobilisierung und totalitärer Gehalt.
Welche Bedeutung hat das Konzept der „politischen Religion“?
Das Konzept der „politischen Religion“ dient der Analyse des totalitären Gehalts des klassischen Eurasismus. Es hilft, die ideologische Struktur und die Mobilisierungspotenziale des Eurasismus zu verstehen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf eine kohärente Darstellung des Eurasismus als „imperiale Legitimationsideologie“ und die Analyse seines totalitären Gehalts ab. Sie klärt dessen Bedeutung in der europäischen Geistesgeschichte und seine Relevanz für heutige eurasische Varianten.
- Quote paper
- Thorsten H. (Author), 2011, Der klassische Eurasismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230626