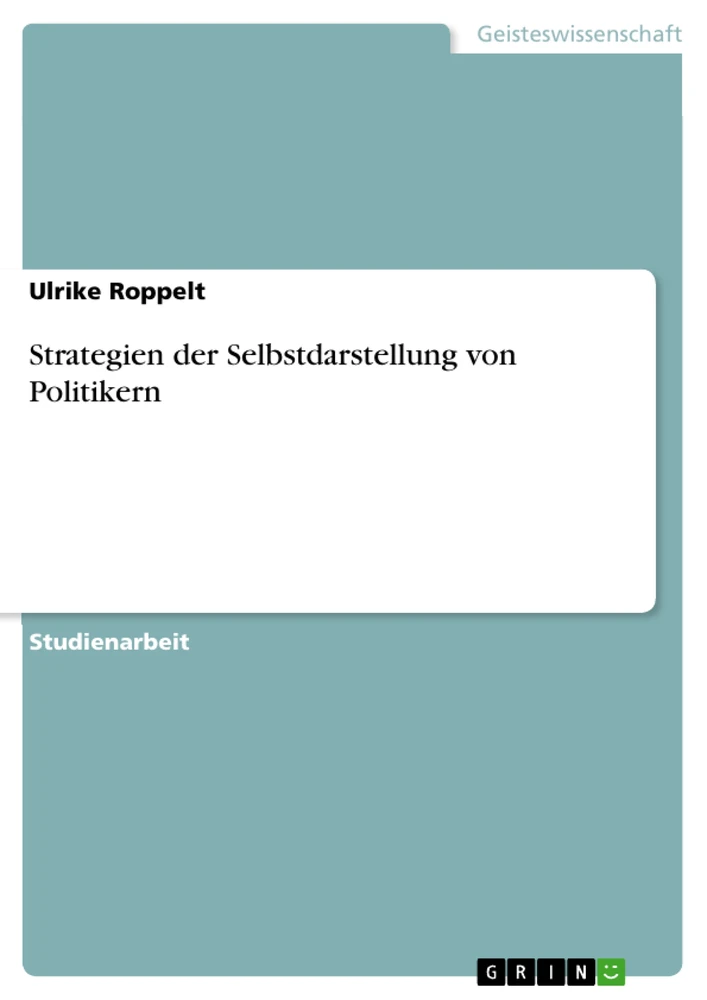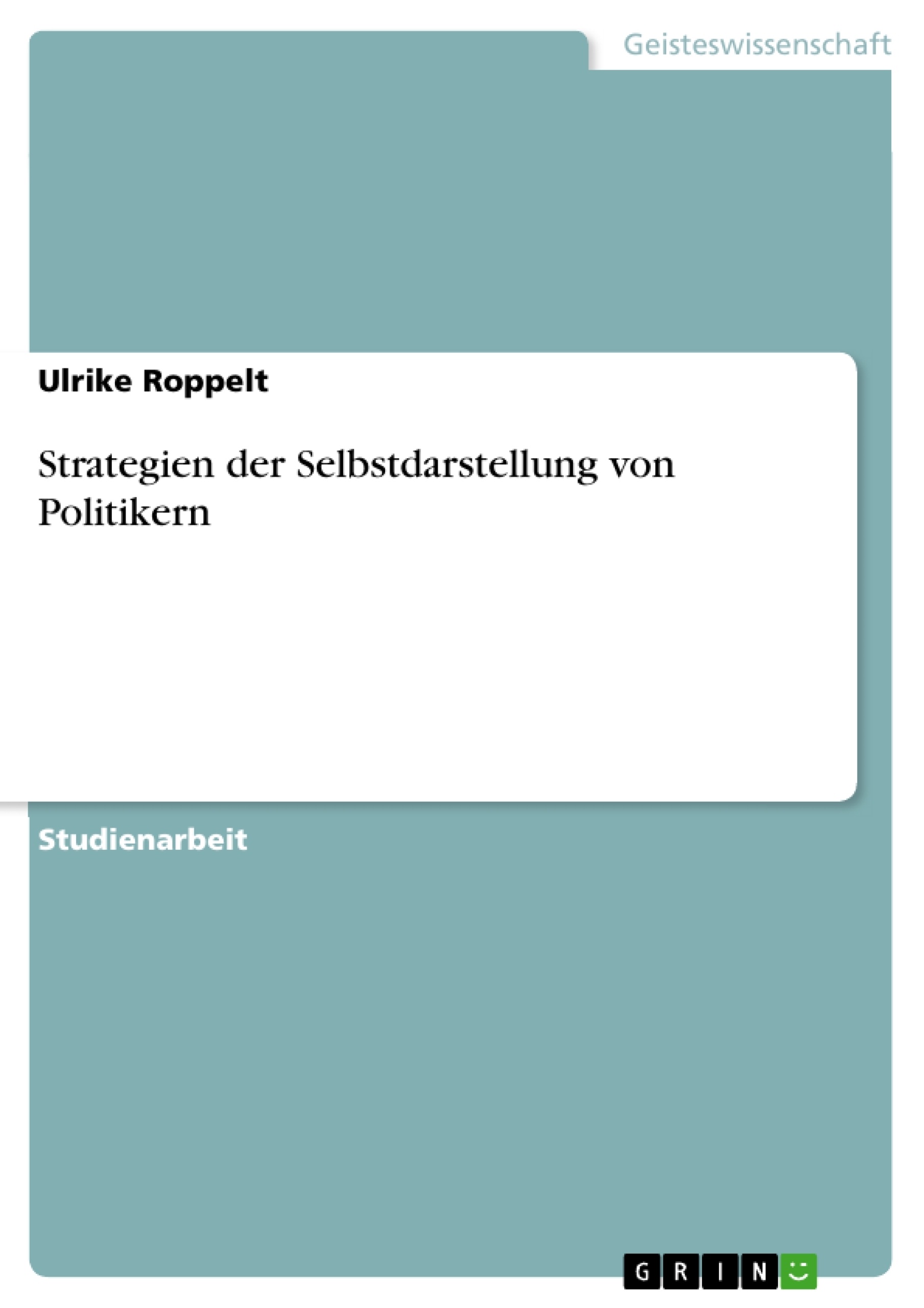Was jemand ist, was er sein möchte, als was er von anderen Menschen gesehen und beurteilt werden möchte, kurz: wie sich ein Mensch anderen gegenüber darstellt, das läßt sich auf vielerlei Art und Weise ausdrücken. So findet man im menschlichen Alltag eine Fülle von Ausdrucksweisen, in denen diese Tendenz zur Selbstdarstellung entweder besonders deutlich ausgeprägt ist oder die von vornherein und erklärtermaßen auch der Selbstpräsentation der Person, die sie hervorbringt, dienen. Werke aller Art, seien es handwerkliche Produkte, Autobiographien, Tagebücher, Theatervorstellungen, Performance oder Selbstportraits, wie das christusähnliche Selbstbildnis von Dürer, sind solche gewissermaßen‚ geronnenen verfestigten Äußerungen menschlicher Selbstdarstellung‘.
‚Selbstdarstellung‘ ist nach Mummendey (1995) immer ‚Darstellung des Individuums gegenüber einem wie auch immer gearteten Publikum‘. Egal, ob in der Kunst oder im Handwerk, im Beruf oder im Alltag - man stellt sich seiner sozialen Umwelt dar. Es kann sich hierbei eher um einen Interaktionspartner handeln oder man wendet sich ganz allgemein an die breite Öffentlichkeit, wie es im politischen Bereich vornehmlich praktiziert wird. Die Darstellung des Selbst spielt demnach in fast jeder sozialen Situation eine Rolle und so kann praktisch jedes menschliche Verhalten immer auch unter dem Gesichtspunkt der Selbstdarstellung aufgefaßt und interpretiert werden. Die Beschreibung und Klassifikation dieser mannigfaltigen Arten menschlicher Äußerungen ist natürlich auch für die Wissenschaft von besonderem Interesse und war bisher Anlaß für eine Vielzahl von Publikationen zum Thema.
Es ist schwierig, die Komplexität menschlicher Selbstdarstellung zu beschreiben und in Worte zu fassen. Diese Arbeit möchte trotzdem den Versuch wagen, den Selbstdarstellungsprozeß als alltägliche Leistung, v.a. im politischen Bereich, in ihren Grundzügen zu umreißen. Im ersten Teil sollen die wichtigsten Begriffsklärungen vorgenommen sowie motivationale Aspekte im Konstrukt der Selbstdarstellung näher differenziert werden. Der Schwerpunkt der Arbeit befaßt sich mit den Techniken der Selbstdarstellung - hier soll ein differenziertes Bild verschiedener Darstellungsformen in ihren Grundzügen entwickelt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Selbstdarstellung
- Theoretische Einordnung und Begriffsklärung
- Politik - eine One-man-show?
- Motive der Selbstdarstellung
- Publikumorientierte Motivation
- Individuumorientierte Motivation
- Publikumserwartungen in der Politik
- Der machiavellistische Politiker
- Der authentische Politiker
- Der Politiker als Superman
- Erwartungen der SeminarteilnehmerInnen an einen Politiker
- Selbstdarstellungsverhalten
- Klassifikationen des Selbstdarstellungsverhaltens
- Offensive, defensive und assertive Selbstdarstellungsformen
- Offensive Selbstdarstellung
- Defensive Selbstdarstellung
- Leugnen
- Umdeuten: ‚Es war nicht so, sondern anders!‘
- Urheberschaft bestreiten: ‚Ich hab‘s nicht getan!‘
- Rechtfertigen: ‚Es war notwendig!‘
- Kontrollfähigkeit bestreiten: ‚Ich kann nichts dafür! Ich wollte das nicht!‘
- Etikettierung verhindern: ‚Das tue ich sonst nicht!‘
- Um Verzeihung bitten: ‚Es tut mir leid!‘
- Assertive Selbstdarstellung
- Ingratiation: ‚Ich mache mich beliebt‘.
- Self-promotion: ‚Ich stelle mich als kompetent dar‘.
- Exemplification: ‚Ich stelle mich als Vorbild dar‘.
- Intimidation: ‚Ich schüchtere andere ein‘.
- Supplication: ‚Ich stelle mich als hilfsbedürftig dar‘.
- Charakteristische Kombinationen von Sequenzen von Strategien
- Selbstdarstellung im Spannungsfeld zwischen glaubwürdigen und vorteilhaften Eindrücken
- Erwünschte Selbstdarstellung
- Vermittlung von glaubwürdigen und vorteilhaften Eindrücken
- Integrationsmodell von Laux & Schütz (1996)
- Diskussion: Die Welt als große Bühne
- Alles nur Theater? - Das Darstellungsspiel von Politikern
- Was bleibt den Wählerinnen? - Ein Trainingsprogramm
- Was ich will, das kann ich? - Motive, Formen und Kompetenzen der Selbstdarstellung
- Man ist, wofür man gilt? - Persönlichkeit und Selbstdarstellung
- Einmal defensiv, immer defensiv? - Die Frage nach der Selbstdarstellungstendenz
- Mann und Frau im ganz alltäglichen Laienspiel
- Gute Strategie - schlechte Strategie? - Bewertung der Selbstdarstellungsformen
- Schluß: Man kann sich nicht nicht darstellen!
- Anhang: ‚Leibchen für Lauftreff‘ - ein Blick auf den Wahlkampf der Grünen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Selbstdarstellung im Alltag und speziell im politischen Bereich. Sie analysiert die Motive und Techniken, die Politiker zur Eindruckslenkung einsetzen, sowie die Erwartungen, die von der Bevölkerung an ihre Vertreter gestellt werden. Die Arbeit beleuchtet das Spannungsfeld zwischen glaubwürdiger und vorteilhafter Selbstdarstellung und untersucht die Auswirkungen von geschlechtsspezifischen Rollenbildern auf das politische Verhalten.
- Motive der Selbstdarstellung: publikumorientierte und individuumorientierte Motive, Publikumserwartungen
- Formen der Selbstdarstellung: offensive, defensive und assertive Selbstdarstellungsformen
- Strategien der Selbstdarstellung: Taktiken des Einschmeichelns, der Eigenwerbung, der Vorbildfunktion, der Einschüchterung und der Hilflosigkeit
- Glaubwürdigkeit und Vorteilhaftigkeit: das Spannungsfeld der Selbstdarstellung
- Geschlechtsspezifische Rollenbilder und Selbstdarstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Arbeit beschäftigt sich mit der theoretischen Einordnung des Konzepts der Selbstdarstellung. Dabei wird der Begriff des Selbstbildes und seine Bedeutung für den Prozess der Selbstpräsentation erläutert. Außerdem wird die Bedeutung des politischen Bereichs für die Selbstdarstellung untersucht.
Im zweiten Kapitel werden die Motive der Selbstdarstellung näher betrachtet. Es wird zwischen publikumzentrierten und individuumzentrierten Motiven unterschieden und das Spannungsfeld zwischen Selbstkongruenz und Selbstidealisierung beleuchtet. Des Weiteren werden die Erwartungen des Publikums an Politiker in Form des machiavellistischen Politikers, des authentischen Politikers und des Politikers als Superman vorgestellt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Selbstdarstellungsverhalten und untersucht die verschiedenen Strategien, die zur Eindruckslenkung eingesetzt werden können. Es werden offensive, defensive und assertive Selbstdarstellungsformen beschrieben und anhand von Beispielen aus dem politischen Alltag erläutert.
Kapitel vier beleuchtet das Spannungsfeld zwischen glaubwürdigen und vorteilhaften Eindrücken, das sich in der Selbstdarstellung ergibt. Es wird das Integrationsmodell von Laux & Schütz vorgestellt, das motivationale Aspekte der Selbstdarstellung mit den Strategien der assertiven und defensiven Selbstdarstellung kombiniert.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Diskussion über die Welt als große Bühne und untersucht die Auswirkungen des Medienzeitalters auf die Selbstdarstellung von Politikern. Es werden die Bedeutung von politischen Inhalten und die Notwendigkeit von politischer Bildungsarbeit betont. Weiterhin wird die Frage nach geschlechtsspezifischen Selbstdarstellungsformen aufgeworfen und die Bedeutung von geschlechtsübergreifenden Prinzipien im Sinne eines gleichberechtigten Zusammenlebens von Mann und Frau betont.
Der Schluss der Arbeit verweist auf die Allgegenwärtigkeit von Selbstdarstellungsphänomenen und stellt offene Fragen zum Entstehen eines Persönlichkeitsbildes durch Selbstdarstellung, zu den Auswirkungen von gesellschaftlichen Strukturen auf das Selbstdarstellungsverhalten und zum Einfluss von geschlechtsspezifischen Rollenbildern.
Schlüsselwörter
Selbstdarstellung, Impression-Management, Politik, Politiker, Motiv, Strategie, Taktik, Glaubwürdigkeit, Vorteilhaftigkeit, Publikumserwartung, authentisch, machiavellistisch, Superman, Geschlecht, Rolle, Sozialisation, Androgynität, Medien, Bildung, Partizipation.
- Citar trabajo
- Ulrike Roppelt (Autor), 1998, Strategien der Selbstdarstellung von Politikern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230701