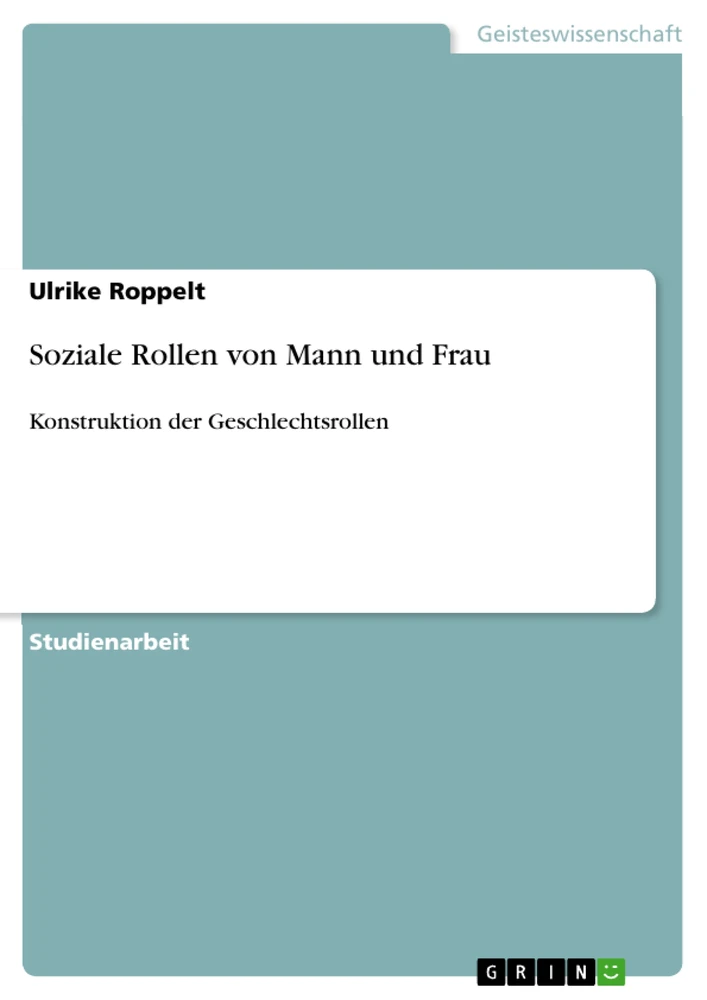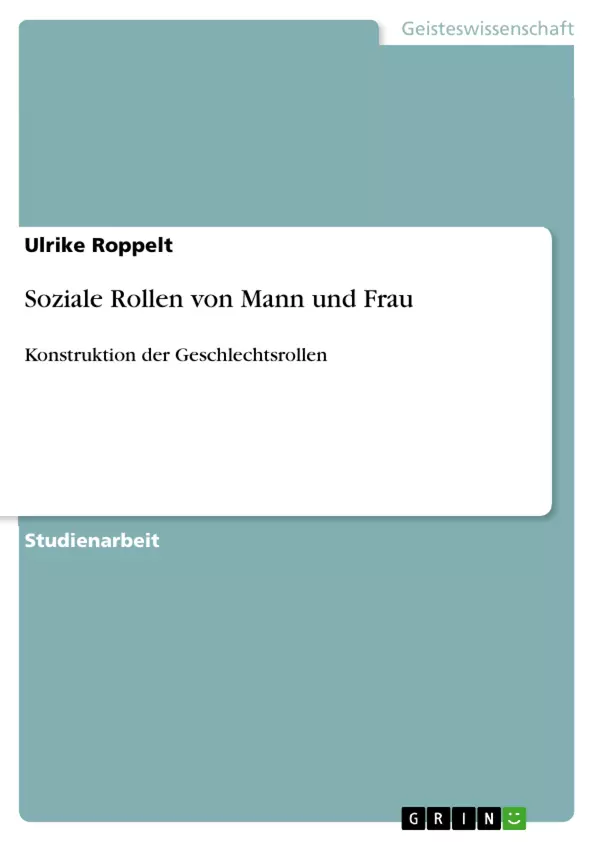'Gefesselt an sein evolutionäres Erbe, gesteuert vom Diktat der Gene und Hormone, irrt der Mensch in seinem Triebleben umher', so zeichnet DER SPIEGEL in seiner Ausgabe vom Mai 1995 provokativ das Bild eines von biologischen Zwängen in seiner Entwicklung gefangenen Menschen. Ein biologischer Fundamentalismus, der aus den Ergebnissen neuerer Genforschung erneut Nahrung zu erhalten scheint, dessen Wurzeln jedoch weiter zurückreichen.
Bereits im 18. Jahrhundert wurde ein biologistisch geprägtes Denkmodell, das bestimmte Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen von Menschen auf eine genetische Determination desselben zurückführt, im Bürgertum aufgegriffen. Damals diente es zur Generierung eines neuen bürgerlichen Familien- und Rollenverständnisses und rückte sog. 'geschlechtsspezifische Wesensmerkmale' von Mann und Frau in den Mittelpunkt des Interesses.
Die Zuweisung komplementärer Eigenschaften führte nach Hausen (1976) zu einer 'Polarisierung der Geschlechtscharaktere', die bis in die Gegenwart hinein zur Prägung geschlechtsspezifischen Rollenverhaltens führt. Gerade die Selbverständlichkeit, mit der dieses Rollenverständnis über Generationen weitergegeben wurde, macht neugierig auf seine Entstehung, Funktion und die Konsequenzen für die sich an diesem Modell orientierenden Menschen einer Gesellschaft. Diesen Fragen soll in den folgenden Ausführungen nachgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1.0. GESCHLECHT UND GESCHLECHTSROLLE
- 2.0. GRUNDLAGEN UND ENTSTEHUNGSBEDINGUNGEN VON GESCHLECHTSROLLEN
- 2.1. SOZIALE ROLLE UND SCHÖPFUNGSGEDANKE
- 2.2. SOZIALE ROLLE UND RELIGION
- Die Stellung der Frau im frühen Christentum (1. Jh. n. Chr.)
- Weiblicher Status im frühen Mittelalter (4./5. Jh.)
- Hexenverfolgung (15. bis 18. Jh.)
- 3.0. GENERIERUNG EINES SOZIALEN GESCHLECHTSROLLENKONZEPTES AB DEM 18. JH.
- 3.1. LEGITIMATIONSZWANG: ENTSTEHUNG EINES NEUEN ORIENTIERUNGSMUSTERS
- 3.2. HERAUSBILDUNG EINES BÜRGERLICHEN IDEALS FÜR MANN UND FRAU
- 3.3. MANN UND FRAU ALS GEGENPOLE
- 3.4. SPEZIFISCHE WESENSZUSCHREIBUNGEN IM NEUEN GESCHLECHTERVERHÄLTNIS
- 3.5. KONSTRUKTION DER SEXUELLEN GESCHLECHTSROLLE
- 3.6. 'BEM-SEX-ROLE-INVENTORY'
- 4.0. REPRODUKTION VON GESCHLECHTSROLLEN
- 4.1. GESCHLECHTSSPEZIFISCHE ERZIEHUNG
- 4.2. AUSGRENZUNG DER FRAU VON BILDUNG UND WISSENSCHAFT
- 5.0. GEGENENTWICKLUNGEN - ORGANISIERTE FRAUENBEWEGUNG IN DEUTSCHLAND
- 5.1. DER BEGINN DES FEMINISMUS IN EUROPA
- 5.2. FRAUENBEWEGUNG IN DEUTSCHLAND
- 5.2.1. DIE BÜRGERLICHE FRAUENBEWEGUNG
- 5.2.2. DIE PROLETARISCHE FRAUENBEWEGUNG
- 5.2.3. RÜCKSCHRITT UND WIEDERBEGINN
- 5.2.4. DIE 'NEUE' FRAUENBEWEGUNG
- 5.2.5. MÄNNER IN BEWEGUNG?
- 6.0. SOZIALE ROLLEN VON MANN UND FRAU: EINE KRITISCHE BETRACHTUNG
- 6.1. KONSTRUKTIVE ASPEKTE
- 6.2. DESTRUKTIVE ASPEKTE
- Festlegung der Persönlichkeit via Geschlecht
- Das schwache Geschlecht: Bewertung der weiblichen Geschlechtsrolle
- Das starke Geschlecht: Die Bürde der männlichen Geschlechtsrolle
- Geschlechtsspezifische Erziehung und Bildung
- Sexismus und doppelte Moral
- Soziale Geschlechtsrolle und Identitätsverwirrungen
- 7.0. AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die sozialen Rollen von Mann und Frau und beleuchtet deren Entstehung und Entwicklung im Laufe der Geschichte, insbesondere in der westlichen Zivilisation. Dabei werden die prägenden Einflüsse von Schöpfungsgedanken, Religion und den sozialen Veränderungen im Bürgertum des 18. Jahrhunderts beleuchtet. Der Text analysiert, wie gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen die Geschlechterrollen prägten und konkrete Auswirkungen auf die Erziehung, Bildung und den gesellschaftlichen Status von Frauen und Männern hatten.
- Die Konstruktion und Reproduktion von Geschlechterrollen
- Die Rolle von Religion und Schöpfungsmythen
- Die Auswirkungen des Bürgertums im 18. Jahrhundert
- Die Entwicklung der Frauenbewegung in Deutschland
- Kritik an den konstruktiven und destruktiven Aspekten von Geschlechterrollen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der Text eröffnet mit einer provokanten Darstellung eines von biologischen Zwängen gesteuerten Menschen, die auf den Einfluss von Genforschung und biologistisch geprägtem Denken verweist.
Kapitel 1.0: Geschlecht und Geschlechtsrolle: Dieses Kapitel definiert den Begriff 'Rolle' und erläutert, wie Mädchen und Jungen bereits früh lernen, sich mit ihrem Geschlecht zu identifizieren und entsprechende Verhaltensmuster entwickeln.
Kapitel 2.0: Grundlagen und Entstehungsbedingungen von Geschlechtsrollen: Der Fokus liegt auf der Prägung von Sexualität und Geschlechterrollen durch gesellschaftliche Normen und Werte.
Kapitel 2.1: Soziale Rolle und Schöpfungsgedanke: Hier werden verschiedene Ansichten zur Rolle von Mann und Frau in der Fortpflanzung beleuchtet, insbesondere die Vorstellungen des 'Schöpfers' (Mann) und des 'Gefäßes' (Frau).
Kapitel 2.2: Soziale Rolle und Religion: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Religion auf die Definition von Sexualität und Geschlechtsrollen, insbesondere im frühen Christentum und im Mittelalter.
Kapitel 3.0: Generierung eines sozialen Geschlechtsrollenkonzeptes ab dem 18. Jh.: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung eines neuen bürgerlichen Familien- und Rollenverständnisses im 18. Jahrhundert.
Kapitel 3.1: Legitimationszwang: Entstehung eines neuen Orientierungs�musters: Der Text beleuchtet die Entwicklung des Begriffs 'Geschlechtscharaktere' und die Suche nach einer Legitimation für die männliche Herrschaft.
Kapitel 3.2: Herausbildung eines bürgerlichen Ideals für Mann und Frau: Hier werden gesellschaftliche Vorstellungen über das Wesen von Mann und Frau aus der damaligen Zeit durch Lexikonauszüge verdeutlicht.
Kapitel 3.3: Mann und Frau als Gegenpole: Dieses Kapitel beschreibt die Polarisierung von Geschlechtscharakteren in 'männliche' und 'weibliche' Merkmale.
Kapitel 3.4: Spezifische Wesenszuschreibungen im neuen Geschlechter�verhältnis: Der Text analysiert die Zuweisung spezifischer Eigenschaften an Mann und Frau und die damit verbundene Festlegung der Rolle der Frau in Ehe und Familie.
Kapitel 3.5: Konstruktion der sexuellen Geschlechtsrolle: Dieses Kapitel beschreibt die Veränderung der Sichtweise auf die weibliche Sexualität in der bürgerlichen Gesellschaft.
Kapitel 3.6: 'Bem-Sex-Role-Inventory': Hier wird ein Test aus den 70er Jahren beschrieben, der zeitgenössische geschlechtsspezifische Zuschreibungen untersuchte.
Kapitel 4.0: Reproduktion von Geschlechtsrollen: Der Text beleuchtet die frühe Sozialisation von Kindern und die Vermittlung von geschlechtsspezifischen Verhaltensmustern.
Kapitel 4.1: Geschlechtsspezifische Erziehung: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Erziehung bei der Vermittlung von sozialen Geschlechtsrollen.
Kapitel 4.2: Ausgrenzung der Frau von Bildung und Wissenschaft: Der Text beschreibt die historische Ausgrenzung von Frauen von Bildung und Wissenschaft.
Kapitel 5.0: Gegenentwicklungen - organisierte Frauenbewegung in Deutschland: Der Text gibt einen Überblick über die Entwicklung der Frauenbewegung in Deutschland.
Kapitel 5.1: Der Beginn des Feminismus in Europa: Dieses Kapitel beleuchtet die Anfänge des Feminismus in Europa.
Kapitel 5.2: Frauenbewegung in Deutschland: Hier werden die verschiedenen Richtungen der Frauenbewegung in Deutschland beschrieben.
Kapitel 6.0: Soziale Rollen von Mann und Frau: Eine kritische Betrachtung: Der Text analysiert sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte von sozialen Geschlechterrollen.
Kapitel 7.0: Ausblick: Dieses Kapitel schließt mit einem Ausblick auf die Zukunft der Geschlechterrollen und fordert eine geschlechtsübergreifende Denkweise.
Schlüsselwörter
Der Text beschäftigt sich mit den Themen Geschlechterrollen, Sozialisation, Geschlechtsspezifische Erziehung, Frauenbewegung, Feminismus, Patriarchat, Sexismus, Doppelte Moral, Identität, Androgynität, Gleichberechtigung und Gleichstellung.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstanden die modernen Geschlechterrollen im 18. Jahrhundert?
Im Bürgertum des 18. Jahrhunderts entwickelte sich ein biologistisches Denkmodell, das Charaktereigenschaften als genetisch determiniert ansah, um ein neues bürgerliches Familien- und Rollenverständnis zu legitimieren.
Welchen Einfluss hatte die Religion auf die Rollenverteilung?
Der Text beleuchtet die Stellung der Frau im frühen Christentum und Mittelalter sowie die Hexenverfolgungen als Mittel zur Festigung patriarchaler Strukturen und zur Definition von "weiblichem Status".
Was bedeutet "Polarisierung der Geschlechtscharaktere"?
Es beschreibt die Zuweisung gegensätzlicher, komplementärer Eigenschaften an Mann und Frau (z.B. Vernunft vs. Emotion), die zur Verfestigung geschlechtsspezifischen Rollenverhaltens führte.
Welche Phasen der Frauenbewegung in Deutschland werden unterschieden?
Die Arbeit analysiert die bürgerliche und die proletarische Frauenbewegung sowie die "neue" Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts.
Was ist das 'Bem-Sex-Role-Inventory'?
Es handelt sich um ein psychologisches Instrument zur Messung von Maskulinität und Femininität, das in der Arbeit zur Analyse von Geschlechtsrollenzuschreibungen herangezogen wird.
Welche destruktiven Aspekte von Rollenbildern werden kritisiert?
Kritisiert werden die Festlegung der Persönlichkeit via Geschlecht, Sexismus, die "Bürde" der männlichen Rolle sowie die historische Ausgrenzung von Frauen von Bildung und Wissenschaft.
- Citar trabajo
- Ulrike Roppelt (Autor), 1997, Soziale Rollen von Mann und Frau, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230705