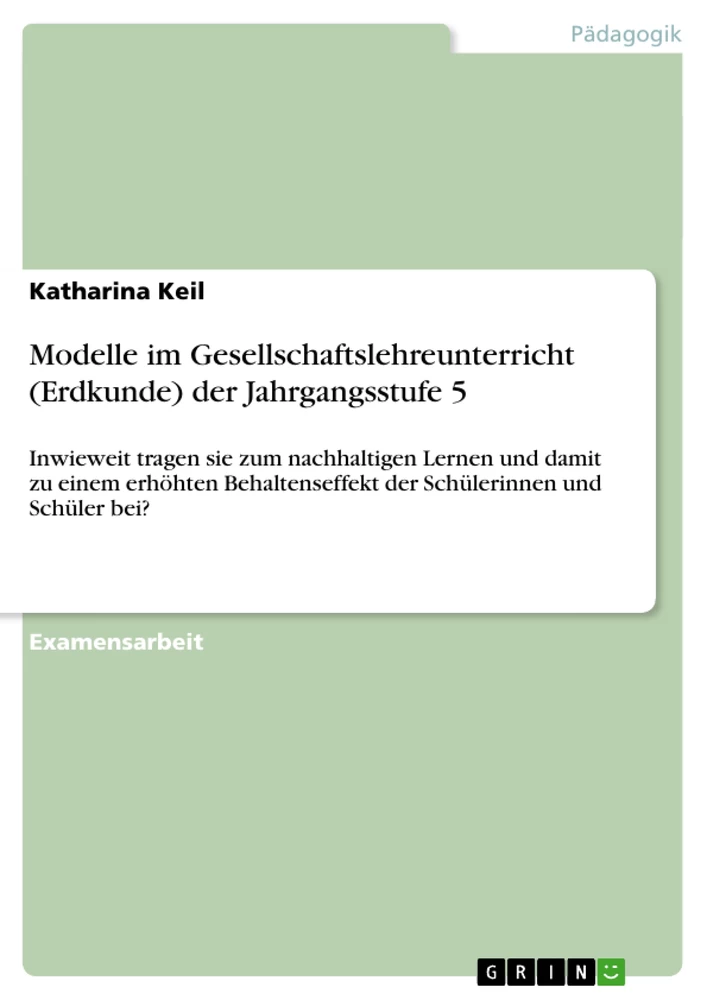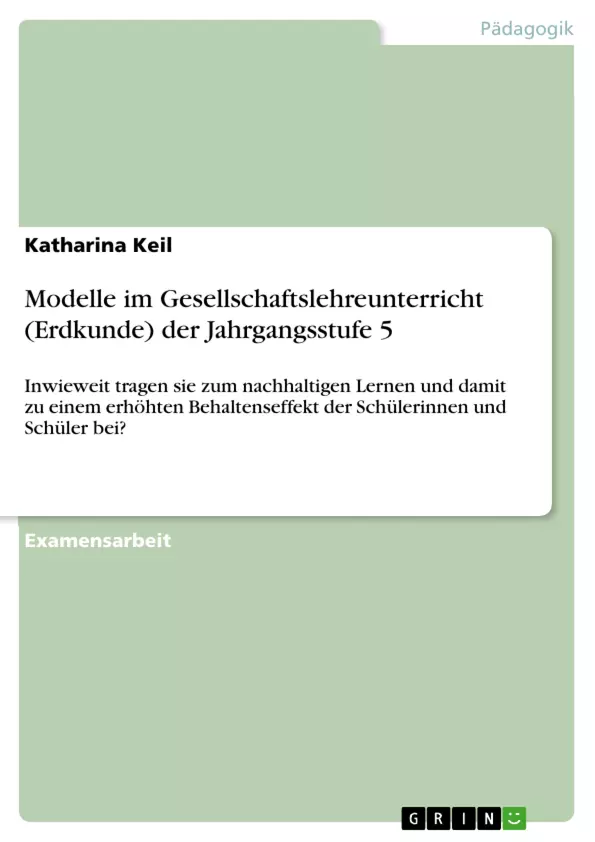Inhaltsverzeichnis
Seite
1. Einleitung 1
2. Theoretischer Hintergrund 2 2.1 Modelle 2
2.1.1 Definition 2
2.1.2 Modelle vs. originale Gegenstände 3
2.1.3 Klassifikation von Modellen 3
2.1.4 Gründe für den Mangel an Modellen im Unterricht 6
2.1.5 Gründe für die Arbeit an Modellen im Unterricht 7
2.1.6 Der didaktische Ort von Modellen 9
2.2 Lernen und Behalten 10
2.2.1 Lernen und Informationsverarbeitung 10
2.2.2 Stadien der kognitiven Entwicklung nach Piaget 11
2.2.3 Nachhaltiges Lernen 11
3. Analyse der Lerngruppen 13
3.1 Begründung der Auswahl der Klassen 13
3.1.1 Klasse 5/2 (Modellbauklasse) 13
3.1.2 Klasse 5/3 (Klasse mit Anschauungsmodellen) 14
3.1.3 Klasse 5/4 (Klasse ohne Modelleinsatz) 15
4. Planung und Umsetzung der Unterrichtseinheit 15
4.1 Planung 15
4.2 Überblick über die Unterrichtseinheit 16
4.3 Evaluationselemente 17
4.4 Lehrplan- und Kompetenzorientierung 18
4.5 Didaktisch-methodische Überlegungen 19
4.6 Ausführliche Darstellung der Unterrichtssequenz zu den Höhenstufen 23
4.6.1 Höhenstufen der Alpen 23
4.6.2 Planung des Modellbaus 24
4.6.3 Modellbautag 24
4.6.4 Almwirtschaft (Ergänzung des Modells) 26
5. Evaluation 27
6. Reflexion 30
7. Ausblick 33
8. Literaturverzeichnis 34
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Modelle
- 2.1.1 Definition
- 2.1.2 Modelle vs. originale Gegenstände
- 2.1.3 Klassifikation von Modellen
- 2.2 Lernen und Behalten
- 3. Analyse der Lerngruppen
- 4. Planung und Umsetzung der Unterrichtseinheit
- 4.1 Planung
- 4.2 Überblick über die Unterrichtseinheit
- 4.3 Evaluationselemente
- 4.4 Lehrplan- und Kompetenzorientierung
- 4.5 Didaktisch-methodische Überlegungen
- 4.6 Ausführliche Darstellung der Unterrichtssequenz zu den Höhenstufen
- 5. Evaluation
- 6. Reflexion
- 7. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Modellbaus im Geographie-Unterricht auf das nachhaltige Behalten von Lerninhalten. Im Fokus steht der Vergleich dreier Lerngruppen: eine Gruppe, die selbst Modelle baut, eine Gruppe, die mit vorgefertigten Modellen arbeitet, und eine Kontrollgruppe ohne Modelleinsatz. Die Studie möchte herausfinden, ob der Einsatz von Modellen, insbesondere bei Themen mit geringem Lebensweltbezug, die Motivation und den Lernerfolg steigert.
- Der Einfluss von Modellen auf den Lernerfolg
- Vergleich verschiedener Arten des Modell-Einsatzes im Unterricht
- Nachhaltiges Lernen und Behalten von geographischen Inhalten
- Didaktische Überlegungen zum Einsatz von Modellen
- Evaluation verschiedener Lernmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation, die den Anstoß für die vorliegende Arbeit gab: Der Einsatz eines Anschauungsmodells im Geographie-Unterricht einer zehnten Klasse zum Thema "Deutschland: Besetzt, geteilt, vereint". Die positive Resonanz der Schüler auf das Modell und die guten Ergebnisse in der anschließenden Klassenarbeit führten zu der Forschungsfrage, ob der selbstständige Bau von Modellen den Lernerfolg weiter verbessern könnte. Die fehlende empirische Forschung zu diesem Thema motivierte die Autorin zur Durchführung der vorliegenden Untersuchung an drei fünften Klassen.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet den theoretischen Rahmen der Arbeit. Es beginnt mit einer Diskussion um die Definition des Begriffs "Modell", wobei verschiedene Definitionen und Klassifizierungen von Autoren wie Birkenhauer und Claaßen vorgestellt und verglichen werden. Der Unterschied zwischen konkreten und theoretischen Modellen wird herausgearbeitet und die Bedeutung der Dreidimensionalität und der didaktischen Reduktion von Modellen wird diskutiert. Der zweite Teil des Kapitels befasst sich mit Theorien zum Lernen und Behalten, um den Zusammenhang zwischen Modell-Einsatz und nachhaltigem Lernerfolg zu beleuchten.
3. Analyse der Lerngruppen: Dieses Kapitel beschreibt die drei ausgewählten Lerngruppen (eine Modellbauklasse, eine Klasse mit Anschauungsmodellen und eine Kontrollgruppe ohne Modelle). Es wird die Begründung für die Auswahl der Klassen dargelegt, wobei die bereits bestehende Vertrautheit der Autorin mit der Modellbauklasse und die parallelen Klassen als Referenzgruppen hervorgehoben werden. Die Unterschiede im Umgang mit Modellen in den jeweiligen Klassen werden erläutert, um die Grundlage für den Vergleich der Lernergebnisse zu schaffen.
4. Planung und Umsetzung der Unterrichtseinheit: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Planung und Umsetzung der Unterrichtseinheit, die mit der Modellbauklasse (5/2) durchgeführt wurde. Es wird ein Überblick über die gesamte Einheit gegeben, inklusive der Evaluationselemente, der Lehrplan- und Kompetenzorientierung und der didaktisch-methodischen Überlegungen. Der Schwerpunkt liegt auf der ausführlichen Darstellung der Unterrichtssequenz zu den Höhenstufen, welche exemplarisch den Prozess des Modellbaus, von der Planung bis zur Ergänzung, illustriert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss des Modellbaus im Geographie-Unterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Modellbaus im Geographie-Unterricht auf das nachhaltige Behalten von Lerninhalten. Im Fokus steht der Vergleich dreier Lerngruppen: eine Gruppe, die selbst Modelle baut, eine Gruppe, die mit vorgefertigten Modellen arbeitet, und eine Kontrollgruppe ohne Modelleinsatz. Die Studie zielt darauf ab, herauszufinden, ob der Einsatz von Modellen, insbesondere bei Themen mit geringem Lebensweltbezug, die Motivation und den Lernerfolg steigert.
Welche Lerngruppen wurden untersucht?
Es wurden drei fünfte Klassen untersucht: eine Klasse, die selbst Modelle gebaut hat, eine Klasse, die mit vorgefertigten Modellen gearbeitet hat, und eine Kontrollgruppe ohne Modelleinsatz. Die Auswahl der Klassen beruhte auf der bestehenden Vertrautheit der Autorin mit der Modellbauklasse und der Verwendung paralleler Klassen als Referenzgruppen.
Welche Themen werden im theoretischen Hintergrund behandelt?
Der theoretische Hintergrund umfasst eine Diskussion über die Definition von "Modell", verschiedene Klassifizierungen von Modellen, den Unterschied zwischen konkreten und theoretischen Modellen sowie die Bedeutung der Dreidimensionalität und didaktischen Reduktion von Modellen. Zusätzlich werden Theorien zum Lernen und Behalten behandelt, um den Zusammenhang zwischen Modell-Einsatz und nachhaltigem Lernerfolg zu beleuchten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Theoretischer Hintergrund (mit Unterkapiteln zu Modellen und Lernen/Behalten), Analyse der Lerngruppen, Planung und Umsetzung der Unterrichtseinheit (mit detaillierter Beschreibung der Unterrichtssequenz), Evaluation, Reflexion und Ausblick. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselbegriffe.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Planung und Umsetzung der Unterrichtseinheit?
Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Planung und Umsetzung der Unterrichtseinheit in der Modellbauklasse (5/2). Es umfasst einen Überblick über die gesamte Einheit, Evaluationselemente, Lehrplan- und Kompetenzorientierung, didaktisch-methodische Überlegungen und eine ausführliche Darstellung der Unterrichtssequenz zu den Höhenstufen (exemplarisch für den Modellbauprozess).
Welche Forschungsfrage wird untersucht?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob der selbstständige Bau von Modellen den Lernerfolg im Geographie-Unterricht, insbesondere bei Themen mit geringem Lebensweltbezug, im Vergleich zum Einsatz vorgefertigter Modelle oder gar keinem Modelleinsatz verbessert.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Es werden Zusammenfassungen für die Kapitel Einleitung, Theoretischer Hintergrund, Analyse der Lerngruppen und Planung und Umsetzung der Unterrichtseinheit bereitgestellt. Die Zusammenfassungen geben einen Überblick über den Inhalt der jeweiligen Kapitel.
- Citation du texte
- Katharina Keil (Auteur), 2012, Modelle im Gesellschaftslehreunterricht (Erdkunde) der Jahrgangsstufe 5, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230740