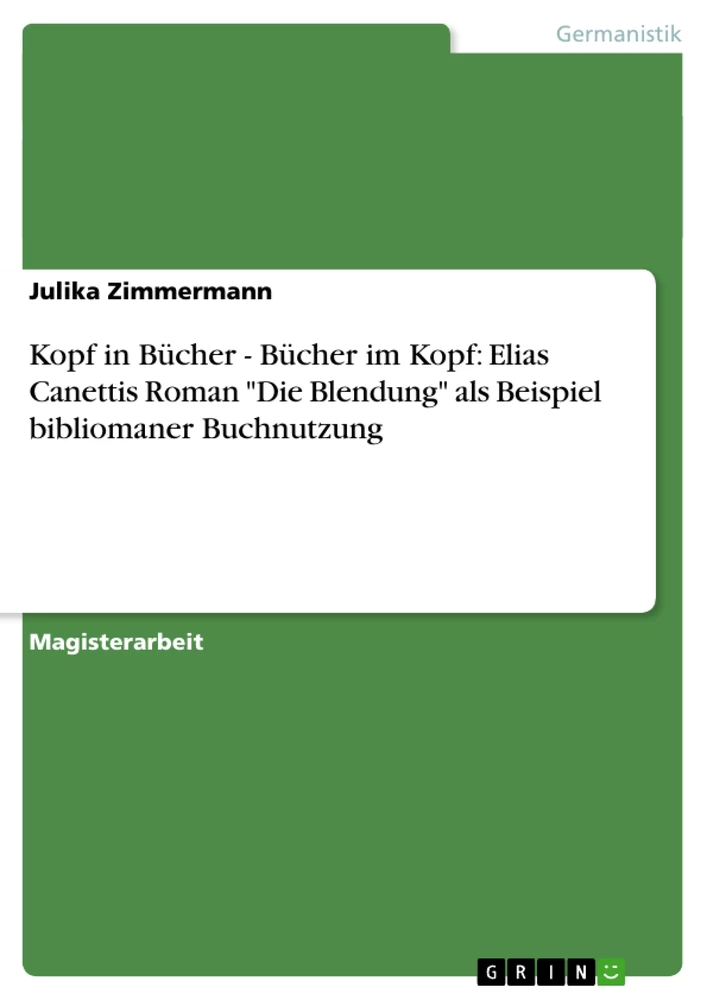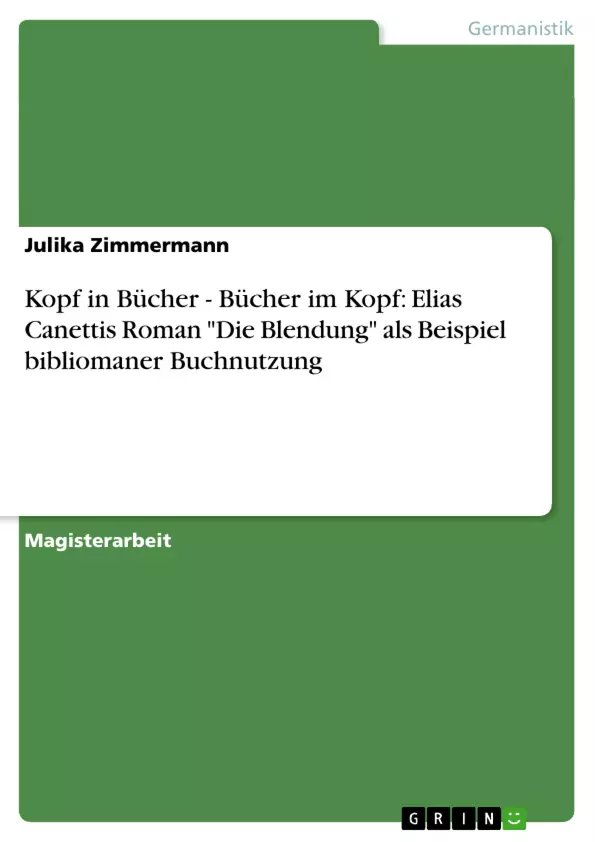"Er verbrannte alle seine Bücher und zog sich als Eremit in eine öffentliche Bibliothek zurück."
(Canetti 1973, S. 122.)
Bei diesem Zitat stellt sich die Frage: Warum verbrennt er die Bücher? Geht eine Gefahr von ihnen aus? Unfraglich ist, dass Bücher mächtig sind. Einerseits wurde schon seit Beginn der Schrift das Geschriebene als Mittel der Erlangung und Bewahrung von Macht benutzt, so dass Macht und Wissen, das durch die Schrift, später durch Bücher erworben und bestätigt wird, eine enge Verbindung eingehen. Schon im alten Ägypten hatte das Buch sakralen Charakter, und die Ägypter verehrten den Schriftgott Thot. Später, im Christentum, wurde das Buch in vielen Büchern als etwas Heiliges dargestellt. Andererseits aber können die Bücher auch aufgrund der ihnen innewohnenden Macht zu einer Gefahr für das Individuum werden.
Mit diesem letzten Aspekt beschäftigt sich die vorliegende Arbeit. Sie setzt sich mit dem Phänomen der innerliterarischen Bibliomanie auseinander. Die lesenden Helden gebrauchen das Buch als Schutz vor der Wirklichkeit, die nicht die gewünschte Gestalt hat und kompensieren durch das Buch eine in der realen Welt erlebte Mangelerfahrung. Das Buch wird als Medium, als zentrale Instanz, zwischen den Rezipienten und die Welt gestellt. Die Wahrnehmung der Welt erfolgt ausschließlich über das Buch, so dass das Buch letztendlich die Welt selbst ist und die Wirklichkeit im Gegenzug ignoriert wird. Die neu entstandenen Welten im Kopf sind demnach gelesene, fiktive Welten, die vom Protagonisten als reale empfunden werden.
Ein allen analysierten Beispielen immanenter Aspekt ist die Maßlosigkeit der konsumierten Büchermenge, die erst für den bibliomanen Wahn ausschlaggebend ist. So können die ausgewählten Beispiele Fälle darstellen, in denen sich der Leser gegenüber dem Buch nicht angemessen oder maßvoll verhält. Auch können sie die Konsequenzen einer direkten Referentialisierung der Literatur auf die alltägliche Welt aufzeigen. Nichtsdestotrotz soll die Arbeit keine Warnung vor dem Buch sein. Vielmehr handelt es sich um eine Thematisierung der innerliterarischen Bibliomanie und ein Aufzeigen der möglichen Reaktionen auf eine pathologische Literarisierung der Wirklichkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formen der Buchnutzung in der Literatur
- Buch und Bibliotheken
- Bibliophilie
- Bibliomanie
- Analyse von Vergleichsbeispielen
- Der Bücherbrand: Miguel de Cervantes' Don Quijote
- Eskapistische Lektüre: Karl Philipp Moritz Anton Reiser
- Die universale Bibliothek: Jorge Luis Borges' Die Bibliothek von Babel
- Anthropomorphisierung: Ray Bradburys Fahrenheit 451
- Elias Canettis Roman Die Blendung
- Kopf in Bücher
- Bücher als universale Erklärung der Welt
- Leser und Nicht-Leser
- Nicht-rettende Bücher als entfesselte Macht
- Bücher im Kopf
- Pathographie
- Bibliothek, Kopfbibliothek, Universalbibliothek und Bibliotheksbrand
- Bücher und Melancholie
- Bücher und Welt
- Bücher als Religion
- Der Bibliomane und die Künste
- Bücher und Blendung
- Kopf in Bücher
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der innerliterarischen Bibliomanie, wobei der Fokus auf der exzessiven Buchnutzung durch literarische Figuren liegt. Es wird analysiert, wie diese Figuren das Buch als Schutz vor der Realität verwenden und ihre Welt durch die Lektüre neu konstruieren.
- Die Rolle des Buches als Schutzmechanismus vor der Realität
- Die Konstruktion einer fiktiven Welt durch die Lektüre
- Die Auswirkungen exzessiver Buchnutzung auf die Wahrnehmung der Welt
- Die Beziehung zwischen Bibliomanie und pathologischem Verhalten
- Die kulturelle Dimension der Buchnutzung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Formen der Buchnutzung in der Literatur, die Buch und Bibliotheken, Bibliophilie und Bibliomanie umfasst. Anschließend werden anhand von Vergleichsbeispielen, wie Don Quijote, Anton Reiser, Die Bibliothek von Babel und Fahrenheit 451, verschiedene Aspekte der Bibliomanie beleuchtet.
Der Hauptteil der Arbeit befasst sich mit Elias Canettis Roman Die Blendung. In dem Kapitel "Kopf in Bücher" wird das Wechselverhältnis zwischen Kien und seinen Büchern untersucht, insbesondere deren Rolle als "universale Erklärung der Welt". Des Weiteren wird die Reaktion der Bücher auf ihre Anthropomorphisierung durch Kien betrachtet.
Das Kapitel "Bücher im Kopf" analysiert die Pathographie Kiens und beschreibt seine Bibliothek und seine "Kopfbibliothek", die beide Eigenschaften einer Universalbibliothek besitzen. Schließlich wird der Bibliotheksbrand behandelt, der den Höhepunkt der Geschichte darstellt.
Das Kapitel "Bücher und Welt" untersucht, wie Bücher in Kiens Welt zur Religion werden und sein Verhältnis zu den Künsten prägen. Schließlich wird die "Blendung" thematisiert, die durch die exzessive Buchnutzung entsteht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen innerliterarische Bibliomanie, Buchnutzung, pathologische Lektüre, Konstruktion der Wirklichkeit, Anthropomorphisierung von Büchern, Universalbibliothek, Melancholie, Blendung, Elias Canetti, Die Blendung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Bibliomanie?
Bibliomanie bezeichnet eine krankhafte Leidenschaft für Bücher, bei der das Sammeln und Lesen zum Wahn wird und die Realität zunehmend durch fiktive Welten ersetzt wird.
Worum geht es in Elias Canettis Roman „Die Blendung“?
Der Roman beschreibt den Untergang des Sinologen Peter Kien, der in seiner riesigen Privatbibliothek lebt, den Kontakt zur Außenwelt verliert und schließlich im Wahnsinn endet.
Wie nutzt Peter Kien seine Bücher?
Er nutzt sie als Schutzwall gegen die Wirklichkeit. Für ihn sind Bücher die einzige wahre Welt; Menschen, die nicht lesen, verachtet er als minderwertig.
Was symbolisiert der Bibliotheksbrand am Ende?
Der Brand symbolisiert die totale Selbstauslöschung. Da Kiens Identität untrennbar mit seinen Büchern verknüpft ist, bedeutet deren Zerstörung auch sein eigenes Ende.
Was ist eine „Kopfbibliothek“?
Kien besitzt die Fähigkeit, seine gesamte Bibliothek im Kopf abzurufen. Dies zeigt seine extreme Abkehr von der physischen Realität hin zu einer rein geistigen, aber isolierten Existenz.
- Quote paper
- Julika Zimmermann (Author), 2004, Kopf in Bücher - Bücher im Kopf: Elias Canettis Roman "Die Blendung" als Beispiel bibliomaner Buchnutzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23075