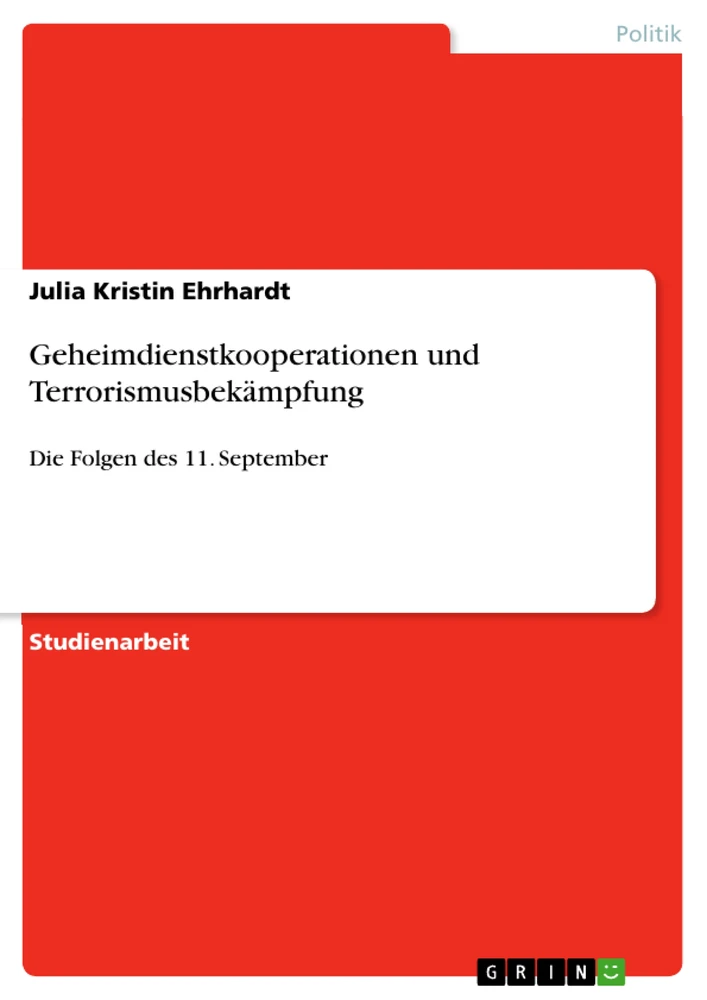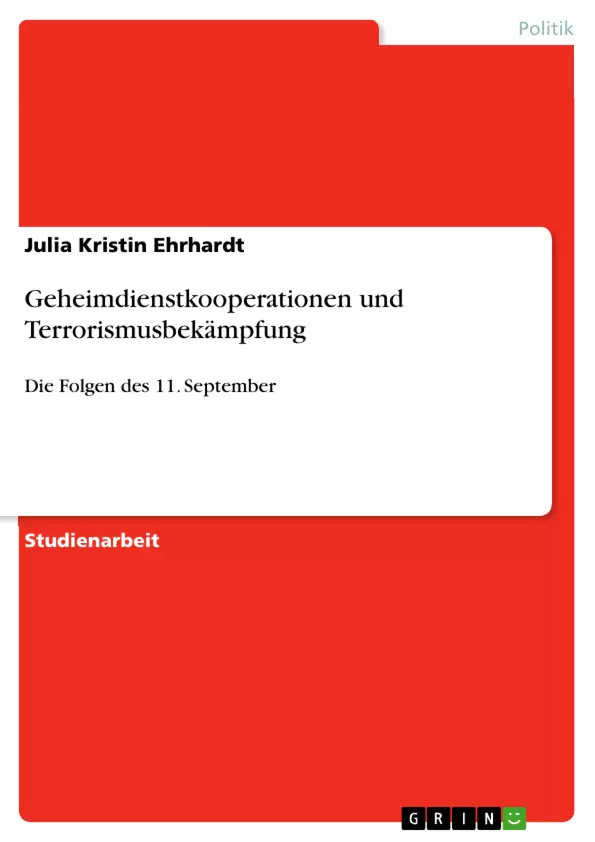Der religiös motivierte Terrorismus macht heute einen Großteil des weltweiten Terrorismus aus. Vor dem Hintergrund des Ende der 80er Jahre überwundenen Kalten Krieges, dem folgenden Zusammenbruch der Sowjetunion und der damit eng verbundenen Diskreditierung der kommunistischen Ideologie in vielen Teilen der Welt verwundert dies kaum. Internationale terroristische Anschläge werden heute nicht mehr vornehmlich von ethno-nationalistischen/separatistischen Organisationen, sondern im Namen aller Weltreligionen und allzu oft im Namen des Islam verübt. (...) Durch das Wesen des islamistischen Terrorismus, dessen Netzwerke und Planungen im Verborgenen stattfinden, nehmen Geheimdienste und nicht zuletzt internationale Geheimdienstkooperationen eine sehr bedeutende Rolle in der Terrorismusbekämpfung ein. Hieraus ergeben sich einige zentrale Fragen, mit denen sich diese Arbeit befasst: Was kennzeichnet diese Intelligene-Kooperationen heute? Haben sich diese nach dem 11. September in der Zahl und der Intensität verändert? Warum kooperieren Geheimdienste unterschiedlichster Staaten miteinander, wenn es um Terrorismusbekämpfung geht? Diese Arbeit soll einen Beitrag zum Verständnis der Intelligence-Kooperationen in der Terrorismusbekämpfung leisten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Folgen des 11. September auf Intelligence-Kooperationen im Kampf gegen den Terrorismus
- Kooperationen vor dem 11. September
- Multilaterale Kooperationen
- Plurilaterale Kooperationen
- Bilaterale Kooperationen
- Alte und neue Kooperationen nach dem 11. September
- Wandel der bereits existierenden Kooperationen nach dem 11. September
- Neue Kooperationen nach dem 11. September
- Gründe für diese Entwicklung
- Gleiche oder ähnliche Interessen
- Struktur der islamistischen Terrororganisationen
- Unterschiedliche Stärken
- Umgehen von Hindernissen
- Kooperationen vor dem 11. September
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Terroranschläge vom 11. September 2001 auf die Zusammenarbeit von Geheimdiensten im Kampf gegen den Terrorismus. Im Fokus steht die Frage, inwiefern sich die Intelligence-Kooperationen in ihrer Zahl und Intensität verändert haben und welche Gründe für diese Entwicklung ausschlaggebend sind.
- Wandel der Geheimdienstkooperationen nach dem 11. September
- Gründe für verstärkte Zusammenarbeit
- Rolle der USA in der internationalen Terrorismusbekämpfung
- Herausforderungen der Intelligence-Kooperation
- Asymmetrische Natur des Kampfes gegen den Terrorismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert den Hintergrund des islamistischen Terrorismus und die Bedeutung des 11. September 2001 für die internationale Sicherheitspolitik. Sie verdeutlicht den Wandel im Terrorismus, der seit den 80er Jahren von ethno-nationalistischen/separatistischen Organisationen hin zu islamistischen Organisationen stattfindet. Die Einleitung stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor und gibt einen Überblick über den Inhalt der folgenden Kapitel.
Das zweite Kapitel analysiert die Auswirkungen des 11. September auf die Intelligence-Kooperationen im Kampf gegen den Terrorismus. Es beleuchtet die Kooperationen vor dem 11. September und stellt die Veränderungen nach den Anschlägen dar. Der Fokus liegt dabei auf der Entstehung neuer Kooperationen sowie dem Wandel bereits bestehender Beziehungen. Die Kapitel erörtert zudem die Gründe für diese Entwicklung, wobei die Rolle der USA und der Struktur der islamistischen Terrororganisationen besonders hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Intelligence-Kooperation, Terrorismusbekämpfung, 11. September, Islamistischer Terrorismus, Geheimdienst, USA, al-Qaida, asymmetrischer Krieg, multilaterale Kooperationen, bilaterale Kooperationen, Wandel, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie haben sich Geheimdienstkooperationen nach dem 11. September verändert?
Nach den Anschlägen nahmen sowohl die Zahl als auch die Intensität der internationalen Kooperationen deutlich zu, wobei neue Netzwerke entstanden und bestehende vertieft wurden.
Warum kooperieren Staaten im Bereich der Terrorismusbekämpfung?
Gründe sind unter anderem die asymmetrische Struktur terroristischer Netzwerke, geteilte Sicherheitsinteressen, die Nutzung unterschiedlicher Stärken der Partner und das Umgehen nationaler Hindernisse.
Welche Rolle spielt der islamistische Terrorismus in der Arbeit?
Er wird als Hauptmotivator für moderne Intelligence-Kooperationen analysiert, da seine globalen, im Verborgenen agierenden Netzwerke nur durch internationale Zusammenarbeit effektiv bekämpft werden können.
Was sind multilaterale und bilaterale Kooperationen?
Bilaterale Kooperationen finden zwischen zwei Staaten statt, während multilaterale (viele Partner) oder plurilaterale (ausgewählte Gruppen) Bündnisse eine breitere internationale Basis haben.
Welche Bedeutung haben die USA in diesem Kontext?
Die USA fungieren oft als zentraler Akteur und treibende Kraft in der internationalen Terrorismusbekämpfung und prägen maßgeblich die Standards der Geheimdienstzusammenarbeit.
- Quote paper
- Diplom-Volkswirtin Julia Kristin Ehrhardt (Author), 2006, Geheimdienstkooperationen und Terrorismusbekämpfung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230877