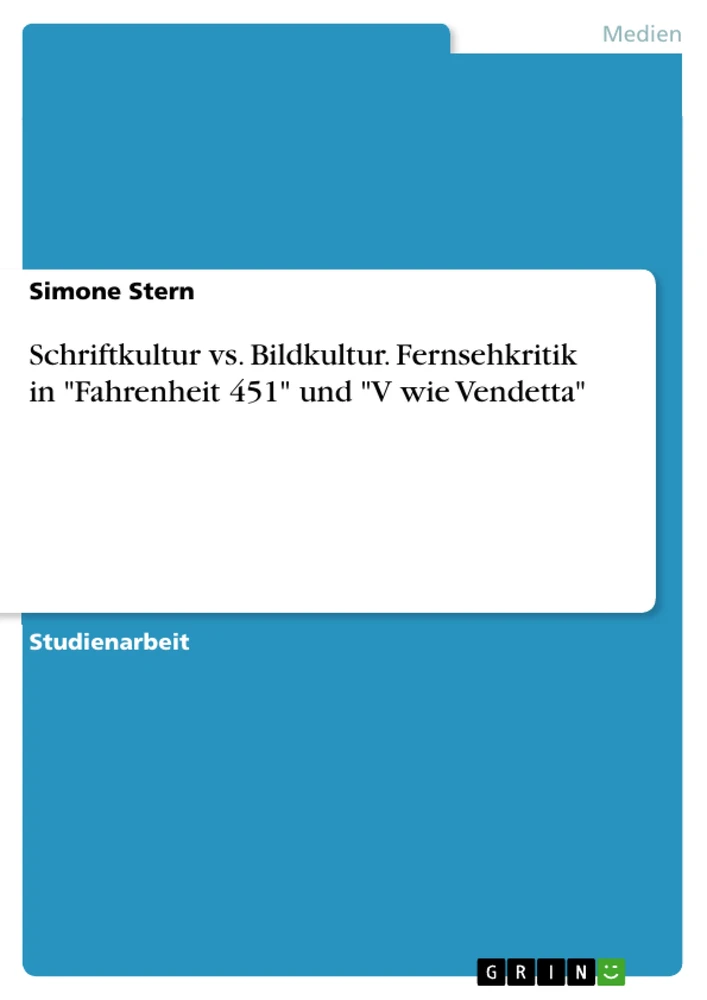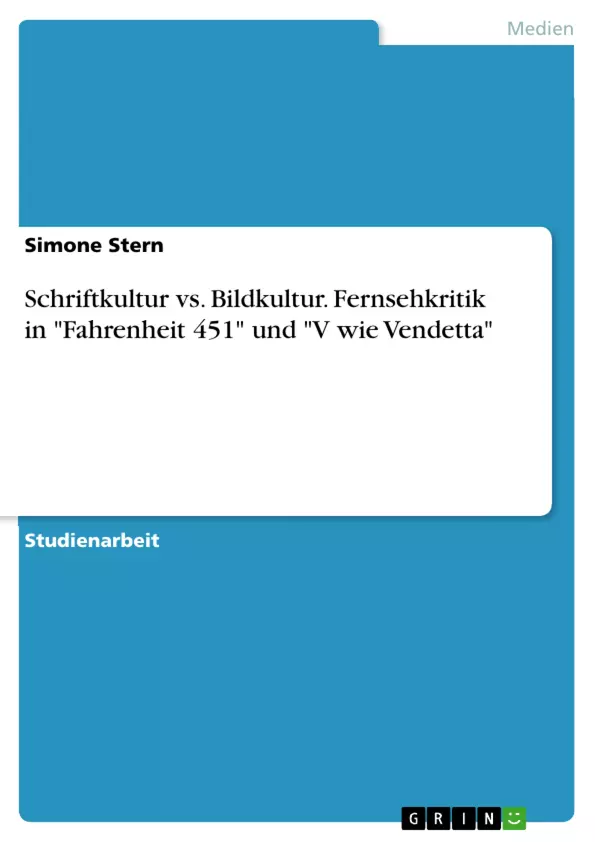„Problematisch am Fernsehen ist nicht, dass es uns unterhaltsame Themen präsentiert, problematisch ist, dass es jedes Thema als Unterhaltung präsentiert“ (Postman 1988: 110).
Mit diesem, für sein Buch „Wir amüsieren uns zu Tode“ beispielhaften Zitat, übt Neil Postman 1985 an den Inhalten eines Mediums Kritik, das zu dieser Zeit bereits seit über zwei Jahrzehnten das Alltags-, Familien- und Sozialleben der Menschen dominierte. Er beschäftigt sich in seinem Standardwerk der Fernsehkritik nicht nur mit den Auswirkungen des Fernsehens auf den Konsum anderer Medien wie Buch oder Zeitung, sondern auch mit den Folgen der allgegenwärtigen Vorherrschaft der Bilder für die Kultur, die Gesellschaft und deren Auffassung von Wahrheit. Insgesamt zeichnet der Autor ein eher ernüchterndes Bild eines Mediums, das die meisten Nutzer ohne große Hintergedanken oder gar Bedenken nutzen. Er beschreibt wie durch das Fernsehen, Informationen aus ihren Zusammenhängen gerissen werden und ein „unstillbarer Hunger nach Aufklärung und Entwicklung [entsteht], der wiederum mit leichter Kost gestillt werden muss. Das Ergebnis: Der Mensch verhungert langfristig an geistiger Magersucht“ (Breitenbach 2008: 149). Man amüsiert sich also zu Tode.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fahrenheit 451
- Inhalt
- Rezeption des Films
- Medienbild im Film
- V wie Vendetta
- Inhalt
- Rezeption des Films
- Medienbild im Film
- Fernsehkritik in Fahrenheit 451 und V wie Vendetta
- Schriftkultur vs. Bildkultur in Fahrenheit 451
- Das Fernsehen und seine Auswirkungen
- Schrift als Allerheilmittel?
- Schriftkultur vs. Bildkultur in V wie Vendetta
- Die Abgründe des Fernsehens
- Rettung durch die Macht der Worte
- Schriftkultur vs. Bildkultur in Fahrenheit 451
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Fernsehkritik in den Science-Fiction-Filmen „Fahrenheit 451“ und „V wie Vendetta“ und untersucht das Verhältnis von Schriftkultur und Bildkultur in diesen Werken. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Art und Weise aufzuzeigen, wie die Filme das Fernsehen als ein Medium der Manipulation und Kontrolle darstellen und welche Rolle die Schriftkultur im Widerstand gegen die Bildkultur spielt.
- Das Verhältnis von Schriftkultur und Bildkultur in dystopischen Science-Fiction-Filmen
- Die Kritik an der Macht des Fernsehens und seiner Auswirkungen auf die Gesellschaft
- Die Rolle der Schrift als Mittel des Widerstands und der Bewusstseinsbildung
- Die Darstellung von Dystopien als Warnung vor den Gefahren einer von Medien dominierten Gesellschaft
- Die Analyse der medienspezifischen Eigenheiten von Film und Fernsehen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der Fernsehkritik und die Besonderheiten der Selbstreferentialität in Science-Fiction-Filmen beleuchtet. Anschließend werden die beiden Filme „Fahrenheit 451“ und „V wie Vendetta“ im Detail betrachtet. Für jeden Film werden der Inhalt, die Rezeption und die Darstellung des Medienbilds zusammengefasst. Im Anschluss werden die beiden Filme im Hinblick auf ihre Fernsehkritik verglichen, wobei die gegensätzlichen Perspektiven auf Schriftkultur und Bildkultur in den Vordergrund gestellt werden. Schließlich wird in einem Fazit die Bedeutung der Ergebnisse für die Analyse von Science-Fiction-Filmen und das Verständnis der Beziehung zwischen Medien und Gesellschaft zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Science-Fiction, Fernsehkritik, Schriftkultur, Bildkultur, Dystopie, Manipulation, Kontrolle, Widerstand, Bewusstseinsbildung, Fahrenheit 451, V wie Vendetta, Ray Bradbury, François Truffaut, James McTeigue.
Häufig gestellte Fragen
Welche Fernsehkritik übt Neil Postman?
Postman kritisiert, dass das Fernsehen jedes Thema als Unterhaltung präsentiert, was zu einem Verlust an Tiefgang und Wahrheit in der Gesellschaft führt.
Wie wird das Fernsehen in "Fahrenheit 451" dargestellt?
Es wird als Medium der totalen Manipulation und Ablenkung gezeigt, das die Menschen passiv macht und das kritische Denken durch Bücher ersetzt.
Welche Rolle spielt die Schriftkultur in "V wie Vendetta"?
Die Macht der Worte und die Bewahrung von Kultur dienen als Mittel des Widerstands gegen ein totalitäres Regime, das die Massen über das Fernsehen kontrolliert.
Was ist der zentrale Konflikt zwischen Schrift- und Bildkultur?
Schriftkultur steht für Reflexion und logisches Denken, während die Bildkultur (Fernsehen) oft auf Emotionen und oberflächliche Unterhaltung setzt.
Was bedeutet "Wir amüsieren uns zu Tode"?
Es ist eine Metapher für eine Gesellschaft, die durch ständigen Unterhaltungskonsum ihre Fähigkeit zur ernsthaften Auseinandersetzung mit wichtigen Themen verliert.
- Arbeit zitieren
- Simone Stern (Autor:in), 2012, Schriftkultur vs. Bildkultur. Fernsehkritik in "Fahrenheit 451" und "V wie Vendetta", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230917