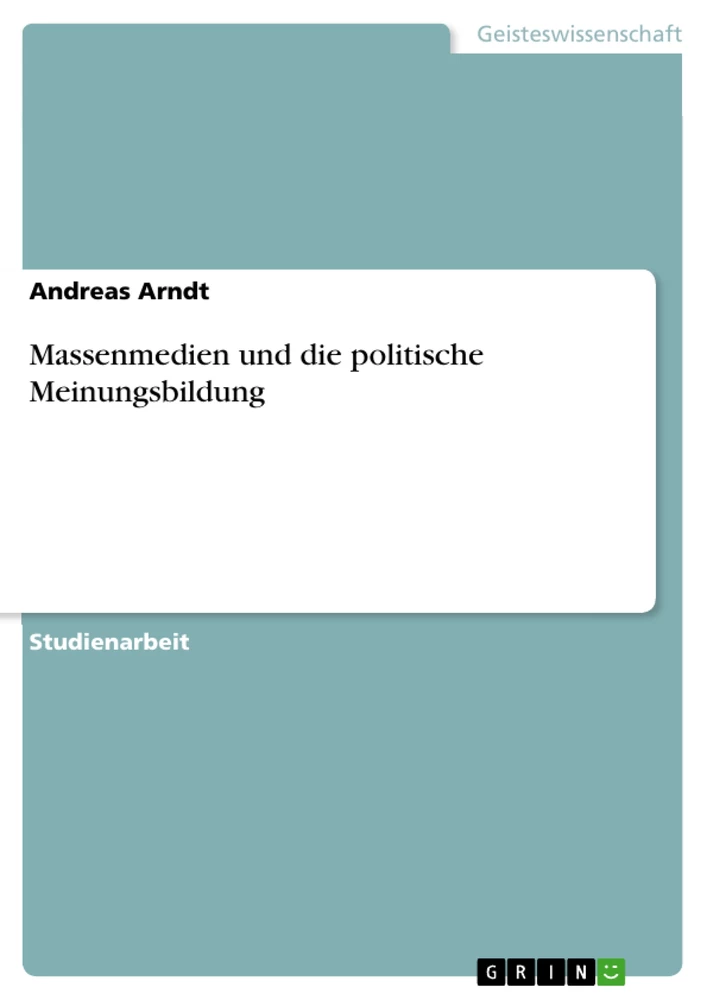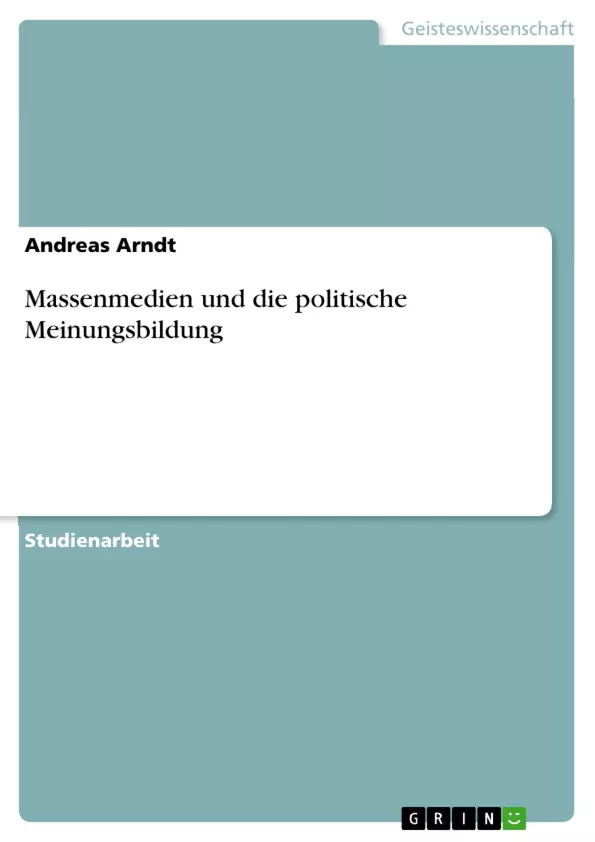In der vorliegenden Arbeit soll die Macht der Massenmedien, die politische Meinungsbildung zu beeinflussen, dargestellt werden. Dazu folgen im zweiten Abschnitt zunächst eine theoretische Einordnung der Massenme¬dien und eine Erklärung der Wirkungsweise von Medien. Außerdem wird das Verhältnis von Medien und Politik dargestellt. Im dritten Abschnitt werden die Auswirkungen der einflussreichsten Medien auf die politische Meinungsbildung vorgestellt. Zudem werden diese Auswirkungen bei¬spielhaft an der Bundestagswahl 2009 erläutert. Der vierte Abschnitt be¬inhaltet eine Zusammenfassung der Auswirkungen auf die politische Mei¬nungsbildung und das Ergebnis der Untersuchung.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretischer Kontext
2.1 Funktionen der Massenmedien
2.2 Erklärungsmodelle der Wirkungsweise von Medien
2.3 Verhältnis zwischen Medien und Politik
3 Auswirkungen der Massenmedien auf die politische Meinungsbildung
3.1 Rundfunk
3.2 Printmedien
3.3 Internet
3.4 Medienwirkung am Beispiel der Bundestagswahl
4 Ergebnis
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion haben Massenmedien in der Politik?
Massenmedien dienen der Information, der politischen Meinungsbildung und fungieren als Bindeglied zwischen Politik und Bürgern.
Welche Medien werden in der Arbeit untersucht?
Die Untersuchung umfasst den Rundfunk (Fernsehen/Radio), Printmedien (Zeitungen/Zeitschriften) und das Internet.
Wie beeinflussen Medien die politische Meinungsbildung?
Medien wirken durch verschiedene Erklärungsmodelle der Medienwirkung, die bestimmen, wie Informationen selektiert, präsentiert und vom Publikum aufgenommen werden.
Welches historische Beispiel wird zur Veranschaulichung genutzt?
Die Auswirkungen der Medien auf die politische Meinungsbildung werden beispielhaft an der Bundestagswahl 2009 erläutert.
Wie ist das Verhältnis zwischen Medien und Politik beschrieben?
Es wird als ein komplexes Wechselverhältnis dargestellt, in dem beide Seiten voneinander abhängig sind und sich gegenseitig beeinflussen.
- Quote paper
- Andreas Arndt (Author), 2012, Massenmedien und die politische Meinungsbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230960