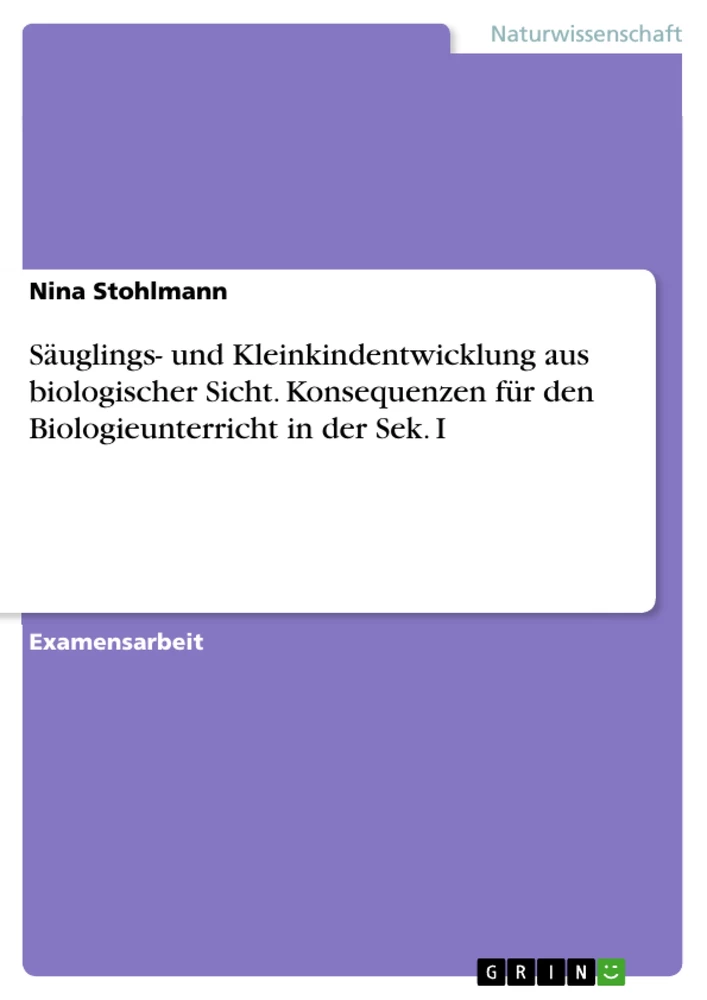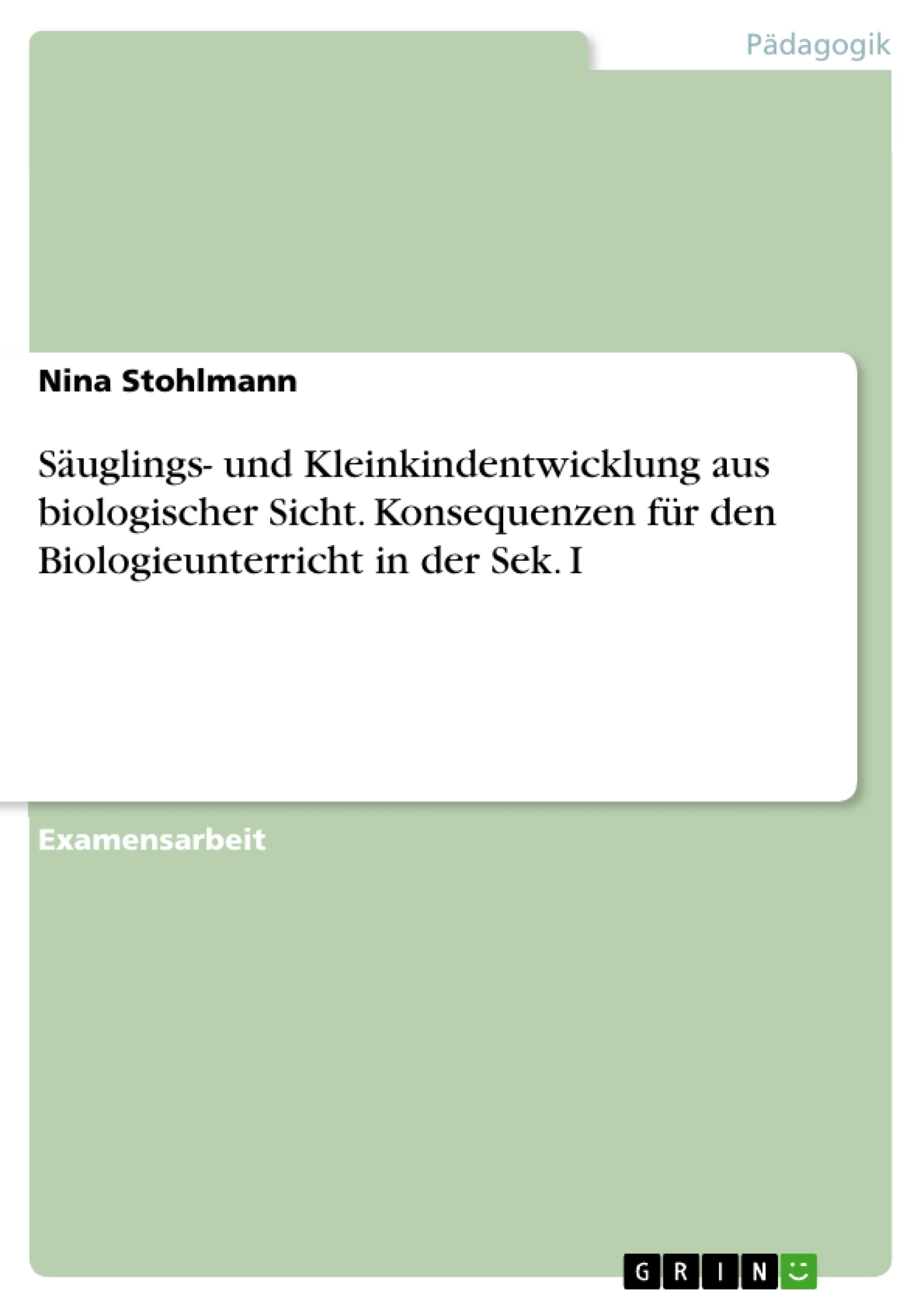Säuglings- und Kleinkindverhalten aus biologischer Sicht
– Konsequenzen für den Biologieunterricht der Sek. I.
1. Einleitung
Immer wieder mußte ich gerade in letzter Zeit feststellen, wie wenig sich Menschen mit dem Thema “Säugling und Kleinkind” auseinander-setzen, wenn sie nicht selber in die Situation kommen, Eltern zu werden. Selbst wenn ein Kind erst einmal da ist, wissen viele Eltern nicht, was auf sie zukommt und welche Verantwortung sie erwartet. Aber man wächst doch mit seinen Aufgaben? Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dies der Fall, doch Fehler, die durch fachgerechte Aufklärung vermieden werden können, sollten somit verhindert werden.
War da nicht einmal die Rede von einem “Führerschein für Eltern”? Für eine gute Idee halte ich diesen nicht, denn es gibt ganz einfach kein Rezept für richtige Erziehung. Kennen aber Eltern die Bedürfnisse von Säugling und Kleinkind, dann sind sie auch im Bilde über die große Verantwortung, die auf sie zukommt. Das Thema wird doch eigentlich in Zeitschriften und Literatur genug behandelt. Müssen sich Schülerinnen und Schüler damit dennoch in der Schule auseinandersetzen? Aufgabe der Schule ist es, Schülerinnen und Schülern Allgemeinbildung – auch die Biologie als Teil der
Allgemeinbildung - zu vermitteln. Neben der Allgemeinbildung sollen Schülerinnen und Schüler u.a. insbesondere lernen, Kritikfähigkeit zu üben. Gerade in so mancher Literatur fand ich Ratschläge zur Kindeserziehung, welche ich nach meinem Wissen ablehne, wie ebenso viele mit Sicherheit gut gemeinte Ratschläge von Freunden und Verwandten. “Das Schreien eines Säuglings ist für ihn wie ein Spaziergang”, “Schreien stärkt die Lungen”, “dieses oder jenes
verwöhnt das Kind”. Schüler sollten, als potentielle Eltern, mit Hilfe ihrer Bildung erkennen, welche Bedürfnisse Kinder haben, und danach handeln. Klagen nicht viele Menschen über die Aggressivität, die Brutalität und das egoistische Verhalten der Jugend? Wie viel Zeit bringen Eltern heute eigentlich noch auf, um mit ihren Kinder zu spielen? Wieviel Raum bleibt Kindern heute noch, um ihrem Erkundungs- und Bewegungsdrang gerecht zu werden? Trat ehemals
“Deprivation” vorwiegend in Heimen auf, kann man heute doch davon ausgehen, daß viele erst in der Schule bemerkte Verhaltensauffälligkeiten und –störungen durch mangelnde Betreuung
in den Familien entstehen. Vielleicht wäre Aufklärung durch den Unterricht in der Schule ein kleiner, möglicherweise der erste, Schritt gegen Probleme dieser Art.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung des menschlichen Säuglings und Kleinkindes aus biologischer Sicht
- Das menschliche Neugeborene im biologischen Vergleich
- Reifung und Entwicklung des Säuglings und Kleinkindes
- Spracherwerb
- Eltern-Kind-Interaktionen in den ersten Lebensjahren
- Prägung, prägungsähnliches Lernen und Bindung
- Die Phase der Prägung bei Tieren
- Bindung und prägungsähnliches Lernen beim Menschen
- Faktische Elternschaft und Fremdbetreuung
- Verwandte, Adoptiv- und Pflegeeltern
- Heimunterbringung und Kinderdörfer
- Tagesmütter und Kinderkrippen
- Selbständigwerden und Erkunden der Umwelt durch Spielen und Nachahmen
- Prägung, prägungsähnliches Lernen und Bindung
- "Deprivation" als Folge von Betreuungsmängeln
- Das Erscheinungsbild der "Deprivation"
- Maßnahmen zur Vermeidung von “Deprivation”
- Konsequenzen für den Biologieunterricht in der Sekundarstufe I
- Didaktische Überlegungen
- Lernziele
- Methodische Überlegungen in Verbindung mit praktischen Vorschlägen für die Umsetzung im Unterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examensarbeit untersucht die Entwicklung des menschlichen Säuglings und Kleinkindes aus biologischer Perspektive und leitet daraus Konsequenzen für den Biologieunterricht der Sekundarstufe I ab. Das Ziel ist, die Bedeutung biologischer Erkenntnisse für das Verständnis von Säuglings- und Kleinkindentwicklung aufzuzeigen und didaktische Ansätze für den Unterricht zu entwickeln.
- Biologische Grundlagen der Säuglings- und Kleinkindentwicklung
- Eltern-Kind-Interaktion und Bindung
- Einfluss von Fremdbetreuung auf die Entwicklung
- Konsequenzen von Betreuungsmängeln ("Deprivation")
- Didaktische und methodische Überlegungen für den Biologieunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die Notwendigkeit, sich mit der Säuglings- und Kleinkindentwicklung auseinanderzusetzen, um Fehlern in der Erziehung vorzubeugen und die Verantwortung von Eltern zu verdeutlichen. Sie argumentiert für die Einbeziehung dieses Themas in den Biologieunterricht, um die Kritikfähigkeit der Schüler zu fördern und ein besseres Verständnis der Bedürfnisse von Kindern zu ermöglichen. Die Autorin kritisiert vereinfachte und teilweise falsche Ratschläge zur Kindererziehung und hebt die Bedeutung frühkindlicher Entwicklung für das spätere Verhalten hervor.
Die Entwicklung des menschlichen Säuglings und Kleinkindes aus biologischer Sicht: Dieses Kapitel beleuchtet die biologischen Aspekte der Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern. Es vergleicht das menschliche Neugeborene mit anderen Säugetieren, beschreibt die Reifungsprozesse und Entwicklungsschritte in den ersten Lebensjahren und behandelt den Spracherwerb. Die biologischen Grundlagen werden hier umfassend dargestellt, um das weitere Verständnis der Eltern-Kind-Interaktion zu schaffen.
Eltern-Kind-Interaktionen in den ersten Lebensjahren: Dieses Kapitel fokussiert auf die Interaktionen zwischen Eltern und Kind, insbesondere auf die Bedeutung der Bindung. Es behandelt Konzepte wie Prägung und prägungsähnliches Lernen und analysiert den Einfluss verschiedener Betreuungsformen (Verwandte, Adoptiv- und Pflegeeltern, Tagesmütter, Kinderkrippen) auf die Entwicklung. Die Autorin thematisiert die Herausforderungen der Fremdbetreuung, ohne jedoch die Berufstätigkeit von Müttern zu verurteilen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der Herausforderungen und möglichen negativen Auswirkungen mangelnder Bindung.
"Deprivation" als Folge von Betreuungsmängeln: Dieses Kapitel befasst sich mit den Folgen von Betreuungsmängeln und dem Phänomen der "Deprivation". Es beschreibt die Auswirkungen von mangelnder Fürsorge auf die Entwicklung des Kindes und zeigt Maßnahmen zur Vermeidung von "Deprivation" auf. Es wird deutlich, dass "Deprivation" nicht nur in Heimen, sondern auch in Familien auftreten kann, was die Relevanz des Themas für den Biologieunterricht unterstreicht.
Konsequenzen für den Biologieunterricht in der Sekundarstufe I: Das Kapitel beschreibt didaktische und methodische Überlegungen für die Integration des Themas "Säuglings- und Kleinkindentwicklung" in den Biologieunterricht der Sekundarstufe I. Es werden Lernziele definiert und praktische Vorschläge für die Umsetzung im Unterricht gemacht. Dabei wird die begrenzte Unterrichtszeit und die Notwendigkeit, das Thema alters- und situationsgerecht zu vermitteln, berücksichtigt. Die Autorin betont die Wichtigkeit, sensible Themen mit Rücksicht auf die sozialen Verhältnisse der Schüler zu behandeln, um negative Auswirkungen auf die Kinder zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Säuglingsentwicklung, Kleinkindentwicklung, Verhaltensbiologie, Eltern-Kind-Bindung, Prägung, Fremdbetreuung, Deprivation, Biologieunterricht, Sekundarstufe I, Didaktik, Methodik, Lernziele.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Examensarbeit: Säuglings- und Kleinkindentwicklung und ihre Bedeutung für den Biologieunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Examensarbeit?
Die Examensarbeit untersucht die Entwicklung des menschlichen Säuglings und Kleinkindes aus biologischer Sicht und leitet daraus Konsequenzen für den Biologieunterricht der Sekundarstufe I ab. Sie beleuchtet biologische Grundlagen, Eltern-Kind-Interaktionen, den Einfluss von Fremdbetreuung und die Folgen von Betreuungsmängeln ("Deprivation").
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Biologische Grundlagen der Säuglings- und Kleinkindentwicklung (Vergleich zum Neugeborenen anderer Säugetiere, Reifungsprozesse, Spracherwerb), Eltern-Kind-Interaktion und Bindung (Prägung, prägungsähnliches Lernen), Einfluss von Fremdbetreuung (Verwandte, Adoptiv- und Pflegeeltern, Tagesmütter, Kinderkrippen), Konsequenzen von Betreuungsmängeln ("Deprivation") und didaktische sowie methodische Überlegungen für die Integration des Themas in den Biologieunterricht der Sekundarstufe I.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Entwicklung des menschlichen Säuglings und Kleinkindes aus biologischer Sicht, Eltern-Kind-Interaktionen in den ersten Lebensjahren, "Deprivation" als Folge von Betreuungsmängeln und Konsequenzen für den Biologieunterricht in der Sekundarstufe I. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der zentralen Inhalte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung biologischer Erkenntnisse für das Verständnis von Säuglings- und Kleinkindentwicklung aufzuzeigen und didaktische Ansätze für den Biologieunterricht zu entwickeln. Es soll verdeutlicht werden, wie biologisches Wissen dazu beitragen kann, Fehlern in der Erziehung vorzubeugen und ein besseres Verständnis der Bedürfnisse von Kindern zu ermöglichen.
Welche Konsequenzen für den Biologieunterricht werden gezogen?
Die Arbeit liefert didaktische und methodische Überlegungen zur Integration des Themas "Säuglings- und Kleinkindentwicklung" in den Biologieunterricht der Sekundarstufe I. Es werden Lernziele definiert und praktische Vorschläge für die Umsetzung im Unterricht unter Berücksichtigung der begrenzten Unterrichtszeit und der Sensibilität des Themas gemacht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Säuglingsentwicklung, Kleinkindentwicklung, Verhaltensbiologie, Eltern-Kind-Bindung, Prägung, Fremdbetreuung, Deprivation, Biologieunterricht, Sekundarstufe I, Didaktik, Methodik, Lernziele.
Wie wird das Thema "Deprivation" behandelt?
Das Kapitel zu "Deprivation" beschreibt die Folgen von Betreuungsmängeln und deren Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Es betont, dass "Deprivation" nicht nur in Heimen, sondern auch in Familien auftreten kann und zeigt Maßnahmen zur Vermeidung auf.
Wie wird der Einfluss von Fremdbetreuung behandelt?
Der Einfluss verschiedener Betreuungsformen (Verwandte, Adoptiv- und Pflegeeltern, Tagesmütter, Kinderkrippen) auf die Entwicklung wird analysiert. Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen der Fremdbetreuung, ohne die Berufstätigkeit von Müttern zu verurteilen, und fokussiert auf das Verständnis der Herausforderungen und möglichen negativen Auswirkungen mangelnder Bindung.
- Citar trabajo
- Nina Stohlmann (Autor), 1998, Säuglings- und Kleinkindentwicklung aus biologischer Sicht. Konsequenzen für den Biologieunterricht in der Sek. I, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230