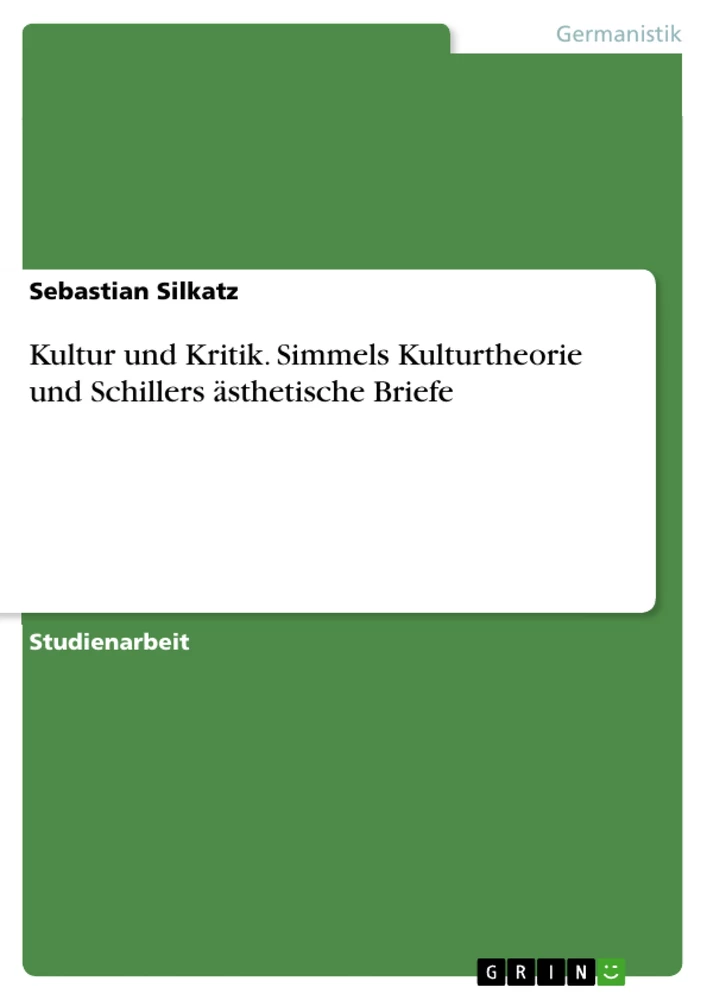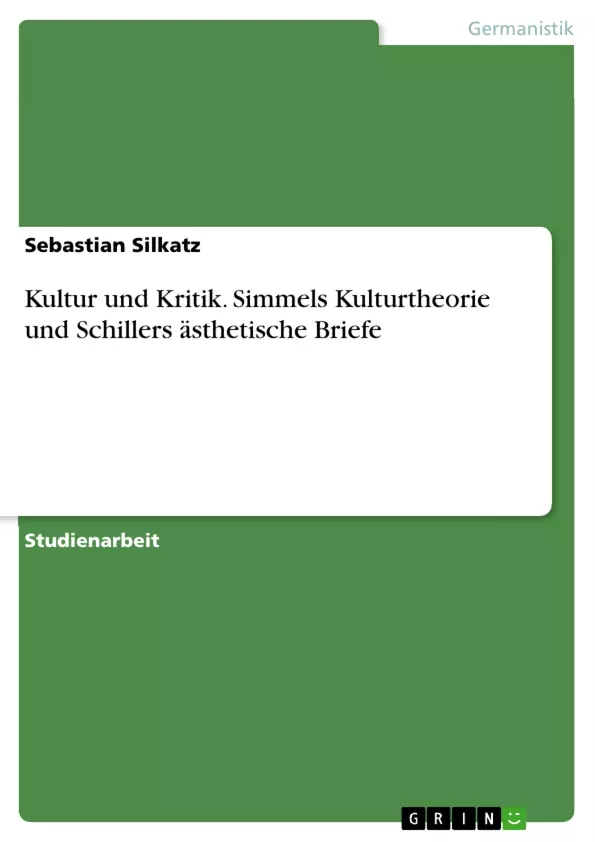Im September 2012 entschied sich die SPD dafür einzutreten, dass Kultur als Staatsziel im deutschen Grundgesetz aufgenommen wird. Unabhängig von den darauf folgenden Diskussionen stellt dies einen Anlass dar, den Begriff „Kultur“ genauer zu analysieren. Dabei muss man sich bewusst machen, dass es Auffassungen von „Kultur“ gibt, die sehr stark divergieren, komplett Gegensätzliches beschreiben oder sich sogar gegenseitig ausschließen. Am nützlichsten erscheinen dabei noch Definitionen, die vom „engen“ und „weiten“ Kulturbegriff ausgehen. Dabei bezeichnet ersterer, von dem wohl die SPD bei ihrer Initiative ausgeht, vor allem die Abgrenzung der Hochkultur gegenüber dem Trivialen und letzterer die Unterscheidung des vom Menschen Geschaffenen gegenüber der Natur. Doch auch bei diesem Versuch der Beschreibung von „Kultur“ gibt es noch zahlreiche Diskussionen.
Ein Philosoph, der sich ebenfalls mit der Theorie der Kultur auseinandersetzte, war Georg Simmel. Dabei fällt bei der Auseinandersetzung mit seinen Schriften auf, dass viele Gedanken bereits von Friedrich Schiller in seinen Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen formuliert zu sein scheinen. Da Schiller mit seiner Abhandlung einer der Begründer der modernen Kulturkritik ist, dessen Bedeutung „man kaum überschätzen“ kann und dem jedoch in dieser Hinsicht kaum Aufmerksamkeit zu teil wurde, soll hier zumindest ein kleiner Abschnitt seiner Wirkungsgeschichte geschrieben werden.
Dabei wird gezeigt, dass sich Simmel bei seiner Analyse von Kultur und der daraus entstehenden modernen Tragödie zu weiten Teilen auf Schillers Briefe und dessen Kulturkritik bezieht. Des weiteren soll dargestellt werden, dass Simmel zugleich wesentliche Aspekte von Schillers Theorie, die nicht der Entfremdungstheorie zugehören, verwirft und nicht in seinen Betrachtungen aufnimmt.
Damit dies gelingt, wird zuerst der Kulturbegriff Georg Simmels sowie die daraus folgende Tragödie der Kultur dargestellt. Mit dem Ziel, die Bezüge Simmels zu Schiller aufzuzeigen, werden anschließend in einer textnahen Analyse die Parallelen von Simmels und Schillers Kulturkritik und anschließend die Gemeinsamkeiten, die darüber hinaus gehen, aufgezeigt. Um das Verhältnis von Simmel und Schiller eindeutig bestimmen zu können, werden zudem die wesentlichen Unterschiede in beiden Darstellungen herausgearbeitet. In einer Zusammenfassung wird die abschließende Bewertung der Ergebnisse vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. „Kultur“ bei Georg Simmel
2.1 Georg Simmels Kulturbegriff
2.2 Die Tragödie der Kultur
3. Georg Simmel und Friedrich Schiller
3.1 Gemeinsamkeiten
3.1.1 Die Kulturkritik
3.1.2 Simmels „Kultur“ und Schillers „Kunst“
3.2 Unterschiede
4. Zusammenfassung
5. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Georg Simmel unter der "Tragödie der Kultur"?
Es beschreibt den Konflikt, bei dem die „objektive Kultur“ (vom Menschen geschaffene Dinge, Wissen, Technik) so schnell wächst, dass die „subjektive Kultur“ (die individuelle Bildung und Verinnerlichung) nicht mehr mithalten kann, was zur Entfremdung führt.
Welchen Einfluss hatte Friedrich Schiller auf Simmels Theorie?
Simmel bezieht sich in seiner Analyse der modernen Entfremdung stark auf Schillers „Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen“, in denen Schiller bereits die Fragmentierung des Menschen durch die Arbeitsteilung kritisierte.
Was ist der Unterschied zwischen einem "engen" und "weiten" Kulturbegriff?
Der enge Kulturbegriff bezieht sich meist auf Hochkultur (Kunst, Literatur), während der weite Begriff alles vom Menschen Geschaffene im Gegensatz zur Natur umfasst.
Wo liegen die wesentlichen Unterschiede zwischen Simmel und Schiller?
Während Schiller durch ästhetische Erziehung eine Heilung der Gesellschaft für möglich hielt, sah Simmel die Tragödie der Kultur als ein unlösbares, strukturelles Problem der Moderne an.
Warum wird Schiller als Begründer der modernen Kulturkritik bezeichnet?
Schiller war einer der ersten, der die negativen Folgen der Spezialisierung und der rein rationalen Zivilisation für die menschliche Ganzheitlichkeit radikal in Frage stellte.
- Quote paper
- Sebastian Silkatz (Author), 2013, Kultur und Kritik. Simmels Kulturtheorie und Schillers ästhetische Briefe , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231046