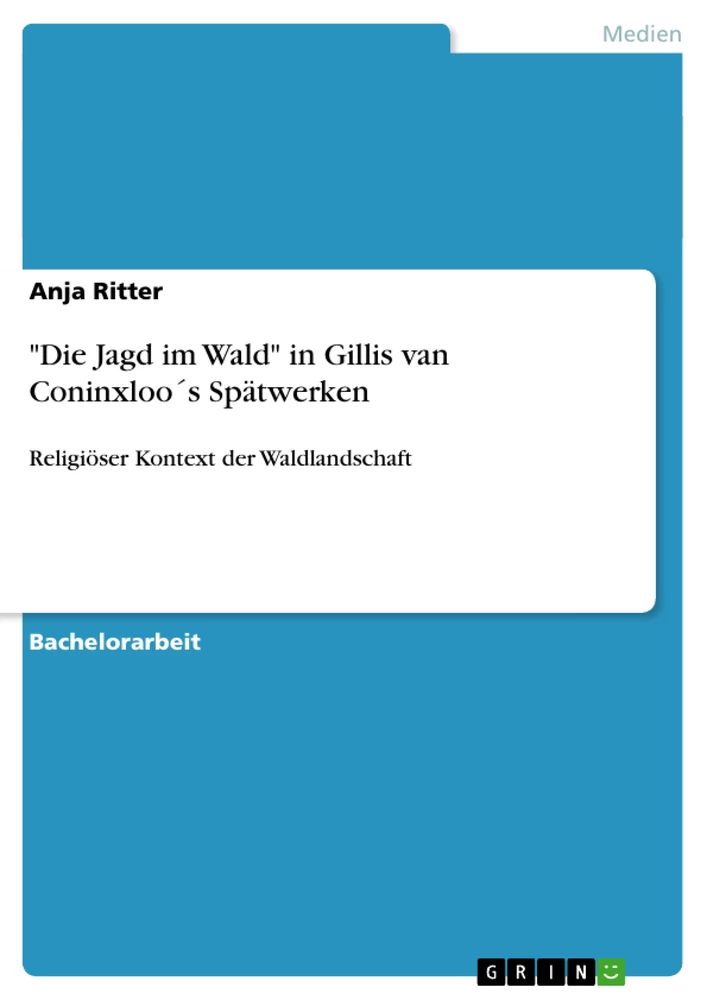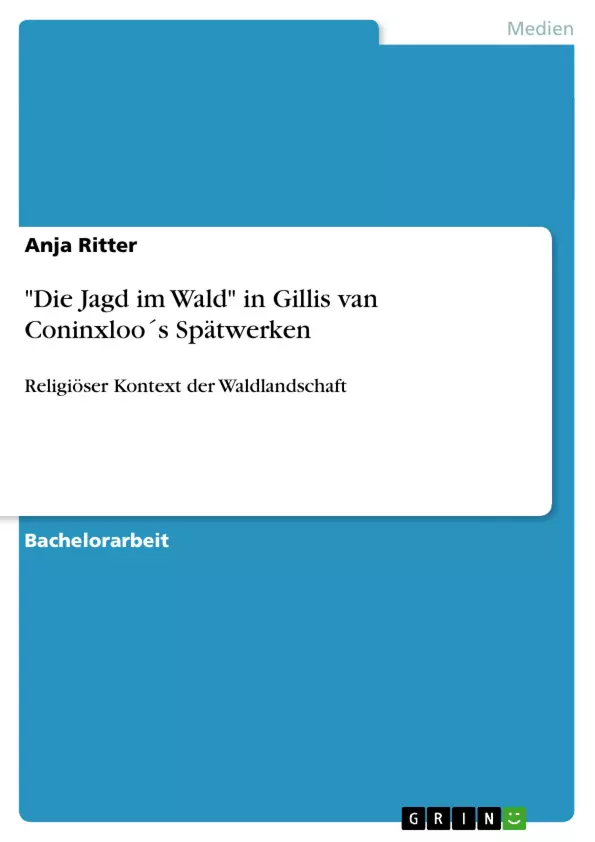Im Rahmen zweier Praktika1 in der Gemäldegalerie Alte Meister kam es zu ersten
Auseinandersetzungen mit der flämischen Malerei. Vertiefend lag der
Bearbeitungsschwerpunkt im Bereich der Forschungsarbeit Flämische Landschaften des
16. und frühen 17. Jahrhunderts aus dem Bestand der Dresdener Gemäldegalerie Alte
Meister unter der Leitung von Frau Dr. Neidhardt. Neben Werken von Herri de Bles und
Roleant Savery befindet sich ebenfalls ein Bild des Künstlers Gillis van Coninxloo,
welcher eine wichtige Rolle der aufkommenden Waldlandschaft einnahm.
Es handelt sich bei dem Bestandswerk der Dresdner Gemäldegalerie um das 1588
entstandene Urteil des Midas mit einer Landschaft, die sich über das gesamte Gemälde
erstreckt. Der Tradition folgend, handelt es sich bei der Landschaft um eine
Überschaulandschaft, die weiträumig einen Einblick in die Umgebung der Szene zulässt.
In ihr finden sich bereits erste Indizien einer Natur mit waldlandschaftlichem Charakter,
denn seitlich im Vordergrund wurden dichte Bäume angelegt, die einen Waldrand bilden.
Jedoch unterlag es nicht dem Arbeitsschwerpunkt der Praktikumstätigkeit, sich vertiefend
mit der waldlandschaftlichen Darstellung in Gillis van Coninxloo´s Werken und die
Entwicklung der Waldlandschaft auseinanderzusetzen.
Während dies lediglich erste Berührungspunkte des Künstlers und seinen
Waldlandschaften darstellten, soll in der vorliegenden Arbeit eine vertiefende
Untersuchung diesbezüglich vorgenommen werden.
Beginnend mit der Forschungslage zu Gillis van Coninxloo´s Bibliographie und seinen
Werken, findet weiterführend eine kritische Auseinandersetzung mit Martin Papenbrocks
These statt, die besagt, dass der Wald in Gillis van Coninxloo´s Werken ein Exilmoment
beinhaltet. Es stellt eine Überleitung zum eigenen Betrachtungsschwerpunkt dar. Der
Auseinandersetzung mit einem konfessionellen Bezug in Gillis van Coninxloo´s Werken
folgend, stellt sich die Frage, inwiefern die Jagd im Wald in seinen Spätwerken einen
religiösen Kontext bieten kann und wie sich dieser äußert. Dazu erscheint es von großer
Wichtigkeit, den Wald als wirtschaftlichen Nutzungsraum, als Ort der Transzendenz und
im sozial-gesellschaftlichen Kontext zu betrachten sowie den religiösen Bezug der
Staffagen im Wald zu untersuchen.[...]
Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG UND THEMENFINDUNG
2. FORSCHUNGSLAGE
2.1. Forschungslage zu Gillis van Coninxloo's Waldlandschaften
2.2. Der Wald - ein Exilort? Kritische Auseinandersetzung Papenbrocks
3. DIE JAGD IM WALD - IN GILLIS VAN CONINXLOO'S SPÄTWERKEN
3.1. Eichenwald als wirtschaftlicherNutzungsraum
3.2. Waldlandschaft als Mikrokosmos
3.3. Wald als Raum der Transzendenz
3.4. Wald als sozialgesellschaftlicher Handlungsraum
3.5. Jagd im Wald als religiöse Metapher
4. ZUSAMMENFASSUNG
5. LITERATURVERZEICHNIS
6. BILDNACHWEIS
7. ABBILDUNGEN
1. EINLEITUNG UND THEMENFINDUNG
Im Rahmen zweier Praktika[1] in der Gemäldegalerie Alte Meister kam es zu ersten Auseinandersetzungen mit der flämischen Malerei. Vertiefend lag der Bearbeitungsschwerpunkt im Bereich der Forschungsarbeit Flämische Landschaften des 16. und frühen 17. Jahrhunderts aus dem Bestand der Dresdener Gemäldegalerie Alte Meister unter der Leitung von Frau Dr. Neidhardt. Neben Werken von Herri de Bles und Roleant Savery befindet sich ebenfalls ein Bild des Künstlers Gillis van Coninxloo, welcher eine wichtige Rolle der aufkommenden Waldlandschaft einnahm.
Es handelt sich bei dem Bestandswerk der Dresdner Gemäldegalerie um das 1588 entstandene Urteil des Midas mit einer Landschaft, die sich über das gesamte Gemälde erstreckt. Der Tradition folgend, handelt es sich bei der Landschaft um eine Überschaulandschaft, die weiträumig einen Einblick in die Umgebung der Szene zulässt. In ihr finden sich bereits erste Indizien einer Natur mit waldlandschaftlichem Charakter, denn seitlich im Vordergrund wurden dichte Bäume angelegt, die einen Waldrand bilden. Jedoch unterlag es nicht dem Arbeitsschwerpunkt der Praktikumstätigkeit, sich vertiefend mit der waldlandschaftlichen Darstellung in Gillis van Coninxloo's Werken und die Entwicklung der Waldlandschaft auseinanderzusetzen.
Während dies lediglich erste Berührungspunkte des Künstlers und seinen Waldlandschaften darstellten, soll in der vorliegenden Arbeit eine vertiefende Untersuchung diesbezüglich vorgenommen werden.
Beginnend mit der Forschungslage zu Gillis van Coninxloo's Bibliographie und seinen Werken, findet weiterführend eine kritische Auseinandersetzung mit Martin Papenbrocks These statt, die besagt, dass der Wald in Gillis van Coninxloo's Werken ein Exilmoment beinhaltet. Es stellt eine Überleitung zum eigenen Betrachtungsschwerpunkt dar. Der Auseinandersetzung mit einem konfessionellen Bezug in Gillis van Coninxloo's Werken folgend, stellt sich die Frage, inwiefern die Jagd im Wald in seinen Spätwerken einen religiösen Kontext bieten kann und wie sich dieser äußert. Dazu erscheint es von großer Wichtigkeit, den Wald als wirtschaftlichen Nutzungsraum, als Ort der Transzendenz und im sozial-gesellschaftlichen Kontext zu betrachten sowie den religiösen Bezug der Staffagen im Wald zu untersuchen.
2. FORSCHUNGSLAGE
2.1. Forschungslage zu Gillis van Coninxloo's Waldlandschaften
Eine erste kunsthistorische Auseinandersetzung mit den Kunstwerken Gillis van Coninxloo's fand bereits zu Lebzeiten des Künstlers statt.
Im Jahr 1604 schrieb der zeitgenössische Künstler und Kunsttheoretiker Karel van Mander in seinem dreiteiligen Schilder-Boeck[2] van Coninxloo eine bedeutende Rolle zu. Der Autor charakterisierte dabei seinen künstlerischen Zeitgenossen im Schilder-Boeck als den besten Landschaftsmaler aller Zeiten. Er erkannte bereits die besondere Darstellungsweise in van Coninxloo's Werken und pries die neuartige Baumgestalt an, denn kein anderer Künstler jener Zeit habe solch vorzügliche Stämme gemalt:
Want om cort maken, en mijn meeninghe van zijn constighe wercken te segghen, soo weet ick dees tijt geen beter Landtschap-maker: en sie, dat in Hollandt zijn handelinghe seer begint naeghevolght te worden: en de boomen, die hier wat dorre stonden, worden te wassen na de zijne, so veel als sy goelijcx mogen, hoewel het sommighe Bouwers oft Planters noch noode souden bekennen.[3] Obwohl die zeitgenössischen Kunstliebhaber die Werke von Gillis van Coninxloo schätzten, schien in der folgenden Zeit seine Präsenz im künstlerischen Sektor nachzulassen. Lediglich in drei weiteren Schriftquellen fand der Künstler Erwähnung, wobei auf van Coninxloo's Leben und Lebensweise eingegangen wurde, sein künstlerisches Schaffen allerdings in den Hintergrund rückte.
Angelehnt an Karel van Manders Schilder-Boeck wurde Gillis van Coninxloo in Joachim van Sandrartes Teutsche Academie der Bau- Bild- und Mahlerey-Künste (1675) in verkürzter Variante erwähnt und als Lehrmeister des Pieter Brueghel des Jüngeren genannt.
1720 erschien der Name Gillis van Coninxloo in einer fortsetzenden Variante zum Schilder-Boeck von Arnold Houbraken und 30 Jahre später von Johan van Gool, worin der Künstler erwähnt wird. Allerdings verlor man weitestgehend Interesse an das Schaffen van Conixloo's, sodass sein künstlerisches Ausmaß weitestgehend in Vergessenheit geriet.
Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann man sich im kunsthistorischen Sektor erneut intensiv mit dem Künstler und schließlich auch mit seinen Werken auseinanderzusetzen. Mit der Werkbetrachtung eröffnete sich innerhalb der Landschaftsmalerei eine neue Sichtweise auf den Künstler Gillis van Coninxloo.
Als sich Max Roose 1861 mit der Antwerpener Malerschule[4] beschäftigte und sich dabei inhaltlich auf van Manders Schilder-Boeck stützte, stieß er auf den Künstler Gillis van Coninxloo. Aus diesem Grund enthält die Geschichte der Malerschule einen Abschnitt zu van Coninxloo mit einer Zitierung des Schilder-Boeck van Manders. Das impliziert, dass dem Künstler Gillis van Coninxloo in der Kunstliteratur die einst zugeschriebene wichtige Rolle zur Entstehung der Landschaftsmalerei aufgegriffen und zugesprochen wird.
Im Laufe der Zeit unterlag die Zuschreibung des Künstlers soweit dem Wandel, dass er bis ins 20. Jahrhundert als spiritus rector[5] der Waldlandschaft galt. Wenngleich keine Quellen angegeben werden, woher die Autoren jene Informationen entnahmen, und diese Zuschreibung an van Coninxloo nirgends auffindbar ist, wiederholte sich zuvor in zahlreichen Ausstellungskatalogen und wissenschaftlichen Fachbüchern die Bemerkung, dass van Coninxloo der Begründer der Waldlandschaft sei.
Allgemein gewannen schließlich die Werke und der Künstler eine größere Interessenbekundung im kunsthistorischen Sektor. Ausgehend von der bereits bestehenden Forschungsarbeit zu Werkankäufen und -verkäufen der Frankenthaler Maler und der Ergründung nach Werkzuordnungen, die bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts vorgenommen wurden, veröffentlichte Eduard Plietzsch 1910 in seinem Buch einen zusammenfassenden Überblick über die Frankenthaler Maler. Dieser Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der niederländischen Landschaftsmalerei[6] beinhaltet neben zahlreichen anderen Künstlern eine Zusammenfassung zu Gillis van Coninxloo's Vita und einer dazugehörigen angelegten und beschriebenen Werksammlung.
Nach diesem inhaltlich strukturierten Aufbau wurden die folgenden Biographien zu Gillis van Coninxloo und sein Werkinventar weitergeführt. Beispielsweise erweiterte Wellensiek in ihrer Dissertation Mitte der 50er Jahre das Werkinventar des Künstlers unter Betrachtung der Entwicklung der niederländischen Landschaftsmaler um 1600[7]. Zeitgleich betrachtete man ebenfalls sowohl zeitgenössische als auch vorläufige Künstler um Gillis van Coninxloo und die Frankenthaler Maler und schuf eine intensive Untersuchung zu den Wechselwirkungen und gegenseitigen Beeinflussungen der Künstler. Unter dieser Voraussetzung verlor Gillis van Coninxloo bereits Ende der 30er Jahre den Zuspruch, als spiritus rector zu gelten. Als Frits Lugt 1927 sich den Zeichnungen des Pieter Bruegel widmete[8], fand er Waldlandschaften, die ein künstlerisch ähnlich angelegtes Arrangement zu van Coninxloo's Waldlandschaften aufwies[9].
In den folgenden Jahren untersuchten und erforschten ebenfalls die Kunsthistoriker Karl Arndt[10] und Theréz Gerszi[11] die Anfänge der Waldlandschaftsmalerei und bestätigten Lugťs Erkenntnisse. Dies heißt, dass bereits vor Gillis van Coninxloo die Landschaft des Waldes thematisch aufgegriffen wurde. Darüber hinaus stellen diese Landschaften Vorbilder für Coninxloo's Werke dar, die den Einstieg eines neuen Bildtypus einleiten sollten. Allerdings gilt nicht nur Pieter Bruegel als wichtiger Künstler, der Gillis van Coninxloo beeinflusst hat. Neben ihm übten die Werke Jan Brueghels Einfluss auf den Bildtypus des Waldes aus.[12]
Die jüngeren Erkenntnisse bestätigen, dass sich das Motiv des Waldes im kulturellen Darstellungs- und Repräsentationskontext des 16. Jahrhunderts bettet. Diesbezüglich erschien bereits 1988 die Dissertation von Hanschke, in der die Autorin darauf verwies, dass die Notwendigkeit besteht, „diese Lücke zu schließen und ein möglichst umfassendes Bild der komplexen Beziehungen der bekannten und weniger bekannten Künstler und ihrer Werke zu zeichnen“[13], um den Entwicklungsprozess begreiflich machen zu können, der zur autonomen Waldlandschaftsmalerei führt. Dabei stellte Hanschke über die anfänglichen Darstellungen der Landschaften mit Waldstücken Bezüge zur kulturellen, religiös-politischen und sozial-gesellschaftlichen Situation her.
Gillis van Coninxloo erscheint in diesem Zusammenhang als ein wichtiger Landschaftsmaler, der neben anderen Künstlern als Indikator der Waldlandschaftsmalerei fungiert. Bedeutend für die Waldlandschaftsmalerei ist van Coninxloo's eingeleiteter Wandel von der Fernsicht zur Ansicht aus der Nähe und die neue Baumdarstellung[14]. Dies stellt sein künstlerisches Schaffen in den Vordergrund.
Auch sah der Kunsthistoriker Raczynski[15] in den Werken van Coninxloo einen wesentlichen Übergang zur Landschaftsmalerei als eigenständige Gattung, denn „Gillis van Coninxloo [...] ist der bedeutendste und entwicklungsgeschichtlich wichtigste Vertreter des Romanismus auf dem Gebiet der Landschaftsmalerei.“[16] Und Plietzsch charakterisierte den Künstler als „entwicklungsgeschichtlich wichtigsten Landschaftsmaler unter den südniederländischen Emigranten“.[17]
Wenngleich Gillis van Coninxloo's Werke entscheidend für den neuen Bildtypus sind, so kann er allerdings nicht „als der Begründer der niederländischen Waldlandschaft gelten, als der er lange Zeit angesehen wurde; wenigstens nicht als der einzige.“[18] Ebenfalls geht Papenbrock nicht davon aus, dass Gillis van Coninxloo mit seinen waldlandschaftlichen Werken eine eigenständige Gattung einleitete. Dem Kunsthistoriker zur Folge gewinnt der Darstellungsraum eine symbolische Tragweite, denn der Wald stelle den Ort des Exils dar. Papenbrock brachte die Werke aus der Frankenthaler und Amsterdamer Zeit in Verbindung mit der Lebenssituation des Künstlers, der auf Grund konfessioneller Gründe aus Antwerpen floh und sich an dem Emigrantenort Frankenthal niederließ.
Deutlich wird schließlich in der Betrachtung zur Forschungslage, dass anfangs vorrangig die Vita des Künstlers Gillis van Coninxloo untersucht wurde, was seit der Niederschrift des Zeitgenossen Karel van Mander ausging. Dieser biographischen Untersuchung und Erschließung aus Quellen und Dokumenten zu Gillis van Coninxloo folgten vereinzelt Werkbetrachtungen und deren Inventarerweiterung. Ebenfalls besteht seit Karel van Manders Schilder-Boeck, wenngleich dies lediglich marginal ausgeprägt auftritt, das Bemühen, dem Künstler Gillis van Coninxloo eine wichtige Position und Rolle für die Waldlandschaftsentstehung zuzuschreiben. Allerdings relativierte sich die Bezeichnung Gillis van Coninxloo's als Begründer der Waldlandschaft zu gelten.
Aus dem Forschungsstand über Gillis van Coninxloo's Untersuchungen lässt sich zusammenfassen, dass der Künstler einer bestehenden und bewusst wahrgenommenen niederländischen Darstellungstradition folgte. Von diesem Bildprogramm und der Bedeutung des zeitgeistigen Waldmotivs ausgehend entwickelte er den Bildtyp weiter und beeinflusste zeitgenössische Künstler.
In der vorliegenden Arbeit soll allerdings nicht primär Augenmerk auf die Untersuchung gelegt werden, in der sich die Anfänge der Eigenständigkeit von Waldlandschaften wiederfinden und welcher kompositorischen Wandlung der Wald in den Werken verschiedener Künstler unterliegt, sondern in welchem religiösen Zusammenhang die Jagd im Wald in Gillis van Coninxloo's Spätwerken steht.
Diesbezüglich erscheint es äußerst sinnvoll, sich kritisch mit dem Habilitationsschreiben von Martin Papenbrock auseinanderzusetzen, denn der Kunsthistoriker eröffnete in seiner Betrachtung zu den Landschaften des Exils eine neue Bedeutungsebene für den Wald als Handlungs- und Deutungsraum in Gillis van Coninxloo's Werken.
2.2. Der Wald - ein Exilort? Kritische Auseinandersetzung Papenbrocks
Bereits Martin Papenbrock erwähnte, dass die Waldlandschaft Gillis van Coninxloo's Spätwerke bildthematisch an die Jagddarstellung gekoppelt sei[19], richtete jedoch seinen Interessenschwerpunkt an die Exilmetaphorik in den Werken des Künstlers zur Frankenthaler Zeit. Es handelt sich dabei um Werke, die inhaltlich einen Übergang von mythologischen und religiösen Bildszenen in einer waldigen Landschaft zur profanen, nahansichtigen Waldlandschaft darstellen. Dabei erkannte Papenbrock unter Betrachtung der Werkentwicklung, dass der Wald schließlich „zum alleinigen Bildgegenstand und Bedeutungsträger“[20] wird. Anschließend verdeutlicht er in welcher Wechselbeziehung der Wald und der Mensch stehen und dass der Wald sowohl sozialgesellschaftliche, politische als auch wirtschaftliche Situationen wiederspiegelt.
Für den Autor erscheint der Wald im sozialen Kontext vorrangig als ein Zufluchtsort. Zum einen bietet der Wald einen Erlebnisraum außerhalb der städtischen Lebensweise und lässt das Individuum aus seinem sozial fest eingebundenen Netzwerk hinaustreten. Zum anderen stellt der Wald gleichzeitig einen Überlebensraum für Emigranten und Heimatlose dar. Gillis van Coninxloo (Abb.l) habe diese allgemein bestehende Waldsymbolik unter Beeinflussung von Lipsius literarischem Werk De Constantia in malis publicis libri duo (Antwerpen 1584) in seinen Bildern zum Ausdruck gebracht und in Symbiose mit zeitgenössischen exilmotivischen Bildthemen gesetzt.
„Der Wald ist der Ort der Vaterlandslosen, das bedeutet für Lipsius konkret der symbolische Zufluchtsort der niederländischen Kriegs- und Glaubensflüchtige. Der Wald symbolisiert also das niederländische Exil. Coninxloo besaß die Constantia, kannte also diese symbolische Bedeutung des Waldes. In seinen Waldlandschaften mit biblischen und mythologischen Exilthemen griff er auf diese Bedeutung zurück.“[21]
Ob die Constantia von Lipsius tatsächlich die Waldlandschaft in Gillis van Coninxloo's Werken einleitet, stellt in dieser Arbeit keinen tieferen Auseinandersetzungsschwerpunkt dar. Es ist jedoch kaum nachvollziehbar, dass der Wald in Gillis van Coninxloo's Werken eine deutungsunterstützende Funktion für die Staffagen einnehmen soll. Viele Faktoren sprechen gegen eine konfessionelle Deutungsebene in Hinblick des Exilsmotivs, die Papenbrock thematisiert. In diesem Kontext müsste der Künstler unmittelbar das Werk in seiner Gesamtheit geschaffen haben.
Bekannt ist tatsächlich, dass der Künstler häufig Waldlandschaften anfertigte, in denen andere Künstler die Staffagen hinzufügten. Das bekannteste Beispiel stellt dabei das Dresdner Werk Das Urteil des Midas (Abb.2)[22] dar. Die Landschaft konnte Gillis van Coninxloo zugeordnet werden, doch die Staffage schien einer anderen Künstlerhand zu entspringen. Dabei nahm Eduard Plietzsch 1910 eine Differenzierung vor. Nach seinem Ermessen malte Coninxloo die Figuren im Mittelgrund selber, während im Vordergrund die Staffage den Stil des Cornelis van Haarlem aufweist[23]. 1961 erkannte Reznicek[24] in den Figuren Affinitäten zu Staffagen, die von Karel van Mander gemalt wurden. Er gestand dem Künstler die Staffagenautorschaft zu und gelangte zur Erkenntnis, dass die Midas- Szene nachträglich hinzugefügt wurde, vermutlich um 1600.
Dem schließt sich Raspe an. In seinem Aufsatz24[25] aus dem Jahr 2003 verdeutlicht er, dass Karel van Mander tatsächlich die Staffage in die Waldlandschaft hineinsetzte. Der Autor verglich unter Betrachtung des Figurenstils und der Figurenanordnung die Szene des Midas-Urteils mit der Staffage im Werk Die Großmut des Scipio (Abb.6). Dieses Werk ist von Karel van Mander signiert und auf das Jahr 1600 datiert.
Ohne vertiefend einen detaillierten Vergleich der Staffagen beider Werke durchzuführen, soll zumindest erwähnt sein, dass die im Halbkreis angelegten Figuren größtenteils sitzend eine Beobachterposition einnehmen, während die annähernd im Mittelpunkt stehende Figur oder Figurengruppe volle Aufmerksamkeit von den anderen Personen erfährt. Es handelt sich dabei um die Hauptprotagonisten, die im Contrapost stehen. (Abb.7) Auch wenn die Figuren im Großmut des Scipio mit einer reduzierteren Körpersprache auftreten, wiederholen sich die Mimiken einzelner Figuren. Das Profil der im Vordergrund sitzenden Frau beispielsweise weist charakteristische Gesichtszüge zu der sich im Mittelpunkt befindlichen stehenden Verlobten des Celtiberier Allucius auf. Ihre gleiche hohe Stirnpartie, das leicht sich zuspitzende Kinn und die ähnliche Nasenform lassen auf einen gleichen Frauentyp schließen. (Abb.8)
Auf Grund dieser stilistischen und kompositorischen Übereinstimmungen bekräftig sich die Vermutung, dass Karel van Mander die Szene des Urteil des Midas malte. Allerdings wurde die Szene erst nach 1600 hinzugefügt, als die beiden Künstler sich in Amsterdam aufhielten und sich dort ihre Wege kreuzten. Denn während Gillis van Coninxloo von Antwerpen über Zeeland nach Frankenthal auswanderte und 1595 schließlich nach Amsterdam kam, verbrachte Karel van Mander einen Großteil seines Lebens in Italien und Haarlem, bis er 1604 ebenfalls nach Amsterdam zog. Nach Rapse platzierte van Mander die mythologische Szene nach der Veröffentlichung seines schriftlichen Werkes Schilder- Boeck[26]. Vermutlich erwies sich dies als günstiger Schachzug, um einen Bedeutungsbezug zur Kunsttheorie und Kunstpraxis zu ziehen. Die Staffage des Midas-Urteil könnte dabei die praktische Umsetzung van Manders theoretischer Auseinandersetzung mit Staffagen und den Metamorphosen Ovids darstellen.
Ein weiteres Indiz verdeutlicht, dass zahlreiche der Werkstaffagen nachträglich in die Waldlandschaft eingebettet wurden. Denn aus einem Nachlass-Dokument[27] von 1607 kann entnommen werden, dass einige Werke von Gillis van Coninxloo ohne Staffagen in seinem Atelier gelagert waren. Unter anderem legte der Künstler eine Waldlandschaft (Abb.9) an, in der bis heute keine Staffage integriert wurde. Dieses Werk befindet sich im Mainzer Landesmuseum, wobei die genaue Datierung nicht festgestellt wurde. Ebenso befindet sich heute eine Waldlandschaft (Abb.10) im Wiener Kunsthistorischen Museum aus dem Jahr 1598. Lediglich Tiere, wie Hirsche und Reiher, sowie Waldvögel, wurden in dem Waldraum platziert.
Allerdings bleibt die Frage offen, ob er vor der Produktion oder bei der Fertigstellung seiner Werke die Staffagenkomposition und -darstellung einplante, oder jene Figuren anderen Bestimmungen folgten. Es finden sich keinerlei Quellen oder schriftliche Indizien, die eindeutig belegen, unter welchen Vorrausetzungen die Staffagen in den Waldlandschaften Platz fanden. Bekannt ist allerdings, dass sowohl in solchen farbig angebrachten Waldlandschaften und Zeichnungen mit Waldlandschaft grundsätzlich keine Staffagen vorhanden sind und der Wald diesbezüglich das Motiv des Werkinhaltes darstellt.
Aus diesem Grund ist es zweifelhaft, dass der Landschaftsraum der später hinzugefügten Szene im Vordergrund eine aussagekräftige Unterstützung bieten kann. Sodass die von Papenbrock aufgestellte Behauptung, der Wald weise Indizien der konfessionellen Konflikte auf, die sich anhand des Exilmomentes in Gillis van Coninxloo's Waldlandschaften wiederfinden, in diesem Kontext fehlerhaft erscheint.
Papenbrock bringt im Sinne des konfessionellen Exilkonfliktes Werkbeispiele des Künstlers an, die teilweise in ihrer Datierung unbekannt sind und welche, die nach der Übersiedlung von Frankenthal nach Amsterdam entstanden, obwohl er in seinem Untertitel Gillis van Coninxloo und die Frankenthaler Maler eine zeitlich periodische Beschränkung in der Werkbetrachtung und -untersuchung angibt. Die zeitlichen Abweichungen ignorierend bringt er Werke in seinem Habilitationsschreiben ein, passend zu seinem aufgestellten Exilmotiv. Aus diesem Grund ist es fraglich, ob Gillis van Coninxloo ausgehend von Lipsius' Constantia dem Wald als Bedeutungsträger einen konfessionskritischen Bildkontext zuschreibt.
Des Weiteren entwickelt der Künstler das Konzept einer Waldlandschaft nicht erst ausgehend von den Exilszenen. Man geht in der Forschung davon aus, dass bereits früher in Antwerpen Waldbilder von dem Künstler gemalt wurden. Denn bereits vor seinem Aufenthalt in Frankenthal, so die Vermutung von Büttner, soll Gillis van Coninxloo kleine Waldbilder geschaffen haben.[28]
Da jedoch die meisten Werke des Künstlers undatiert sind und das Ausmaß seines künstlerischen Schaffens noch nicht endgültig ermittelt werden konnte, gilt es dies eingehend in der kunsthistorischen Forschung zu untersuchen. Auch wenn die Möglichkeiten innerhalb dieser Arbeit eingeschränkt sind, solch eine vertiefende Nachforschung durchzuführen, konnte ich eine Zeichnung ausfindig machen, die dem Anschein nach Büttners Aussage stützt.
Es handelt sich dabei um ein kleinformatiges Werk mit einer Größe von 0,248 x 0,381 m, welches zuvor Gerzsi dem Künstler Jan Brueghel (I) zuschrieb. Zu sehen ist eine Waldlandschaft mit Dorf und Bach (Abb.11). Die dünnstämmigen und in die Höhe strebenden Bäume, die von der rechten Vordergrundseite ausgehend sich im linken Mittelgrund verjüngen und den Wald bilden, weisen auf die Phase Gillis van Coninxloo zwischen Amsterdam und Frankenthal hin.
Die Baumanordnung ist überschaubar angelegt, die durch einen lockeren Abstand der Bäume untereinander den Hintergrund durchblicken lässt. Sowohl der Weg als auch der rechtsseitig angelegte Bach verlaufen vertikal in den Hintergrund. Möglicherweise führt der Wegpfad in das Dorf, welches im Werk hinter der Waldfront auf dem Linken Werkbilddrittel eingebettet ist. Mit Ausnahme der dörflichen Ansiedlung weist die Landschaft auf keine menschlichen Aktivitäten hin und die Natur erscheint hauptsächlich als der primärere Interessen- und Betrachtungsschwerpunkt.[29]
Dies hält Papenbrock dennoch nicht davon ab, in der Deutungsebene das Exilmotiv weiterführend als eine sozialkritische Reflexion der Lebenssituation des Künstlers Gillis van Coninxloo zu erweitern, dessen Exildasein an die konfessionellen Umstände gebunden sei. Denn die „Verbindung von religions- und exilpolitischen Diskursen in den Bildern entspricht der historischen Realität. Das niederländische Exil des 16. Jahrhunderts war vor allem ein konfessionelles und weniger ein politisches oder wirtschaftliches Exil.“[30] Deutlicher wird der Autor Papenbrock in Betrachtung der mythologischen Landschaften (4.3.1.), wo der im Midas-Urteil befindliche Apollo die Exilsituation von Gillis van Coninxloo wiederspiegeln solle.
„Vielleicht thematisierte Coninxloo mit dem Midas-Urteil also tatsächlich seine Situation nach der Flucht aus Antwerpen, als er in der Fremde, zunächst in den nördlichen Niederlanden und später in Frankenthal, neue Auftraggeber suchen mußte und sich immer wieder von neuem deren Urteil auszusetzen hatte.“[31] Nachdem allerdings ermittelt wurde, dass Karel van Mander die Staffage erst nach 1600 im Sinne seines Schilder-Boecks malte und die Waldlandschaft in einem traditionellen Darstellungskontext steht, erscheint es abwegig, dass Gillis van Coninxloo von Lipsius Constantia ausgehend den Wald in einem konfessionskritischen Bildkontext zu betten und als Deutungsträger einer scheinbar existenten >exilthematischen Szene< zu interpretieren versuchte.
3. DIE JAGD IM WALD - IN GILLIS VAN CONINXLOO'S SPÄTWERKEN
Die These eines konfessionellen Exilmotivs in Gillis van Coninxloo' s Werken konnte unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Betrachtung nicht bekräftigt werden, sodass der Wald nicht als Ort des Exils existieren kann. Allerdings ist damit nicht ausgeschlossen, dass die Waldlandschaft eine religiöse Deutungsebene enthalten könnte. Auch wenn in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen bereits Erwähnungen diesbezüglich vorgenommen wurden, beschränkte sich dies vorrangig auf die Landschaftswerke von Gillis van Coninxloo in der Frankenthaler Zeit. Doch inwiefern eröffnet die Jagd im Wald in seinen Spätwerken tatsächlich eine religiöse Deutungsebene? Und lässt es unter Berücksichtigung der zeitlichen Verschiebung von Waldlandschaft und hinzugefügten Staffagen überhaupt eine Deutungsebene zu?
Da den Waldlandschaften des Künstlers erst zu einem späteren Zeitpunkt Staffagen gemalt wurden[32], erscheint es notwendig sich ebenfalls vertiefend mit dem Waldmotiv als konfessionellen Handlungsraum auseinanderzusetzen und abschließend den religiösen Bezug der Staffagen im Wald zu untersuchen.
Es gibt zahlreiche Spätwerke des Künstlers Gillis van Coninxloo mit Jagdszenen in Waldlandschaften. Die Jagdszenen können jedoch durch die geminderte Bildqualität der öffentlichen frei verfügbaren Quellen nur stark eingeschränkt näher untersucht werden. Deshalb sollen lediglich zwei solcher kleinformatigen Waldlandschaften ausgehend von einer Werkbetrachtung unterstützend den aufgestellten Fragen auf den Grund gehen. Es handelt sich bei diesen Werken einerseits um die Waldlandschaft mit Jägern (Abb.12) von 1598 und Waldlandschaft mit Reiherjagd (Abb.13) aus dem Jahr von 1605/1606[33].
Die beiden Werke wurden ausgewählt, weil ersteres die Jagdszene im nahsichtigen Wald Gillis van Coninxloo's Landschaften einleitet und das 1605/1606 entstandene Werk eines der letzten Werke des Künstlers darstellt.
Beide Werkbeispiele stehen stellvertretend für die anderen Waldlandschaften mit Jagdmotiven. Denn wie in den Spätwerken des Künstlers Gillis van Coninxloo unschwer zu erkennen ist, treten motivisch sich wiederholende Elemente, die sowohl Tier- als auch Menschenstaffagen beinhalten, in einem festgelegten Raum auf. Es handelt sich dabei hauptsächlich um eine waldige Nahlandschaft, die von Waldlichtungen oder menschlich angelegten Pfaden und Brücken in ihrer dichten Undurchdringbarkeit aufgelöst wird. Dabei wird der nahezu geschlossene Waldausschnitt von den nahstehenden Bäumen geformt und ausgebildet.
Die an den Rändern platzierten Bäume im Vordergrund umrahmen die Einsicht in den Waldausschnitt und eröffnen eine Situation, in der der Betrachter als stiller Beobachter fungiert. Dieser ist oftmals vom Bildgeschehen bewusst abgetrennt, denn unmittelbar im Bildvordergrund verlaufen horizontal Waldgestrüpp, hohe Gräser und Büsche oder diese ragen von unten in die Bildfläche hinein. Es suggeriert den Einblick in eine private, eine der Öffentlichkeit nahezu verborgenen Szene, wo jegliche Sinne des Betrachters beansprucht werden.
Die Waldlandschaft steht in einem sehr starken Spannungsfeld von einer dichten Gliederung der Baumanordnung und eines locker geschwungenen Waldbodens. Die Gründe greifen ineinander, wobei kleinere Wege und Pfade den Blick des Betrachters in den fernen, tiefenräumlichen Hintergrund, vereinzelt mit Lichtungen, leiten. Diese entstehen aus kleinen freistehenden Flächen im Waldmittelgrund und durchbrechen die Dichte des Waldraumes.
Die flächigen Weiträume ermöglichen Platz für szenische, künstlerische Darbietungen, bei denen verschiedene Jagdsituationen dargestellt und Tiere integriert werden sowie kleinere weitere Figurenszenen dem Bildinhalt Bedeutungsinhalte liefern.
3.1. Eichenwald als wirtschaftlicher Nutzungsraum
Die 1598 entstandene Waldlandschaft mit Jägern (Abb.14) wurde mit Öl auf Holz gemalt. Mit einer Größe von 0,44 x 0,63 m gehört es zu den kleinformatig angelegten Spätwerken Gillis van Coninxloo's und befindet sich unter der Inventarnummer 751 in den Fürstlichen Sammlungen des Fürsten von Liechtenstein in Vaduz.
Dem Betrachter wird der Einblick in einen Eichenwald gewährt, der einen nahsichtigen Ausschnitt der Tiefen des Waldes darstellt. Dort sind die Bäume eng aneinander angelegt. Sie stehen häufig als Zweier-Konstellation in einem geometrischen Raster, welches sich aus losen, verkürzt vertikalen in den Hintergrund führende Reihen und horizontalen Linien zusammensetzt. (Abb.15) Die Baumanordnung verdichtet sich in den Hintergrund zunehmend, sodass er undurchdringlich erscheint. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine starre Anordnung der Bäume. Vielmehr werden die Linien durch die Wellenbewegungen des Waldbodens aufgelockert. Dieser bildet nicht eine weitestgehend ebenmäßige Fläche, wie der Künstler Gillis van Coninxloo in seinen Werken bis Ende der 1590er es darzustellen pflegte, sondern überwindet ein monotones Erscheinungsbild.
Im Vergleich dazu wird in der Waldlandschaft mit Verstoßung der Hagar (Abb.16) deutlich, dass Gillis van Coninxloo zuvor dem geometrisch ästhetischen Ideal folgend seine Bäume platzierte und im Verlauf seiner zahlreichen waldlandschaftlichen Darstellungen diese symmetrische Anordnung weiterführend auflockerte. In der linken Waldlandschaft der Verstoßungsszene von der Sklavin Hagar erscheinen die Bäume in einer Anordnung, die sich mit mehreren Reihen vertikal verlaufend in den tief liegenden Bildhorizont erstreckt. (Abb.17) Die Blätter der Baumkronen verdichten sich zu einer großen Einheit und verhindern eine Sicht auf die Landschaft des hinteren Bildgrundes. Somit erscheint die Waldformation als uneinsichtige Front und leitet den Blick des Betrachters auf die Figurenszene im Vordergrund.
Die leichten Erhebungen des Waldbodens verstärken die Reihenanordnung der Bäume, denn sie befinden sich gleichmäßig in ihrer Höhe und Größe an den Baumstämmen und laufen um diese aus. Dabei wird eine immense Tiefenräumlichkeit erzeugt, die durch die Anordnung der Baumformation charakterisiert wird. Die Bäume weisen untereinander einen gleichbleibenden Abstand auf und stehen nicht zu eng aneinander, sodass zwischen den Stämmen sowohl der Horizont ersichtlich bleibt, als auch Licht und Luft die Waldlandschaft durchdringen können.
Anders verhält es sich bei der Waldlandschaft mit Jägern von 1598, die eine differente Baumanordnung beinhaltet. Die Bäume, die im Vorder- und Mittelgrund angelegt wurden, dienen als Ausgangspunkte für die in den Bildhintergrund verlaufenden Baumreihen (Abb.18). Dazwischen hat allerdings der Künstler ebenfalls Bäume platziert, was ausschlaggebend für die bereits erwähnte Dichte und nahezu vorhandene Undurchdringlichkeit ist.
In Coninxloo's Spätwerken bleibt die dichte Beschaffenheit des Eichenwaldes bestehen, nur wird sie bereits um 1600 noch mehr durch Lichtungen aufgebrochen und die Waldatmosphäre aufgelockert. Dies wird anhand der Waldlandschaft mit Reiherjagd (Abb. 19) aus dem Jahr 1605/1606 erkenntlich. In dem Werk findet sich der Betrachter ebenfalls im Inneren des Waldes wieder. Dieser Wald bildet keine Reihenformation, sondern scheint sich aus willkürlich platzierten, nahezu gradlinig wachsenden Bäumen zusammenzusetzen. Dennoch unterliegt die Waldanordnung einer geometrischen Formation von Baumreihen, welche erst durch zusätzliche Waldelemente entstanden sind und nach denen sie sich ausrichtet
[...]
[1] Das erste Praktikum fand studiumsbegleitend in dem Zeitraum zwischen dem 02. Mai bis Ol.Juli 2011 statt und das weiterführende wurde zwischen dem 10.April bis 04. Mai 2012 praktiziert.
[2] Beginnend mit dem Lehrgedicht Grondt der Edel vry Schilder-Const vermittelt van Mander allgemein Basiswissen zur Kunst. Darauf aufbauend beinhaltet das Buch eine umfangreiche Anzahl an Künstlerbiographien, die neben antiken und italienischen Meistern eine bemerkenswerte Zahl an deutschen und niederländischen Künstlern präsentiert. Anschließend befasst sich Karel van Mander mit Ovids Metamorphosen. Dieser Text steht im Kontext der europäischen Darstellungstradition in Werken und wird durch die zuvor angelegten Biographien der aus verschiedenen Zeitsparten stammenden Künstler unterstützt. Es wird dementsprechend der ästhetische und künstlerische Zeitgeist untersucht und vorgestellt.
[3] Karel van Mandel, Het Schilder-Boeck. Den Grondt der Edel vry Schilder-const, Haarlem 1604, 268r, aus: http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0255.php (25.05.2012)
[4] Max Roose, Geschichte der Malerschule, München 1861.
[5] Ulrike Hanschke, Die flämische Waldlandschaft. Anfänge und Entwicklungen im 16. und 17. Jahrhundert (Manuskripte zur Kunstwissenschaft, Bnd 16), Stuttgart 1988, 131.
[6] Eduard Plietzsch, Die Frankenthaler Maler. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der niederländischen Landschaftsmalerei, in: Beiträge zur Kunstgeschichte (Folge XXXVI.) Leipzig 1910.
[7] Hertha Wellensiek, Gillis van Coninxloo. Ein Beitrag zur Entwicklung der niederländischen Landschaftsmalerei um 1600 (Dissertation), Bonn 1954.
[8] Frits Lugt, Pieter Bruegel und Italien, in: Festschrift für Max J. Friedländer zum 60. Geburtstag, Leipzig 1927, 111-129.
[9] Martin Papenbrock, Landschaften des Exils. Gillis van Coninxloo und die Frankenthaler Maler (Europäische Kulturstudien; Bnd. 12), Köln/ Weimar/ Wien 2001, 180.
[10] Karl Arndt, Pieter Bruegel d.Á. als Vorläufer Coninxloos. Bemerkungen zur Geschichte der Waldlandschaft (Sitzungsberichte), in: kunstgeschichtliche Gesellschaft zu Berlin, 1965. ebenso Karl Arndt, Pieter Bruegel d.Á. und die Geschichte der,, Waldlandschaft“, in: Jahrbuch der Berliner Museen, Berlin 1972.
[11] Teréz Gerszi, Bruegels Nachwirkung auf die niederländischen Landschaftsmaler um 1600, in: Oud Holland (90)1976, 201-229.
[12] Hanschke, Dieflämische Waldlandschaft, 15.
[13] Ebd., 15.
[14] Heinrich Gerhard Franz, Der Landschaftsmaler Gillis van Coninxloo, aus: Kunst Kommerz Glaubenskampf. Frankenthal um 1600, (Ausstellungskatalog), hrg. von Edgar J. Hürkey, Worms 1995, 103 - 113.
[15] Joseph Alexander Graf Raczynski, Die Flämische Landschaft vor Rubens. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der flämischen Landschaftsmalerei in der Zeit von Brueghel bis zu Rubens (Dissertation, Veröffentlichungen zur Kunstgeschichte, Band 1), Frankfurt am Main 1937
[16] Ebd., 27.
[17] Eduard Plietzsch, Holländische und Flämische Maler des XVIIJahrhunderts, Leipzig 1960, 212.
[18] Franz, DerLandschaftsmaler Gillis van Coninxloo, 109f.
[19] Martin Papenbrock, Landschaften des Exils, Gillis van Coninxloo und die Frankenthaler Maler, Europäische Kulturstudien (Bnd. 12), Köln/Weimar/Wien 2001, 3.
[20] Ebd., 153.
[21] Papenbrock, 157f.
[22] Gillis van Coninxloo, Das Urteil des Midas, 1588, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden 1588.
[23] Diese Information wurde der Karteimappe der Gemäldegalerie Alte Meister Dresden entnommen (11.06.2012)Allerdings unterscheiden sich hier im Vergleich mit dem Werk Der Sturz Lucivers, um 1588 (Abb.3) des Künstlers Cornelis van Haarlem sowohl Corpus als auch Mimik der einzelnen Figuren beider Werke, wenngleich die Figuren im Contrapost dem Zeitgeist entsprechen. Die um 1600 entstandenen Figuren des Cornelis van Haarlem zeugen wohl eher von einem gleichen Stil. (Abb.4) Dies könnte dahingehend im Zusammenhang stehen, weil in Haarlem beide Künstler (Cornelis und van Mander) sich und ihre Arbeit durch die Haarlemer Akademie kannten. Es wäre möglich, dass dort ein gemeinsamer Bildtyp an Figuren entstand und Karel van Mander diesen mit nach Amsterdam brachte und in diesem Stil die Szene des Midas- Urteils in Gillis van Coninxloo Waldlandschaft anfertigte. So findet sich die mit dem Rücken zum Betrachter gerichtete sitzende Frau des Midas-Urteil ebenfalls in Allegorie der Künste und Wissenschaft (Abb.5) wieder. Nähere Zusammenhänge zwischen den Künstlern werden dahingehend im Text näher erläutert.
[24] E. Reznicek, Die Zeichnungen von Hendrick Goltzius, Utrechtse kunsthistorisch Studien (6), Utrecht 1961,
178. aus: Martin Raspe, 'Strijdt tegen Onverstandt' Das Urteil des Midas und die Virtus der
Landschaftsmalerei bei Gillis van Coninxloo, Karel van Mander und Hendrick Goltzius, in: Jan de Jong/ Dulcia Meijers/ Mariet Westermann/ Joanna Woodall, Virtus. Virtuositeit en kunstliefhebbers in de Nederlanden 1500-1700 (Nederlands kunsthistorsich Jaarboeck(54)), Zwolle 2003, Fußnote 9.
[25] Martin Raspe, 'Strijdt tegen Onverstandt ' Das Urteil des Midas und die Virtus der Landschaftsmalerei bei Gillis van Coninxloo, Karel van Mander und Hendrick Goltzius, in: Jan de Jong/ Dulcia Meijers/ Mariet Westermann/ Joanna Woodall, Virtus. Virtuositeit en kunstliefhebbers in de Nederlanden 1500-1700, (Nederlands kunsthistorsich Jaarboeck(54)), Zwolle 2003, 141-169.
[26] Martin Raspe, 'Strijdt tegen Onverstandt', 144.
[27] Auf der Suche nach jenem Dokument, konnte jenes im Internet gefunden werden Es handelt sich dabei um folgendes im Internet präsente Exemplar: N. de Roever, De Coninxloo's, in: Oud Holland - Quarterly for Dutch Art History (Bnd III, 1), Januar 1885, 33-50. aus:
http://booksandjournals.brillonline.com/content/10.1163/187501785x00224 (03.07.2012)
[28] Nils Büttner, Landschaften des Exils? Anmerkungen zu Gillis van Coninxloo und zur Geschichte der flämischen Waldlandschaft aus Anlaß einer Neuerscheinung. Aus: Zeitschrift für Kunstgeschichte (66) 2003, 552,aus: http://archiv.ub.uni-
heidelberg.de/artdok/volltexte/2010/1042/pdf/Nils_Buettner_Landschaften_des_Exils_2003.pdf (03.05.2012)
[29] Das Werk befindet sich in Graphische Sammlung Albertina, Wien, Inv.nr. 8056; cat. Benesch 1928, nr. 250,/ aus rkd:
http://www.rkd.nl/rkddb/%28y4lgqpqayzqqn345ratndfmv%29/detaihaspx?parentpriref=#. (23.05.2012) Allerdings könnte es sich hierbei ebenfalls um eine Vorstudie handeln, die Gillis van Coninxloo anfertigte.
[30] Papenbrock, 209.
[31] Ebd., 139.
[32] Dies wurde im vorigen Abschnitt anhand des Midas-Urteils und Karel van Manders Figurenvergleich thematisiert.
[33] In den Quellen, in denen das Werk ausgeführt wird, schwankt die Datierung um 1605 und 1606 herum.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Gillis van Coninxloo?
Er war ein bedeutender flämischer Landschaftsmaler des 16. Jahrhunderts, der eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Waldlandschaftsmalerei spielte.
Gilt Coninxloo als Begründer der Waldlandschaft?
Obwohl er oft als "spiritus rector" bezeichnet wurde, zeigen neuere Forschungen, dass bereits Künstler wie Pieter Bruegel vor ihm Waldmotive thematisierten.
Welche religiöse Bedeutung hat die Jagd in seinen Werken?
Die Arbeit untersucht, inwiefern die Jagd im Wald als religiöse Metapher oder im Kontext konfessioneller Bezüge seiner Zeit interpretiert werden kann.
Was ist das "Urteil des Midas"?
Ein bekanntes Werk von 1588 aus der Dresdner Gemäldegalerie, das Coninxloos Übergang von der Überschaulandschaft zur Waldlandschaft zeigt.
Wird der Wald in seinen Bildern als Exilort gesehen?
Die Arbeit setzt sich kritisch mit der These von Martin Papenbrock auseinander, die den Wald in Coninxloos Werken als Ort des Exils interpretiert.
- Citation du texte
- Anja Ritter (Auteur), 2012, "Die Jagd im Wald" in Gillis van Coninxloo´s Spätwerken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231083