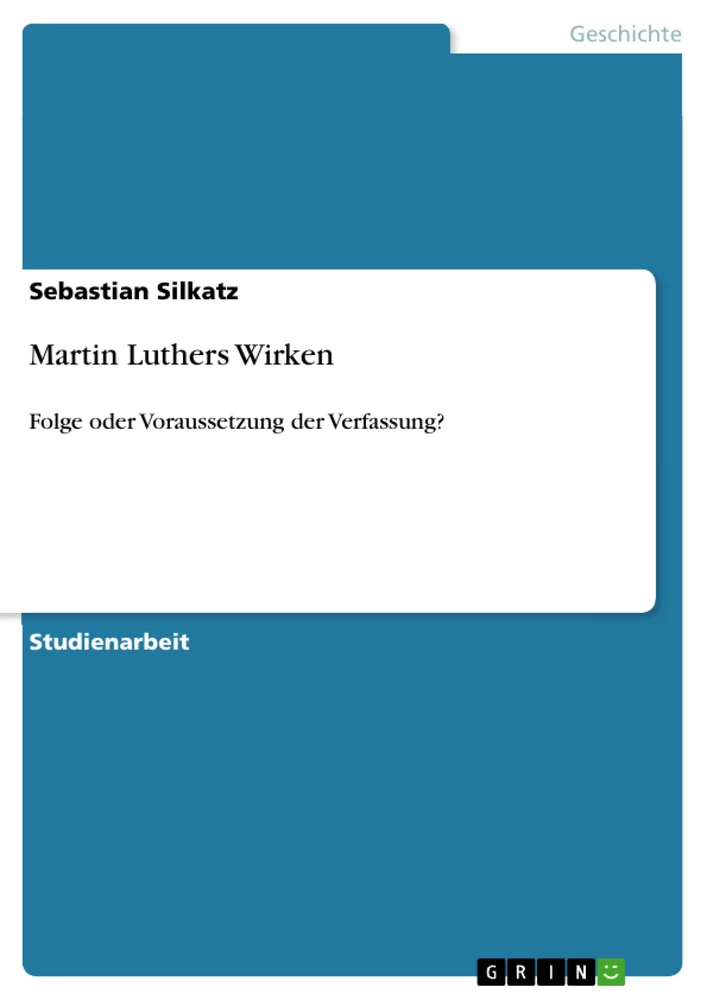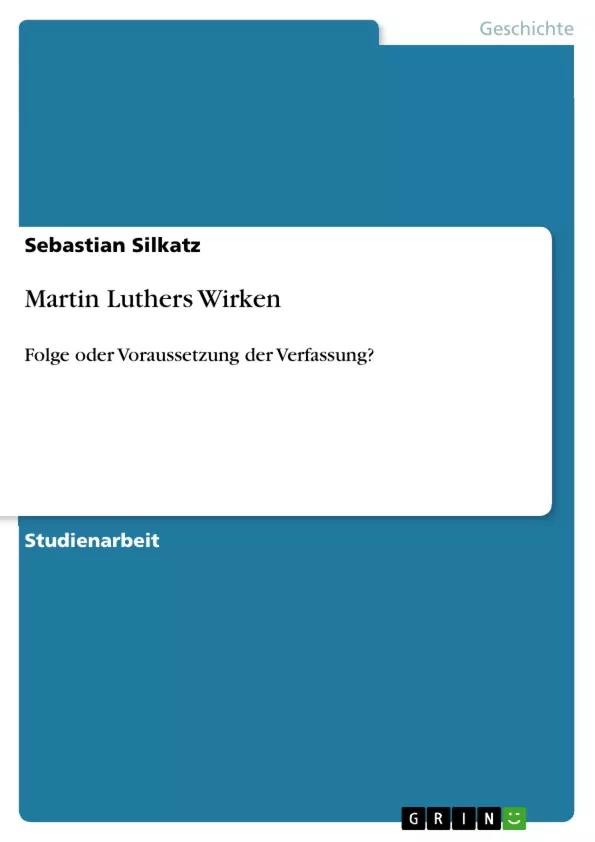Im Jahr 2003 ließ das ZDF seine Zuschauer für die Fernsehsendung „Unsere Besten“ die bedeutendsten Deutschen wählen. Im abschließenden Ranking belegten zahlreiche Politiker, Künstler und Gelehrte die vorderen Plätze. Obwohl über einige Entscheidungen diskutiert wurde, blieb die Wahl Martin Luthers, der nach Konrad Adenauer den zweiten Platz belegte, unumstritten; zu offensichtlich sind die Einflüsse seines Wirkens auf die deutsche Geschichte.
Dass der Protestantismus als gültige Lehre des Christentums anerkannt wurde, ist auf Luthers Wirken in der politischen Wirklichkeit zurück zuführen. Da Luther einerseits an die rechtlichen Realitäten gebunden war, andererseits die von ihm ausgehende Reformation die Gestaltung der Verfassung ebenfalls langfristig modifizierte, stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis Luther und sein Handeln in Beziehung zu dieser Verfassung stehen. In dieser Arbeit wird deshalb erörtert, inwiefern das Vorgehen und der Erfolg des Reformators an die politische Wirklichkeit gebunden waren und Luthers Wirken somit eine Folge der Verfassung war. Da die protestantische Bewegung jedoch auch die Gesetze des Reiches veränderte und letztlich festigte, wird ebenso erläutert, ob Luthers Wirken zugleich eine Voraussetzung für die Durchsetzung der Verfassung darstellte.
Dafür werden die Biografie Martin Luthers und die wichtigsten Aspekte seiner Theologie vorgestellt. Anschließend werden die wichtigen Geschehnisse chronologisch erläutert und dabei in Beziehung zur Fragestellung gesetzt. So wird als Grundlage für die Bewertung von Luthers Wirken die Verfassung des Reiches skizziert. Dafür werden Voraussetzungen und die verfassungsrechtlich fundamentalen Beschlüsse des Reichstags zu Worms 1495 sowie die weiteren Entwicklungen bis zu Luthers erstem Auftreten 1517 in je einem eigenem Kapitel dargestellt. Nachdem diese Grundlagen für das Agieren Luthers veranschaulicht wurden, konzentriert sich die Darstellung auf das Wirken des Reformators und den Verlauf der Reformation.
Nachdem Luthers Wirken und dessen Folgen mittels konkreter Ereignisse und Handlungen erörtert wurden, werden in einem eigenen Kapitel die langfristigen Entwicklungen für Kaiser und Reich in der Frühen Neuzeit übersichtlich zusammengefasst. Auf den bisherigen Darstellungen aufbauend, widmet sich eine Erörterung der Frage, inwiefern Luthers Wirken Folge oder Voraussetzung der Verfassung des Reiches war. Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit in einer Zusammenfassung resümiert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Martin Luther und seine Theologie
3. Die deutsche Verfassung vor dem Wirken Luthers
3.1 Die Situation vor dem Reichstag zu Worms
3.2 Der Reichstag zu Worms
3.3 Zwischen Worms 1495 und dem Thesenanschlag
4. Martin Luthers Wirken
4.1 Vom Thesenanschlag 1517 bis zum Bann
4.2 Vom Reichstag zu Worms 1521 bis zum Reichstag in Speyer
5. Der weitere Verlauf der Reformation
5.1 Vom Reichstag zu Augsburg 1530 bis zu den Passauer Verträgen
5.2 Der Augsburger Religionsfrieden
6. Luthers Wirken und die langfristigen Entwicklungen für das Reich
7. Luther und die Verfassung des Heiligen Römischen Reiches
8. Zusammenfassung
9. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte Martin Luther auf die deutsche Verfassung?
Luthers Wirken führte langfristig zur Anerkennung des Protestantismus und modifizierte die Verfassungsgestaltung des Heiligen Römischen Reiches maßgeblich.
War Luthers Erfolg eine Folge der bestehenden politischen Wirklichkeit?
Die Arbeit erörtert, inwiefern Luther an rechtliche Realitäten gebunden war und ob sein Erfolg durch die damalige Verfassung des Reiches erst ermöglicht wurde.
Was war die Bedeutung des Reichstags zu Worms 1495?
Dieser Reichstag legte fundamentale verfassungsrechtliche Beschlüsse fest, die die Grundlage für das spätere Agieren Luthers im Reich bildeten.
Wie entwickelte sich das Verhältnis zwischen Luther und dem Kaiser?
Die Arbeit analysiert die chronologischen Geschehnisse vom Thesenanschlag bis zum Augsburger Religionsfrieden und deren Auswirkungen auf die kaiserliche Macht.
Warum gilt Luther als einer der "Besten" Deutschen?
In Umfragen wie "Unsere Besten" belegte Luther Spitzenplätze, da sein Wirken die deutsche Geschichte, Sprache und Religion tiefgreifend geprägt hat.
- Quote paper
- Sebastian Silkatz (Author), 2012, Martin Luthers Wirken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231084