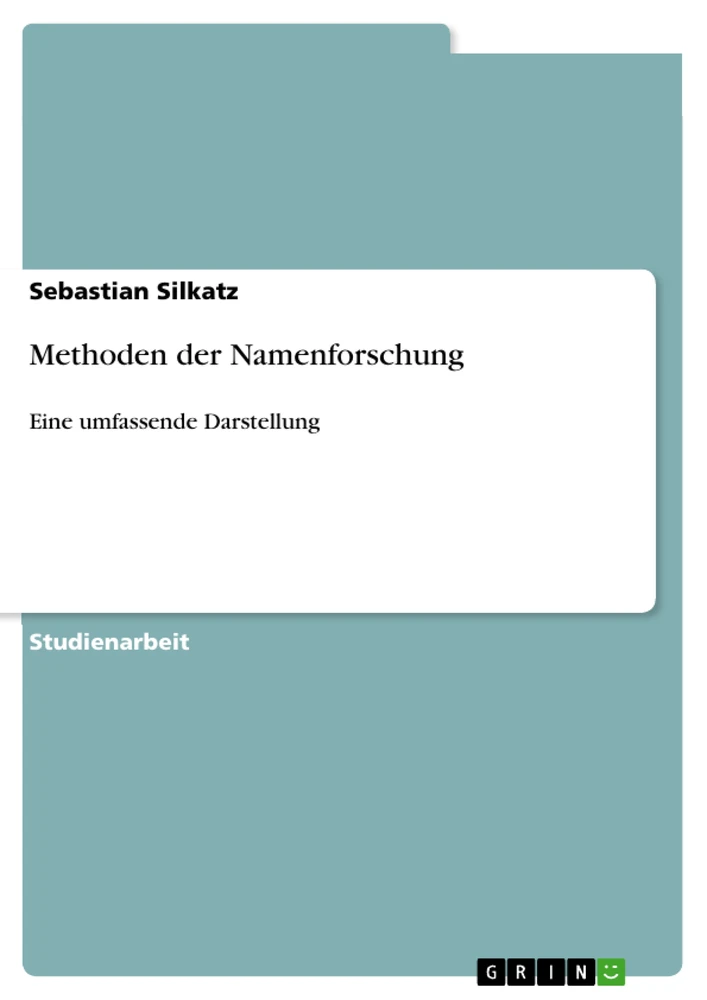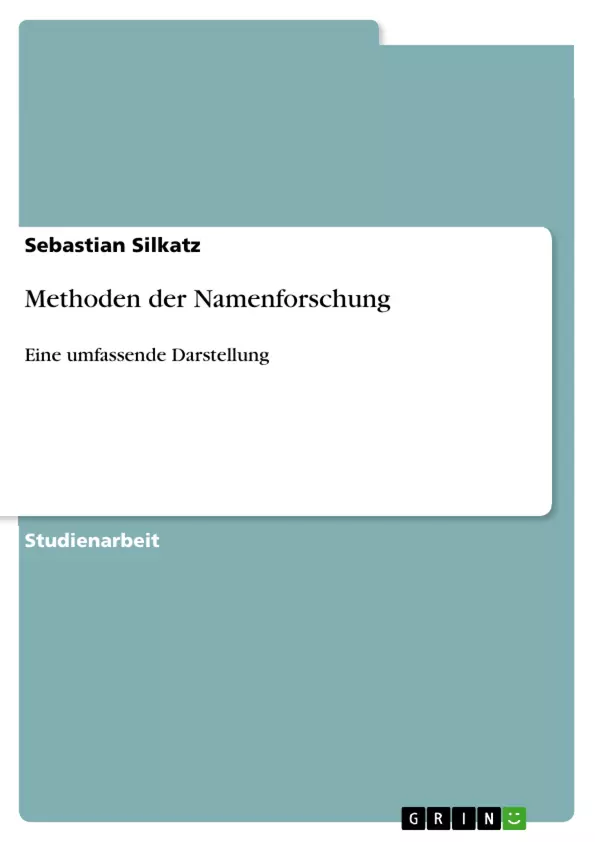Ein wesentliches Merkmal des Menschen ist der Gebrauch von Sprache. Seitdem die Menschen dieses Kommunikationsmittel nutzen, verwenden sie auch Namen zum eindeutigen Bezeichnen von Personen, Tieren und Pflanzen, Orten und Gewässern.
In der heutigen Zeit interessieren sich immer mehr Menschen für die Herkunft und Bedeutung dieser Namen.
Diese Arbeit möchte nunmehr die Frage beantworten, mit welchen Methoden neue Erkenntnisse in der Namenforschung gewonnen werden und die wichtigsten davon erläutern. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei unter anderem darauf, welche Forschungsergebnisse mit der entsprechenden Methode erlangt werden. Zum Teil wird zum besseren Verständnis für die Entwicklung einer Disziplin auch die Geschichte derselben dargestellt. Partiell werden ebenfalls die Mängel einer Methode erwähnt. Im Ganzen betrachtet, wird auf den deutschen Sprachraum eingegangen, auf Ausnahmen dementsprechend hingewiesen.
Besondere Bedeutung erlangt die Namenforschung für die Sprachgeschichte. So ist es unter anderem möglich, indoeuropäische Ursprünge, lexikalische Besonderheiten, die Herausbildung von Einzelsprachen oder auch die Lautverschiebungen mit Hilfe der Namen zu belegen und zu erforschen.
Spätestens seit der Antike sind Namen Gegenstand von Untersuchungen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine wissenschaftliche Forschung im heutigen Sinn. Die methodische Namenforschung, welche die Bedeutung, Entstehung und Verbreitung der Namen erforscht, wird erst deutlich später begründet und geht in ihren Anfängen auf den Sprach- und Litera-turwissenschaftler Jacob Grimm (1785–1863) zurück.
In der Folgezeit wurde die Onomastik allerdings zumeist als Hilfswissenschaft für die Sprachgeschichte und die Gesellschaftswissenschaften betrachtet, konnte sich aber im zwanzigsten Jahrhundert emanzipieren und wird nunmehr als eigenständige Wissenschaft anerkannt.
Für die Namenforschung gilt dabei, „dass kein einzelner Aspekt existieren kann, der den ganzen Komplex onymischer Erscheinungen in sich vereint“. Daher wurden verschiedene Methoden entwickelt, mit denen die Erforschung des Namens erleichtert und systematisiert wird. Die wichtigsten werden nachstehend vorgestellt und erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Terminologie
- 3. Quellenkritik als Methode der Namenforschung
- 3.1 Einführung
- 3.2 Die Geschichte der Quellenkritik als Methode der Namenforschung
- 3.3 Beispiel für die Quellenkritik als Methode der Namenforschung
- 4. Linguistische Methoden der Namenforschung
- 4.1 Textlinguistik als Methode der Namenforschung
- 4.1.1 Einführung
- 4.1.2 Beispiel für die Textlinguistik als Methode der Namenforschung
- 4.2 Soziolinguistik als Methode der Namenforschung
- 4.2.1 Einführung
- 4.2.2 Beispiel für die Soziolinguistik als Methode der Namenforschung: Namen als Standesmerkmal
- 4.2.2.1 Einführung
- 4.2.2.2 Mittelstand und Aristokratie
- 4.2.2.3 Sklavennamen
- 4.3 Areallinguistik als Methode der Namenforschung
- 4.3.1 Einführung
- 4.3.2 Die Geschichte der Areallinguistik als Methode der Namenforschung
- 4.1 Textlinguistik als Methode der Namenforschung
- 5. Literarische Methoden der Namenforschung
- 5.1 Einführung
- 5.2 Intertextualität als Methode der literarischen Onomastik
- 6. Methodische Ergänzungen
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Methoden der Namenforschung und soll neue Erkenntnisse in diesem Bereich gewinnen sowie die wichtigsten Methoden erläutern. Ein Fokus liegt dabei auf den Forschungsergebnissen, die mit den entsprechenden Methoden erzielt werden. Um das Verständnis für die Entwicklung einer Disziplin zu fördern, wird teilweise auch ihre Geschichte dargestellt. Die Arbeit konzentriert sich auf den deutschen Sprachraum, weist aber auch auf Ausnahmen hin.
- Die wichtigsten Methoden der Namenforschung
- Die Geschichte der Namenforschung
- Die Anwendung der Methoden in der Sprachgeschichte
- Die Bedeutung der Namenforschung für die Gesellschaft
- Die Entwicklung der Namenforschung als eigenständige Wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und beleuchtet die Bedeutung der Namenforschung für die Sprachgeschichte. Sie erläutert die Wichtigkeit von Namen in der menschlichen Kommunikation und die steigende Nachfrage nach Informationen über die Herkunft und Bedeutung von Namen. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Terminologie der Namenforschung und definiert die wichtigsten Begriffe wie „Namenkunde“, „Namenstheorie“ und „Onomastik“. Das dritte Kapitel analysiert die Methode der Quellenkritik in der Namenforschung, indem es ihre Geschichte beleuchtet und ein Beispiel für ihre Anwendung in der Forschung gibt.
Das vierte Kapitel widmet sich den linguistischen Methoden der Namenforschung, wobei es sich auf die Textlinguistik und die Soziolinguistik konzentriert. Beide Methoden werden anhand von Beispielen erläutert und ihre Bedeutung für die Erforschung von Namen hervorgehoben. Die Soziolinguistik wird im Speziellen mit dem Beispiel der Namen als Standesmerkmal veranschaulicht. Das vierte Kapitel beinhaltet auch eine Einführung in die Areallinguistik und ihre Anwendung in der Namenforschung.
Das fünfte Kapitel stellt die literarischen Methoden der Namenforschung vor, insbesondere die Intertextualität, und erklärt ihre Anwendung in der literarischen Onomastik.
Schlüsselwörter
Namenforschung, Onomastik, Sprachgeschichte, Quellenkritik, Textlinguistik, Soziolinguistik, Areallinguistik, Intertextualität, Standesmerkmal, deutsche Sprache, wissenschaftliche Methoden.
Häufig gestellte Fragen zu Methoden der Namenforschung
Was ist Onomastik?
Onomastik ist die wissenschaftliche Namenkunde, die sich mit der Bedeutung, Entstehung und Verbreitung von Namen (Personen, Orte, Gewässer) beschäftigt.
Welche Methoden nutzt die moderne Namenforschung?
Zu den wichtigsten Methoden gehören die Quellenkritik, die Textlinguistik, die Soziolinguistik (Namen als Standesmerkmal) und die Areallinguistik (räumliche Verbreitung).
Welche Bedeutung hat die Namenforschung für die Sprachgeschichte?
Namen konservieren oft alte Sprachzustände. Durch sie lassen sich Lautverschiebungen, indoeuropäische Ursprünge und die Herausbildung von Einzelsprachen historisch belegen.
Wie hängen Namen und sozialer Stand zusammen?
Die Soziolinguistik untersucht, wie Namen als Standesmerkmale fungieren – beispielsweise der Unterschied zwischen Aristokraten- und Sklavennamen in der Geschichte.
Wer gilt als Begründer der methodischen Namenforschung?
Die wissenschaftliche Namenforschung im deutschen Raum geht in ihren Anfängen maßgeblich auf den Sprachwissenschaftler Jacob Grimm zurück.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Silkatz (Autor:in), 2008, Methoden der Namenforschung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231086